|
Aufführung
|

19. 10. 2003
(Première)
*
Musikalische Leitung: Alan Gilbert
Inszenierung: David Pountney
Ausstattung: Johan Engels
Lichtgestaltung: Jürgen Hoffmann
Regiemitarbeit: Nicola Raab
*
Tchang-Haitang: Brigitte Hahn, Aniko Donáth
Yü-Pei: Cornelia Kallisch, Louise Martini
Pao: Francisco Araiza, Bernhard Bettermann
Tong: Peter Keller
Tschang-Ling: Rodney Gilfry, Andreas Zimmermann
Tschao: Oliver Widmer, Horst Warnig
Ma: László Polgár, Peter Arens
Frau Tschang: Irène Friedli, Louise Martini
Hebamme: Katharina Peetz
Ein Mädchen: Christiane Kohl
Tschu-tschu: Peter Arens
SYNOPSIS - LIBRETTO
|
|
Rezensionen
|
|
|
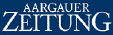
21. 10. 2003
Happy End nur im Fiebertraum
Wiederaneignung: Zemlinskys «Kreidekreis» melodramatisch in Zürich
Es könnte alles gut werden. Das wahre Liebespaar hätte sich gefunden. Die Gerechten wären belohnt, die Ungerechten bestraft. Doch es geht auch anders.
Torbjörn Bergflödt
Ein Happy End. So steht es im Text der Oper «Der Kreidekreis», dem nur wenig veränderten gleichnamigen Schauspiel von Klabund. Und so spricht auch die Musik von Alexander Zemlinsky, die, sonst oft kammerspielhaft dimensioniert, sich im finalen Duett von Haitang und dem Kaiser wagnerianisch aussingt und apotheotisch aufgipfelt.
Der Regisseur David Pountney indes mag der Frau, die von der armen Mutter als Amüsiermädchen ans Teehaus verkauft worden war, und dem Mann, der der Vater ihres Kindes ist, das Glück nicht gönnen. Die im Stück intonierten politisch-gesellschaftskritischen Motive lässt Pountney in einen blutigen Schluss münden. Glück und Gerechtigkeit? Ein Fiebertraum von Sterbenden in eisiger Schneelandschaft. Bestenfalls eine Utopie. Haitang und ihr Bruder, unrechtmässig verurteilt, werden hinterhältig erschossen.
«Der Kreidekreis», Zemlinskys letzte vollendete Oper, hat vor fast genau 70 Jahren im Zürcher Stadttheater seine Uraufführung erlebt. Im Rahmen einer Serie, mit der sich das Opernhaus Zürich an Uraufführungen im eigenen Hause erinnert, ist jetzt mit Pountneys Neuinszenierung an den Dreiakter erinnert worden.
Pountney und sein Ausstatter Johan Engels, die schon Pfitzners «Rose vom Liebesgarten» einen anderen Schluss beschert haben, hätten dem Stück das gute Ende belassen dürfen. Ja, die vermeintliche Schärfung des lehrhaften Elements droht dieses «Morality Play», das Gerechtigkeit anmahnt, gar zum Melodramatischen hin zu entschärfen. Dabei haben die beiden just das Brechtsche sonst ganz meisterhaft her-ausgearbeitet. Für sprechende Doubles, die fallweise auch schauspielern, stehen vorne an der Rampe sechs Stühle. Solches Figuren-Splitting spendet passende Verfremdungseffekte, eine ebenso passende Reverenz ans Kabuki-Theater und lässt sich technisch deshalb gut machen, weil Zemlinsky den Figuren viele Sprechtexte zuordnet. Die ingeniös stilisierten Bühnenbilder und die Kostüme vermitteln keinen Chinoiserien-Kitsch, sondern atmen parabolische Kraft. «Atmosphäre» ist nicht tabu. Stummfilmartig werfen etwa die Opernsängerinnen und -sänger Schatten an die Wände.
Gesungen wird auf hohem Niveau, wobei an der Premiere besonders die deutsche Sopranistin Brigitte Hahn in der Hauptrolle der Haitang das ganze Ausdrucksregister von der Feinziselierung bis zum raumgreifend wogenden Klang bewundernswert durchmass. Unter dem Dirigenten Alan Gilbert kamen beim Orchester wirkungssicher die wechselnden Stile zum Tragen: freches Kurt-Weill-Idiom und spätromantische Süsse, an Mahlers «Lied von der Erde» gemahnende Lineaturverläufe und farbbetonte Klänge.
|

21. 10. 2003
Sieg der Wahrheit
VON ROGER CAHN
Zwei Stunden ohne Pause zog der «Kreidekreis» von Alexander Zemlinksky das Publikum in seinen Bann. Der schwierigen Oper, 1933 in Zürich uraufgeführt, blieb der Sprung auf die Bühnen der Welt versagt. Jetzt kehrte sie ans Zürcher Opernhaus zurück. Premiere war am Sonntag.
Das chinesische Kriminaldrama aus dem 14. Jahrhundert erzählt vom Los eines armen Mädchens, das der Willkür der Macht ausgesetzt ist. Dramaturgischer Höhepunkt ist ein Mutterschaftsprozess gegen die Rivalin. Die wahre Mutter stellt das Wohl des Kindes über das eigene Glück.
So einfach die Geschichte, so kompliziert ist die Struktur der Oper. Zemlinsky verschachtelt Wagnerisches mit trivialer Musik und Cabaret-Szenen à la Kurt Weill, mischt Mahler und Strauss mit fernöstlichen Klängen. Auf der Bühne wird gesungen, gesprochen, gespielt. Das ist alles perfekt konstruiert, doch der Funke springt nur ganz selten auf die emotionale Ebene.
Regisseur David Pountney splittet alles auf: Sänger und Schauspieler teilen sich die Rollen - eine Reverenz ans japanische Kabuki-Theater. Das schafft mal Nähe, mal Distanz. Grosser Vorteil: Bei den Schauspielern versteht man jedes Wort. Die Szenerie von Johan Engels ist die ideale Mischung aus Strenge und Verspieltheit.
Am Dirigentenpult steht der junge Amerikaner Alan Gilbert, zum ersten Mal in Zürich. Er führt Orchester und Solisten auf der Bühne sicher durch die komplizierte Partitur, erzeugt Spannung und Pathos, ohne die Details zu vernachlässigen.
Aus dem Ensemble der Sänger und Schauspieler ragen Brigitte Hahn in der Hauptrolle als Mädchen Tschang-Haitang heraus, Cornelia Kallisch als Gegenspielerin Yü-pei, Lázló Polgár als reicher Mandarin, Peter Arens als Richter.
Fazit: Es wird kein grosser Publikumsrenner werden, trotz faszinierender, ästhetisch wie musikalisch überzeugender Produktion.
|

21. 10. 2003
Eine geglückte Ausgrabung
Erfolg für Alexander Zemlinskys Klabund-Vertonung «Der Kreidekreis» im Opernhaus Zürich
Das zweieinhalbstündige, pausenlos durchgespielte Werk «Der Kreidekreis» strahlt durchgehend unwiderstehliche Atmosphäre aus und lässt das Publikum an der menschlich ergreifenden Handlung unmittelbar teilnehmen.
MARTIN ETTER
Nicht immer spricht die Nachwelt gültige Urteile: Im Fall der 1933 in Zürich uraufgeführten Zemlinsky-Oper «Der Kreidekreis» auf der Basis der Dramatisierung eines uralten chinesischen Märchenstoffs durch den Asienkenner Klabund darf man sogar davon ausgehen, dass hier ein Meisterwerk der Vergessenheit anheimgefallen ist.
Klabunds Dichtung kreist um das Teehausmädchen Tschang-Haitang, das vom armen Prinzen Pao geliebt und vom reichen Mandarin Ma gekauft wird und dann die Eifersucht der bisherigen Erstfrau Yü-pei herausfordert. Yü-pei vergiftet ihren Mann und versucht, das Kind Tschang-Haitangs als ihr eigenes (und damit als Erben des Ermordeten) auszugeben. Aber der zum Kaiser erwählte Pao greift zum Mittel des Gottesurteils: Das Kind wird in den Kreidekreis gelegt. Die Frau, die das Kind aus dem Kreis zerren kann, ist dann die richtige Mutter; Tschang-Haitang lässt das Kind aber fahren, weil sie es nicht verletzen will. Und Pao erkennt in ihr die wahre Kindesmutter und seine ehemalige Geliebte.
Zemlinskys Musiksprache
Die Klangwelt des Spätromantikers Alexander Zemlinsky erinnert in vielem an Mahler, Strauss und den frühen Schönberg. Sie enthält eine faszinierende Mischung von Dramatik und Lyrik, weiss die Balance aber durch hochsensible Durchdifferenzierung der eingesetzten vokalen und orchestralen Mittel zu erreichen. So pendelt die Partitur situationsgemäss von kammermusikalisch feinen Lyrismen zu hochdramatischen Ausbrüchen und von musikalisch subtil gestützten Sprechpartien zu orgiastischen Aufschwüngen.
Zemlinskys Musiksprache benützt so heftige Gegensätze wie den spätromantischen Sensualismus und den jazzigen Songstil von Kurt Weill entstanden ist ein Meisterwerk, das alte, neue und ganz moderne Ausdruckselemente zur harmonischen Einheit verbindet. Der Grosserfolg der Zürcher Premiere lässt übrigens hoffen, dass Zemlinskys siebente (und vorletzte) Oper den Weg zurück in das Repertoire gefunden hat.
Die Zürcher Wiedergabe
Im staunenswerten Grossausstoss von Zürcher Premieren gibt es naturgemäss Triumphe und Misserfolge. Dieser «Kreidekreis» von Klabund/Zemlinsky gehört zweifellos zu den bedeutendsten Opernhaus-Produktionen der letzten Monate und Jahre.
Der amerikanische Dirigent Alan Gilbert stellt sich als fein differenzierender und gleichzeitig auch klangrauschsüchtig akzentuierender Pultstar vor: ein Neuengagement, das für die Zukunft einiges verspricht. Gilbert scheint sich auch mit dem Orchester vorzüglich zu verstehen am einwandfreien Kontakt zwischen Graben und Bühne fehlte es nicht.
Der Regisseur David Pountney hatte sich von seinem Ausstatter Johan Engels zwei Ebenen herstellen lassen: Vorne sitzen, stehen und spielen die Sprecher, hinten, leicht erhöht, agiert das Sängerensemble. Mit diesem Kunstgriff und mit einer hochprofessionellen Darstellerführung erzielt Pountney bemerkenswerte Klarheit und Übersichtlichkeit das zweieinhalbstündige, pausenlos durchgespielte Werk strahlt durchgehend unwiderstehliche Atmosphäre aus und lässt an der menschlich ergreifenden Handlung unmittelbar teilnehmen.
Sänger und Sprecher
Vorzügliches leistet das Ensemble an seiner Spitze Brigitte Hahn als rührende, intensive und makellos singende Tschang Haitang, Rodney Gilfry als baritonal auftrumpfender Bruder Tschang-Ling, Laszlo Polgar als erst brutal-egozentrischer und dann langsam auftauender Mandarin Ma und (mit einer Meisterleistung) Cornelia Kallisch als geld- und machtgierige Yü-pei. Als Kuppler Tong überzeugt Peter Keller, als Frau Tschang Irène Friedli, als intrigierender Tschao Oliver Widmer und als käufliche Hebamme Katharina Peetz. Francisco Araiza stellt die Reste seiner einstmals weltberühmten Stimme dem Prinzen Pao zur Verfügung und bei den vorzüglichen Sprechern (erwähnenswert Peter Arens, Louise Martini und Bernhard Bettermann) fällt nur Aniko Donath durch einen eklatanten Mangel an Poesie und Verinnerlichung negativ auf.
|

21. 10. 2003
Ein Traum von Gerechtigkeit
70 Jahre nach seiner Uraufführung in Zürich ist Alexander Zemlinskys «Kreidekreis» wieder auf der Opernhausbühne zu erleben: als eines der Meisterwerke seiner Zeit und fesselndes Musiktheater hier und jetzt.
Herbert Büttiker
Sicher vorauszusagen war es nicht, dass die Wiederauferstehung des Stücks auf der Zürcher Bühne, die dem in Deutschland obsolet gewordenen Alexander Zemlinsky 1933 für die Premiere Gastrecht geboten hatte, heute jubelnd begrüsst würde. Denn der Komponist, der in Werken wie der «Florentinischen Tragödie», «Der Zwerg» oder «Kleider machen Leute» auch als Opernkomponist symphonisch schwelgte, ging in den Jahren nach dem ersten Weltkrieg neue Wege. Gesprochene Prosa und Melodram erhielten viel Raum in einer lockereren musikalischen Faktur, in der sich Zeitgemässes bis hin zu Jazz und Kabarett zu einer vielfältig schillernden Musikdramatik fügte, zu einer lakonischeren und spröderen auch. Zarter Lyrismus und expressive Steigerungungen, die in ihrer einfachen Menschlichkeit berühren und Zemlinsky als Komponisten und Persönlichkeit so sympathisch auszeichnen, fehlen allerdings auch hier keineswegs, und der «Kreidekreis» ist dafür ein äusserst dankbares Sujet.
In der zentralen Szene geht es um die Wahrheitsfindung eines Richters, der die beiden um die Rechte an einem Kind streitenden Frauen dazu auffordert, es an sich zu ziehen. In derjenigen, die es zuerst loslässt, um ihm keine Schmerzen zuzufügen, erkennt er die wahre Mutter. Die Geschichte ist alt. Als «Nachdichtung» eines chinesischen Dramas aus dem 13./14. Jahrhundert hat sie Klabund in den zwanziger Jahren unseres Jahrhunderts in Deutschland auf die Bühne gebracht: ein Sensationserfolg, der auch damit zu tun hatte, dass Figuren und Handlung hinter der Maske des Märchens der Gegenwart einen drastischen Spiegel vorhielten und in der scheinbar naiven Dramatik, die das «Lehrstück» à la Brecht vorweg nahm, den Zeitgeist trafen. Dazu gehörte die grelle Satire auf die ungerechten sozialen Verhältnisse und ein korruptes Staatswesen, aber auch die Verklärung der idealen Gegenkräfte von reiner Güte und revolutionärem Aufbegehren, verkörpert von Tschang Huitang beziehungsweise ihrem Bruder Tschang Ling, und dazu gehörte die Sehnsucht nach dem starken Mann beziehungsweise dem weisen Richter, als der hier der zum neuen Kaiser bestimmte Prinz Pao erscheint – wunderbarerweise der wirkliche Vater des Kindes, um das sich der Streit dreht. Märchenhaft schon, aber nicht kompliziert ist die Handlung: Ein gnadenloser Steuervogt (ein Mandarin namens Ma) treibt Tschang in den Selbstmord und ersteigert sich dessen Tochter Huitang, die von der Mutter aus Not an ein Bordell verkauft worden ist, als Zweitfrau. Als sie einen Knaben auf die Welt bringt und sie auch in seinen Gefühlen zur Hauptfrau avanciert, wird er von der bisherigen ersten Gattin Yü-pei vergiftet, und um sich das Erbe zu sichern, klagt sie Huitang nicht nur des Mordes an, sondern behauptet – dank Bestechung mit Erfolg – das Kind gehöre ihr. Richter Tschu-Tschu verurteilt sie zum Tod, aber der Machtwechsel in Peking bringt die glückliche Wendung.
Instrumentaler Reichtum
Dem berührenden Werk galt wohl der vehemente Applaus an der Premiere zunächst, aber ein ausgezeichnetes Team hat dieses auch ins beste Licht gerückt und verdiente dafür die Begeisterung. Dem jungen Dirigenten Alan Gilbert gelang es, mit aller Umsicht und unerbittlichem Zug einen grossen Bogen zu spannen. Darunter war Raum für all die vielen Momente, die zwischen effektvoller Ballung und kammermusikalischem Gespinst den instrumentalen Reichtum von Zemlinskys Musik ausmachen und mit transparent aufgefächertem Klang und geschliffener Rhythmik vom gross besetzten Orchester (angereichert mit Gongs, Saxofon, Gitarre , Banjo) realisiert wurden. Das war imponierend schon für sich genommen ,war aber ein Erlebnis im genauen Bezug zur Bühne. Hier agierte ein Ensemble, das zwar Wünsche offen liess, punkto Textverständlichkeit beispielsweise, aber eben doch ungemein stark war in der charakteristischen Rollenzeichnung.
Dafür hat sich die Inszenierung (David Pountney) einiges einfallen lassen. Verblüffend, und wie sich im Laufe der gut zweistündigen Aufführung immer stärker erweist, äusserst produktiv vor allem dies: die Doppelbesetzung der Partien mit Gesangssolisten und mit Schauspielern. Das geht von kurzen gesprochenen Einwürfen über Dialogpassagen, bei denen die Sprecher auf ihrer Vorbühne sitzen und die Sänger auf der Hauptbühne pantomimisch agieren, bis zum eigentlichen Doppelspiel auf der Bühne. Über die Frage, für welche Sänger es allenfalls auch ein Glück bedeutete, sich nicht mit der Prosa abgeben zu müssen, liesse sich natürlich spekulieren. Auf der Hand liegt aber der Gewinn gerade für dieses Stück. Er betrifft die damit verbundene Abstraktion, die dem stilisierten Spiel des Märchens entgegenkommt, und die Typisierung der Figuren, die in der Doppelbeleuchtung um so stärker hervortritt.
Im doppelten Licht
Das zeigen aufs schönste Peter Arens und László Polgar in der Rolle des Mandarins in der Art, wie die zynische Schärfe der Diktion und der sonore Bass, der vor allem mit Mas Wandlung zum liebenden Mann eindrücklich zum Zug kommt, sich ergänzen. Sein Kabinettstück liefert Arens dann freilich in der Rolle des korrupten Richters, für dessen dreisten Witz Zemlinsky keinen Gesang vorgesehen hat. Mit der prägnanten Auffächerung der Figur der Frau Yü-pei lassen aber auch Cornelia Kallisch und Louise Martini die Vermutung aufkommen, dass die Aufspaltung den Negativfiguren besonders entgegenkommt. Weniger deutlich gilt es auch für Oliver Widmer und Horst Warning, die sich Figur des Gerichtsdieners Tschao teilen.
Sehr im Gesang zentriert – ihre grosse Soloszene im Winterbild, zu frostigen Klängen des Orchesters, im dritten Akt vor der Schlussszene bedeutet die Kulmination der Oper – ist dagegen die Zentralfigur Haitang. Brigitte Hahn gibt ihr mit einem klangschönen, reinen Sopran rührende Innigkeit und Wärme. Dem ist an sich nur wenig beizufügen; wie Anikó Donáths mädchenhafte Sprechstimme ihre Zerbrechlichkeit unerstreicht, fügt dennoch eine wichtige Facette ins Rollenbild. Kaum ausmachen lässt sich eine solche im Falle von Tschang Ling und Pao, die mit dem Bariton Rodney Gilfry (neben Andreas Zimmermann) und Francisco Araiza (neben Bernhard Bettermann) vor allem sängerisch präsent sind und obwohl sie recht monochrom agieren durch ihre Pendants kaum zusätzliche Farbe erhalten. Natürlich ist die Partitur nicht auf die Konkurrenz von Sprechtheater und Oper hin angelegt und die Vorgaben deshalb auch nicht «gerecht». Während Irène Friedli als Frau Tschang neben Louise Martini eher unscheinbar bleiben muss, dürfen sich andere (in beiden Sparten) sozusagen konkurrenzlos entfalten, so etwa Peter Keller in der kleinere Partie des Bordellbesitzers Tong,
Eine skeptische Lesart
Zur Qualität von Pountnys Regie gehört aber gerade auch die Kunst, kleine Auftritte wirkungssicher zu gestalten, und sein Ausstatter (Johan Engels) kommt ihm diesbezüglich mit bühnenbildnerischem Raffinement entgegen. Stellvertretend für vieles andere seien die beiden Kulis erwähnt, die von Yü-pei zu falschen Zeugen aufgebaut werden (James Elliot und Maurizio O'Reilly), wobei die zwielichtige Szene vor und hinter halb offenen Lamellen zum Slapstick wird. Überhaupt lebt die Aufführung nicht zuletzt von einer Lust am szenischen Effekt. Der Bühnenbildner bietet ihn zusammen mit dem Lichtgestalter Jürgen Hoffmann in einer immer wider überraschenden Ästhetik kühler Einfachheit, sozusagen opulent, aber immer im perfekten Kalkül, was die dramaturgische Sinngebung betrifft.
So ist auch der spektakuläre Auftritt des frisch inthronisierten Kaisers im letzten Bild nicht nur ein Coup de théâtre, sondern präzis in der Aussage. Der Polit-Kitsch des goldenen Spruchbandes, auf dem Pao vom Bühnenhimmel herabgelassen wird, ist als solcher auch gemeint. Denn in der skeptischen Lesart der Zürcher Inszenierung hat das Märchen mit dem Tod von Haitang und Ling im Schneesturm ein trostloses Ende. Was folgt, ist ein Traum von Gerechtigkeit. Dass dieser auch gefährlich werden kann, wenn er zur Realität wird und der ersehnte «gerechte Richter» dann wirklich auf der Bildfläche erscheint, hat ja gerade auch Zemlinsky erfahren.
|

21. 10. 2003
Ein Märchen in unseliger Zeit
Beinahe auf den Tag genau 70 Jahre nach ihrer Uraufführung in Zürich kehrte Alexander Zemlinskys Oper «Der Kreidekreis» an das Zürcher Opernhaus zurück.
VON FRITZ SCHAUB
Beim «Kreidekreis» denkt man unwillkürlich an Bertolt Brechts «Der kaukasische Kreidekreis», das zu den stärksten, noch immer - gegenwärtig am Staatstheater Stuttgart - gespielten Werken des grossen Stückeschreibers gehört. Vergessen wird dabei, dass Alexander Zemlinsky (1871-1942) rund zehn Jahre früher dasselbe Stück von Klabund (eigentlich Alfred Henschke, ein früh an Tuberkulose erkrankter, jung verstorbener Autor), das seinerseits auf eine chinesische Vorlage zurückgeht, für eine Oper bearbeitete.
Denn bei der seit den Siebzigerjahren in Gang gekommenen Zemlinsky-Renaissance ist dieser «Kreidekreis» etwas vernachlässigt worden. Vielleicht, weil diese letzte vollendete Oper Zemlinskys (ihr folgte noch die lediglich im Klavierauszug fertig gestellte Oper «König Kandaules») nicht ganz dem Klischee-Bild vom Komponisten zwischen den Stilen, zwischen Mahler und Schönberg, zwischen Spätromantik und Neuer Wiener Schule entspricht? Wäre dem so, müsste man sein Urteil rasch revidieren, denn gerade das vom üppigen, überschwänglichen, dichten Stil des mittleren Zemlinsky Abweichende macht das Herausragende dieses Werks aus, wie jetzt die Zürcher Neuinszenierung zeigt , die sowohl im Musikalischen wie im Szenischen ein hohes Niveau hält.
Die wahre Mutter
Musikalisch mag man auch an Puccini und seine japanische («Madame Butterfly») oder chinesische Oper («Turandot») denken. So wie Puccini die fernöstlichen Rhythmen und Harmonien in seinen von der italienischen Melodik geprägten Belcanto-Stil einverleibte, passte Zemlinsky das chinesische Kolorit dem damaligen Zeitstil an, der unter anderen durch den jungen Hindemith, Krenek, Kurt Weill und die «Neue Sachlichkeit» geprägt war. Dabei herrschen das Lyrische, das aparte Kolorit, die feine Empfindsamkeit vor.
Folgerichtig ist die weibliche Hauptperson Haitang keine ins Hochdramatisch-Opernhafte sich versteigende Figur, sondern eine überaus menschliche Frau, die in einem terroristischen, korrumpierten Regime um ihr Leben und um ihr Kind kämpft. «Ihr Kind» - das ist hier wörtlich gemeint. Denn anders als Brechts Küchenmagd Grusche, die anstatt der leiblichen Mutter von Richter Azdak das Kind zugesprochen erhält, weil sie es bei der «Kreidekreis»-Probe schont, ist Haitang die wirkliche Mutter des Kindes, das ihr aus den gleichen Gründen zuerkannt wird - von jenem neu ernannten Kaiser Pao, der sich als Vater des Kindes entpuppt.
Fragwürdiges Märchen
Ein Märchen, zu schön, um wahr zu sein? Tatsächlich konnte damals, 1933, nur auf der Opernbühne die Gerechtigkeit siegen - denn auf den Strassen hausten bereits die braunen Horden, die schliesslich die Uraufführung der Oper in Deutschland verhinderten, worauf sie nach Zürich vergeben wurde. Zemlinsky wusste um die Fragwürdigkeit dieses märchenhaften Finales und hat gerade deswegen bewusst zu einem affirmativ-hymnischen Finale gegriffen.
Dabei rauscht das sonst so kammermusikalisch, manchmal gar solistisch behandelte und vom Newcomer Alan Gilbert auch entsprechend feinfühlig geleitete Orchester fast das einzige Mal voll auf und Haitang und Pao vereinen sich in einem leidenschaftlichen, von Brigitte Hahn und Francisco Araiza in der Tat schön gesungenen Duett, wie es in der Oper ganz normal ist.
Sänger neben Schauspielern
David Pountney (Inszenierung) und Johan Engels (Ausstattung) haben auf diesen unechten Opernschluss auch szenisch reagiert, indem sie auf ein pompöses Happy End verzichteten: Pao entfernt sich eilig, während Haitang und ihr ebenfalls befreiter Bruder Tschang Ling (Rodney Gilfry mit angenehm timbriertem Bariton) in den Kreidekreis zurückfallen und die vorher mit so märchenhaft-farbigen, einfachen Bildern ausgestattete Bühne in Grautönen versinkt. Aber auch sonst waren die für die Szene Verantwortlichen ganz darum bemüht, dem Opernhaften entgegenzuwirken, und Gesang, Sprache und Spiel wie im epischen Theater nebeneinander herlaufen zu lassen. Als Glücksfall erwies sich dabei, dass den Sängern professionelle Schauspieler beigesellt sind, die meist vorne an der Bühne sitzen und dort die Dialoge sprechen. Aus dem insgesamt vortrefflichen Ensemble ragen neben den bereits Genannten der Bassbariton Laszlo Polgar als durch die Liebe Haitangs völlig verwandelter Ma und sein zynisches, scharf profiliertes Alter Ego (Peter Arens) heraus.
|

21. 10. 2003
Lehrstück mit Musik?
«Der Kreidekreis» von Zemlinsky im Opernhaus Zürich
An Brecht denkt man natürlich, an den «Kaukasischen Kreidekreis». Darum geht es aber nicht, sondern um den «Kreidekreis» von Klabund, wie sich der Autor Alfred Henschke nannte - um ein Erfolgsstück der zwanziger Jahre, das von Schauspielerinnen wie Elisabeth Bergner und Carola Neher zur Sensation gemacht wurde. Der letzten vollendeten Oper von Alexander Zemlinsky liegt dieser «Kreidekreis» zugrunde - der seinerseits auf ein jahrhundertealtes chinesisches Märchen zurückgreift. Ein Stoff, der in der Luft lag, weshalb sich verschiedene Bühnen um die Uraufführung bemüht hatten - doch dann, Anfang 1933, wurde bekanntlich alles anders. So wurde Zemlinskys «Kreidekreis» fast auf den Tag genau vor siebzig Jahren, am 14. Oktober 1933, vom Opernhaus Zürich aus der Taufe gehoben.
Die Assoziation an Brecht liegt aber keineswegs daneben. In der neuen Produktion des Opernhauses Zürich stellt sich Zemlinskys «Kreidekreis» nämlich ganz klar als Lehrstück vor. Nicht das Drama um die unglückliche Haitang, die in die Fänge des tückischen Steuereintreibers Ma, seiner noch viel verruchteren Gattin Yü-Pei und des bestechlichen Richters Tschu-Tschu gerät, am Ende aber dank der Weisheit des Prinzen Pao zu ihrem Recht kommt - nicht diese Geschichte wird erzählt. Es wird vielmehr etwas demonstriert und durchgeführt, nämlich die hochmoralische Fabel vom Sieg der Gerechtigkeit über die menschliche Niedertracht. So ist denn auch wohl gut die Hälfte der Vorlage als gesprochener Text mit Musik gestaltet - und es ist dieser Ansatz, den der Regisseur David Pountney ebenso konsequent wie einsichtig weitergedacht hat. Die Mehrzahl der Rollen ist nämlich doppelt besetzt: mit Sängern und Schauspielerinnen, was nicht nur der Verständlichkeit dient, sondern auch die Künstlichkeit der Anlage unterstreicht. Denn auch die Musik von Zemlinsky gibt sich nicht identifizierend dem Geschehen hin; mit dem Silberstift gezeichnet, hält sie sich vielmehr auf Distanz, spielt sie raffiniert mit dem chinesischen Lokalkolorit wie mit Anklängen an die verschiedensten Strömungen ihrer Entstehungszeit, ohne dass sie darob ihre Persönlichkeit aufgäbe.
Wer sich auf diese Konstellation einlässt, kann an diesem zweistündigen, ohne Pause durchgespielten Abend manchen treffenden Theatermoment erleben. Gepflegt und profiliert die Sprechkunst: von Peters Arens, der den beiden Bösewichten Ma und Tschu-Tschu lustvoll zynisches Profil verleiht, von Louise Martini, welche die Schlechtigkeit der Yü-Pei krass herausstellt, wie von der jungen Anikó Donath (Haitang), deren helle Stimme in reizvollen Kontrast zum getragenen Pathos des melodramatischen Sprechens gerät - aber auch von Horst Warning, Bernhard Bettermann und Andreas Zimmermann. Sorgsam und zurückhaltend die szenische Einrichtung, zu welcher der Ausstatter Johan Engels berückende Räume (etwa in der Gartenszene des zweiten Akts) und wirkungsvolle Farbkontraste (etwa jener zwischen Schwarz und Rot im sogenannten Teehaus des Eunuchen Tong) beigesteuert hat. David Pountney wiederum hält sein doch eher der kräftigen Zeichnung zuneigendes Temperament diesmal im Zaum; er zeigt die Fabel als Fabel, in artifizieller, stilisierter und so der Identifikation entgegenwirkender Personenführung, nicht ohne dann und wann entschieden theatralische Akzente zu setzen. Was an der Premiere mit rauschendem Beifall aufgenommen wurde.
Allein, musikalisch ist die Produktion bestenfalls zweite Kategorie. Die Probleme beginnen bei der Sopranistin Brigitte Hahn, die andernorts als Königin der Nacht, als Lucia oder Mimì brilliert haben soll. Wie war das nur möglich? In der Partie der jungen, unglücklichen Haitang wirkt sie fehlbesetzt; ihrer nicht unschönen, runden, für diese Rolle aber zu weichen Stimme fehlen die Kontur, die Ausstrahlung, die Kraft - und Kraft braucht es hier aller Feinzeichnung zum Trotz. Der Dirigent Alan Gilbert muss demzufolge alles, was aus dem Graben kommt, massiv zurückbinden, was an der Premiere dazu führte, dass das Orchester der Oper Zürich technisch unter seinem Niveau spielte und die Partitur insgesamt unterbelichtet blieb: gedämpft in den Farben, unausgeglichen im Gesamtklang, ohne jeden Atem - wo diese Musik doch so unheimlich ziehen kann. Für die Rolle des jungen, edlen und fruchtbringend wirkenden Prinzen Pao wurde Francisco Araiza wieder einmal auf die Bühne gebeten; er meistert seine Aufgaben mit Technik und Geschmack, kämpft aber hörbar mit dem Sitz seiner Stimme. Eindrücklich dagegen László Polgár, der an der Rolle des Steuereintreibers Ma die Bekehrung zum Guten besonders glaubhaft macht, und Cornelia Kallisch, eine Yü-Pei von herrlich theatralischer Bösartigkeit. Zuverlässig auch das stark besetzte Ensemble, das diese Oper verlangt.
Ehrlich währt am längsten, und am Ende siegt die Wahrheit - das versucht «Der Kreidekreis» zu lehren. An zwei Stellen relativiert der Regisseur mit einem kleinen Zeichen die These des Stücks, und das zu Recht. Zemlinsky, der sich mit dieser Oper dem Idealisten Klabund anschloss, hat sein Leben als der ewige Zweite und oft genug als Verlierer verbracht; wenige Jahre nach der erfolgreichen Zürcher Uraufführung des «Kreidekreises» kam er im amerikanischen Exil an, wo er bald darauf verstarb. «Der Kreidekreis» somit nicht nur als Lehrstück, sondern auch als Ausdruck einer Utopie - davon zeugt machtvoll die Musik, die sich, so viel Raffinement ihr auch innewohnt, doch immer wieder zu gewaltiger Sehnsucht aufschwingt. Die Zürcher Produktion lässt das nirgends hören, diese Chance wurde vertan. Aber immerhin wird hier einem selten gespielten Werk, das in diesem Haus ans Licht gehoben wurde, die gebührende Reverenz erwiesen.
Peter Hagmann
top
|

21. 10. 2003
Wachgeküsst nach 70 Jahren
Überraschende und hochkarätige Wiederentdeckung: «Der Kreidekreis» von Alexander Zemlinsky am Opernhaus Zürich
Langer und ungeteilter Jubel am Sonntagabend im Opernhaus Zürich. Sowohl musikalisch wie inszenatorisch überzeugend, erweist sich Zemlinskys «Kreidekreis» als eine lohnende Ausgrabung.
Tobias Gerosa
Alexander Zemlinskys Oper «Der Kreidekreis» wurde 1933 (15 Jahre vor Brechts «Kaukasischem Kreidekreis») am damaligen Stadttheater Zürich uraufgeführt und bezog seine Inspiration vom gleichnamigen Märchenspiel Klabunds. Durch die Inszenierung des Bregenzer Intendanten David Pountney ist Brecht im Opernhaus nun aber doch präsent. Pountney verzichtet diesmal (fast) ganz auf die für ihn so typische Monumentalität und setzt auf eine reduzierte, vielschichtige und verfremdende Umsetzung. Mit Erfolg.
Die Parabel um den Richter, der das Kind der Frau zuspricht, die es nicht aus dem Kreidekreis zu reissen versucht, ist zeitlos. Pountney und sein Ausstatter Johan Engels lassen sowohl Asiatisches wie Elemente aus der Entstehungszeit einfliessen. Eine schwarze Blechwand verdeckt die Bühne. Wenn Türen aufgehen oder wenn sie sich hebt, gibt sie den Blick frei auf den leeren, nur mit Farben gestalteten Bühnenraum. Einzig der Schluss ist mit dem vom Himmel schwebenden Goldbogen etwas dick aufgetragen. Als Todesfanatsie Haitengs, die schon im Bild zuvor umgebracht wurde, ist er aber dramaturgisch völlig schlüssig.
Von Wagner zu Weill
Was zuerst auffällt, sind sechs Schauspieler, die vor der Blechwand Platz nehmen. Sie werden ihre Sitze kaum verlassen, doch von den hinter ihnen agierenden Sängern ins Spiel einbezogen - ein Verfremdungseffekt, der aufnimmt, was Zemlinsky in seiner eigenartigen Mischung von gesprochenen Teilen Melodram und Gesang schon einkomponiert hat.
Es ist überhaupt eine ganz eigene Musik. Nicht nur chinesische Töne werden angeschlagen, der erste Akt wird mit einer jazzigen Saxofon-Kantilene eröffnet und Anklänge an den Song-Stil der Zeit sind nicht zu überhören (Zemlinsky dirigierte in Berlin Weill). In den beiden grossen Duetten von Haiteng und Pao schwingt sich die Musik gewaltig auf. Und immer wieder meint man, Weiterführungen harmonischer Wendungen Wagners oder Mahlers zu hören. Das Erstaunlichste dabei: Es verbindet sich zu einem spannenden, schlüssigen Ganzen. Einmal mehr ist zu bedauern, dass diese Entwicklung der musikalischen Moderne nach der Naziherrschaft, die diese Komponisten verfolgte, nicht wieder aufgenommen wurde.
Geschlossenes Ensemble
Eine schwierige Aufgabe für den Dirigenten ist es bei dieser Musik, den grossen Bogen zu erhalten. Dem jungen amerikanischen Opernhaus-Debütanten Alan Gilbert und dem Opernhausorchester gelingt das hervorragend. Sie halten den Klang trotz grosser Besetzung stets so durchsichtig, dass die Sängerinnen und Sänger den Text ohne zu forcieren verständlich über die Rampe bringen. Brigitte Hahn als Haiteng gelingt ein durch ihre gespannte Ruhe beeindruckendes Rollenportrait. In Cornelia Kallischs Frau Ma hat sie einen starken Gegenpart. Von den Männern kann da nur Laszlo Polgar als Herr Ma mithalten.
Die Besetzung verzeichnet keine ganz grossen Namen, überzeugt aber durch ihre Geschlossenheit. Zusammen mit der offensichtlich grösseren Gewichtung der Regie scheint sich am Opernhaus leise ein Stilwechsel anzudeuten.
|
|
Radikallösung für den «Kreidekreis»
Genau 70 Jahre nach ihrer Uraufführung in Zürich wurde am Sonntag Zemlinskys Oper «Der Kreidekreis» im Zürcher Opernhaus wieder auf die Bühne gebracht. Ein zu Unrecht vernachlässigtes Stück.
Von Reinmar Wagner
Es kann und darf ja nicht sein: Das Happy End, das wir kennen, schon von Salomon oder von Brecht aus dem «kaukasischen Kreidekreis». Sie ist dann doch zu schön, um wahr zu sein, die Geschichte von den zwei Müttern, die vor Gericht um ein Kind streiten: Sie sollen es gegeneinander aus einem Kreis zerren, und der weise Richter weiss: Nicht diejenige, die am meisten Kraft aufwendet, sondern diejenige, die aus Mutterliebe loslässt, um ihr Kind nicht zu verletzen, ist die wahre Mutter.
Plausible Charakteristika
Der deutsche Dichter Klabund in seinem 1925 entstandenen Märchenspiel und - auf ihm basierend - Zemlinsky glaubten noch an diese Form von richterlicher Gerechtigkeit. Der englische Regie-Grossmeister David Pountney sieht es heute in seiner bekannten Skepsis gegenüber jeglicher Form Autorität ein wenig anders: Haitang und ihr Bruder werden auf dem Weg zum zweiten Prozess, der ihnen Gerechtigkeit bringen soll, von ihren betrunkenen Wachsoldaten erschossen. Das Finale voll Genugtuung erleben sie erst in einer anderen Welt oder sogar bloss in jenen berühmten Sekundenbruchteilen zwischen Sterben und Tod.
Dass Pountney das allzu schön gedachte Gleichnis nicht beim Nennwert nehmen würde, war von ihm zu erwarten. Ebenfalls zu erwarten war, dass er es wiederum schaffen würde, seinen Figuren plausible, individuell passende Charakteristika überzustülpen, die immer wieder auch mit schwarzem Humor gezeichnet sein können.
Gelungenes Bühnenbild
Zemlinskys Partitur verlangt über weite Strecken gesprochene Dialoge von den Sängern, ein bekanntes Problem im heutigen Opernbetrieb, wo die deutschen Konsonantenhäufungen manchen fremdsprachigen Sänger zum Wahnsinn treiben. Pountney wählte die Radikallösung: Schauspieler.
Aber er ging nicht hin und liess sie zusammen mit den Sängern auf der Bühne agieren, sondern platzierte sie zuvorderst in Johan Engels atmosphärisch gelungenem Bühnenbild, in ihre eigene Kabäuschen. Eine Verfremdung, welche der Inszenierung wiederum gut tat, weil sie die Handlung ins Symbol- und Gleichnishafte verlegte. Jeweils wenige Gesten, Blicke und Requisiten reichten Pountney aus, um eindeutige Zuordnungen zwischen Sängern und Schauspielern zu erreichen: Eine mustergültige Lösung.
Dramaturgisch durchdacht
Zemlinskys «Kreidekreis» ist eine bühnenwirksame, dramatische Oper mit viel exotischem China-Kolorit. Die spannende, abwechslungsreiche Partitur ist gefüllt mit exotischen musikalischen Anspielungen, mit jazzigen Tanzrhythmen, gefüllt - und das ist Zemlinskys bekannte Stärke - mit spätromantisch expressiv aufgeladenen lyrischen und gefühlvoll intensiven Momenten.
Diese Stärken könnten auch eine Schwäche sein: Mehr als Zemlinskys frühere Opern ist «Der Kreidekreis» eine Collage, ein Sammelsurium an Stilen und Ausdrucksbereichen, ein Wechselbad, das Pountney noch durch seine Trennung in Schauspieler und Sänger verstärkte.
Aber ganz abgesehen davon, dass es eine gekonnte, handwerklich geschickte und dramaturgisch durchdachte Collage ist, stand da auch noch ein Dirigent am Pult des Zürcher Opernorchesters, der sich für weitere Aufgaben wärmstens empfohlen hat.
Agil und präzis
Der Amerikaner Alan Gilbert dirigierte zum ersten Mal hier und gab eine Visitenkarte ab, die in den schönsten Farben schillert: Zuerst einmal hatte er sämtliche Tempi und Ausdrucksbereiche souverän im Griff, ohne sich je von den Schwierigkeiten der Partitur aus der Ruhe bringen zu lassen.
Aber Gilbert schaffte noch einiges mehr: Sein Flair für die spezifischen Klangfarben der völlig verschiedenen Ausdrucksbereiche der Partitur erwies sich als so zielsicher, seine Fähigkeiten, zwischen diesen Klangbereichen zu wechseln als so agil und präzis, dass aus der Collage ein wirklich bruchloses Stück wurde, das durch die ständigen Wechsel zudem unheimlich an Stringenz und innerem Tempo gewann.
Neben Gilbert die zweite Entdeckung dieses spannenden Zürcher Opernabends war Brigitte Hahn mit einem farbenreichen, intensiven Sopran in der weiblichen Hauptrolle. Das gesamte Ensemble kam ohne heftige Aussetzer über die Runden, sogar Francisco Araiza erwies sich in der Rolle des Kaisers als erstaunlich vielseitig in seinen gestalterischen Möglichkeiten, bloss zu viel Lautstärke hervorbringen zu wollen, war jeweils der Tod seiner Stimme. Besonders aufgefallen sind ausserdem Cornelia Kallisch, Lászlê Polgár, Katharina Peetz sowie der Schauspieler Peter Arens als korrupter Richter Tschu-Tschu.
|

21. 10. 2003
Wellness-Musik auf höchstem Niveau
Alexander von Zemlinskys «Der Kreidekreis» wird am Zürcher Opernhaus
als musikalisch-optischer Genuss zelebriert.
Von Michael Eidenbenz
Vielleicht wäre ja eine politische Deutung denkbar gewesen. Immerhin geht es um Machtmissbrauch, um sexuelle Ausbeutung, um Korruption, um soziales Elend. Immerhin auch hat Alexander von Zemlinsky sich um einige jener Elemente bemüht, aus denen Brecht später seine Theorie des epischen Theaters zu konstruieren versuchen sollte: In seiner siebten Oper gibt es V(erfremdungs)-Effekte, es gibt das Spiel mit Versatzstücken der Theatergeschichte wie dem Deus ex Machina, es gibt eigentliche Songs, die Figuren stellen sich und ihre Funktion beim ersten Auftritt selber vor, und Sprech- und Gesangspassagen halten sich ungefähr die Waage. Und immerhin war die Uraufführung einst im Schicksalsjahr 1933 erfolgt, am Zürcher Stadttheater notabene.
Märchen statt Lehrstück
Wenn sich das Zürcher Opernhaus nun exakt siebzig Jahre später Zemlinskys erfolgreichstes Werk zum zweiten Mal vornimmt, so siegen Ästhetik und leise verspielte Ironie über die Versuchung zu aktueller politisch-sozialer Konkretisierung. Dieses China, in dem die arme Tschang Haitang zuerst ins Bordell verschachert und dort von jenem Mandarin gekauft wird, der einst ihren eigenen Vater in den Tod getrieben hatte, darauf ungerecht wegen Gattenmord und angeblich falscher Mutterschaft verurteilt wird, ehe der Kaiser mit salomonischem Urteil die Gerechtigkeit wiederherstellt -, dieses China mit seinen fast schon lehrstückhaften typisierten Gestalten bleibt in dieser Produktion ein märchenartiger Gemeinplatz.
Und das ist wohl auch gut so. Denn erstens sind die angesprochenen kritischen Themen mittlerweile auf der Bühne ausgepresst, und zweitens bleibt die Situierung im abstrahierend Märchenhaften zumindest werktreu. Schon Klabund, der mit seinem gleichnamigen Erfolgsstück für Brecht («Der kaukasische Kreidekreis») wie für Zemlinsky den Stoff lieferte, hatte vor allem taoistische Gelassenheit im Sinn. Und Alexander von Zemlinsky mag zwar den Anschluss an die zu seiner Zeit moderne Zeitoper gesucht haben, dominierend bleibt in seiner Musik aber trotzdem das sensible unaufhörliche Strömen und Changieren, die sozusagen bis in die äussersten Kapillaren des Gefühlskreislaufs subtil-raffinierte Nuance, die Umarmung allen Erlebens durch eine spätestromantische Klanglichkeit, die sich jederzeit jeder Form anschmiegen kann. Da klingt selbst ein Soldatenlied noch behutsam, da singt lyrisch das Saxofon als notorisch erotisches Instrument, da werden auch pentatonische Chinoiserien selbstverständlich eingebunden in das harmonisch aufgelöste sensible Fliessen. Und allen Figuren, auch inhaltlich bösartigsten, wird musikalisch die Chance zum Mitgefühl gegeben.
Wundersame Mischklänge
Nein, kritischen Biss sollte man hier nicht erwarten. Vielmehr dürfte dieser Sound, der keine Sekunde lang billig, sondern immer von höchster Gekonntheit und Noblesse ist, einer Gegenwart entgegenkommen, die der frontalen Leidenschaft das ambivalente Feinstoffliche immer mehr vorzuziehen scheint. Erich Wolfgang Korngolds «Die tote Stadt» hat in der letzten Saison die Spur gelegt, das Zemlinsky-Revival der letzten Jahre, dem sich das Opernhaus nun anschliesst, bestätigt die Beobachtung. Wellness-Musik auf höchstem Niveau.
Alan Gilbert trägt als Dirigent die Verantwortung für die Nuancierung. Und er tut es bei seinem Zürcher Operndebüt mit allem gebührenden Sinn für die abgestufte dynamische und emotionale Temperatur. Wundersam, was da an Feinheiten und abgewogenen Mischklängen aus dem Orchestergraben erklingt.
Auf der Bühne dagegen hat man sich für Grossflächigkeit und Stilisierung entschieden. Schlichte Formen und einfache, symbolisch gedachte Grundfarben prägen Johan Engels Bühnenbild und Jürgen Hoffmanns Lichtgestaltung und sind ebenso aussagekräftig wie schön anzusehen. Und Regisseur David Pountney hat - so nahe liegend wie verblüffend einleuchtend - die Einladung zum V-Effekt mit Ideen des Kabuki-Theaters kurzgeschlossen und die Figuren mit Schauspielern und Sängern doppelt besetzt.
Sänger spielen nach
Mit Ausnahme von Peter Keller, der über genügend Darsteller- und Sängertalent verfügt, um den schmierigen Bordellbesitzer Tong allein zu verkörpern, haben die Sänger während der ausführlichen melodramatischen Sprechpassagen auf der Bühne also mit behutsam stilisierter Gestik pantomimisch nachzuspielen, was von Schauspielern vor der Rampe gesprochen wird. Anikó Donáth, Louise Martini, Andreas Zimmermann, Bernhard Bettermann, Horst Warning und allen voran Peter Arens, der ein Kabinettstückchen als korrupter Richter Tschu-Tschu liefert, wirken dabei so überzeugend, dass für einmal im Opernhaus die Schauspielerei dem Gesang mindestens ebenbürtig ist.
Denn sängerisch sind die Rollen nicht durchweg optimal besetzt. Brigitte Hahn findet zwar innigste lyrische Töne als Tschang Haitang und mag mit ihrer Stimme von beschränkter dramatischer Durchschlagskraft dem Rollenbild des ewigen Opfers entsprechen. Doch zumal in der Tiefe fehlt ihr jene kräftige Farbe, die Zemlinskys Gesangslinien verlangen. Jene Farbe, die Cornelia Kallisch als kinderlose eifersüchtige Gegenspielerin Yü-Pei mit schönstem Metall in der Stimme und berückender Intensität bietet.
Auch László Polgár überzeugt mit warmem Strömen als Macho-Egomane Ma, dem durch Zemlinskys Musik letztlich doch wieder etliche Gefühlsechtheit zugedacht wird. Desgleichen gelingt Oliver Widmer als Hofintrigant Tschao und Irène Friedli als verarmter Witwe. Rodney Gilfrey jedoch wirkt als revolutionärer Tschang Ling stimmlich eigenartig temperamentlos. Und Francisco Araiza schliesslich kann nur selten das Gold seines Tenors zeigen und bleibt blass als Kaiser Pao.
Auf goldenem Band schwebt dieser zuletzt als wahrer Deus ex Machina vom Bühnenhimmel, klärt wie einst Salomo den Mütterstreit um das Kind, gibt sich gar als dessen Vater zu erkennen. Dieses Traumende wollte David Pountney denn doch nicht unbefragt stehen lassen: Die letzten Sekunden erweisen es als irrealen Traum - das reale Weltenelend bleibt schliesslich doch die letzte Wahrheit.
|

21. 10. 2003
Die magische Kraft der leisen Töne
Im Opernhaus Zürich feiert «Der Kreidekreis» von Alexander Zemlinsky Premiere
Das war ein Abend! Im Opernhaus Zürich hatte am Sonntag mit Alexander Zemlinskys Oper «Der Kreidekreis» eine in jeder Hinsicht gelungene Produktion Premiere. Die überraschend transparente, von raffinierten Farben und stringenter Leitthematik getragene Musik wurde vom jungen amerikanischen Dirigenten Alan Gilbert vielschichtig und spannend ausgedeutet. Und Regisseur David Pountney hat die heikle Balance zwischen Melodram und Oper mit präziser Personenführung und viel sagenden schlichten Bildern optimal getroffen. So gab es nach zweieinhalb Stunden ohne Unterbruch langen und einhellig begeisterten Applaus.
Motiv lag im Trend
Das Motiv des «Kreidekreises» lag damals, vor gut 70 Jahren, in der Luft. Bertolt Brecht hat darüber seinen «Kaukasischen Kreidekreis» gedichtet, das chinesische Symbol aber war vom orientalisch begeisterten Dichter Klabund aufgegriffen worden. Alexander Zemlinsky, der sich für seine Oper auf Klabunds Dichtung stützte, war ein gefeierter Operndirigent am Neuen Deutschen Theater in Prag, hat aber als Opernkomponist nie nachhaltigen Erfolg gehabt. In diesem Spätwerk jedoch zeigt er sich als Meister kammermusikalischer Dichte und dramaturgischer Stringenz und weiss die heikle Mischform von Melodram und Oper überzeugend durchzugestalten.
Die Geschichte handelt vom Elend einer chinesischen Familie Tschang, deren Vater sich wegen der harten Steuereinforderungen des Herrn Ma umbringt. Das nötigt die verarmte Mutter, ihre sechzehnjährige Tochter Haitang an ein «gehobenes» Freudenhaus und damit an einen Kuppler zu verkaufen. Hier wird sie zuerst vom Prinzen Pao zum «Spiel» aufgefordert, dann aber muss sie dem gewalttätigen Ma folgen, der einen hohen Preis für die Unberührte bezahlt. Dessen Hauptfrau Yü-pei aber wird aus Eifersucht und Habgier zur Mörderin und schiebt die Schuld am Giftmord an ihrem Mann öffentlich der Nebenfrau in die Schuhe. Diese wird zum Tode verurteilt, doch zum Schluss wird alles gut.
Traumhafte Utopie
Es ist eben dieser überhöhte Gerechtigkeitsschluss, dem Pountney mit einem brillanten Regieeinfall das allzu Pathetische nimmt. Die Szene vor dem gerechten Kaiser wird zur traumhaften Utopie der zu Unrecht Verurteilten. Pountney lässt diese nämlich im Marsch durch den Winter zusammenbrechen; sie kommen gar nie beim Kaiser an. Am Schluss liegen die Gefangenen wieder dort, wo der Traum von der Gerechtigkeit begonnen hat: zusammengebrochen in der Winterlandschaft.
Das Schwierige an Zemlinskys Oper ist, dass so viel gesprochen wird. Deshalb entschied man sich in Zürich, die jeweiligen Rollen je mit einem Sänger und einem Schauspieler zu besetzen. Das hat zur Folge, dass sich die Sängerin auf der Bühne befindet, während «ihre» Schauspielerin für sie spricht. Pountney löst diese Trennung zwischen Melodram und Oper jedoch mit fliessendem Übergang. Die Schauspielerinnen und Schauspieler sitzen vorne am Bühnenrand, aber unterhalb der Spielebene. Sie haben je eine kleine Box und einen Stuhl für sich. Immer wieder aber blicken sie auf die Bühne und nehmen mit «ihrer» Figur Sichtkontakt auf, die Grenze wird so «überspielt».
Doppelbesetzungen
Das geht aber nur gut, wenn sich die Sänger entsprechend «schauspielerisch» bewegen. Zum Beispiel die Auftrittszene von Cornelia Kallisch als eifersüchtige Yü-pei, in welcher sie mit der für sie sprechenden Louise Martini sich selber vorstellt: Kallisch tritt mit knallrotem Kleid vor die grauschwarze Wand, und sie bewegt sich zum Rhythmus der Musik fast schon surreal und mit überzeugender herrischer Spannkraft im Körper - eine eindrückliche Szene. Der einzige der Sänger, der auf der Bühne selber spricht, ist Peter Keller als Kuppler Tong. Zuerst erkennt man ihn kaum, denn er spricht die ganze Zeit auf die Mutter und ihre Tochter ein, und er tut das mit unerhörter Diktion. Und plötzlich beginnt er zu singen, mit seiner so typischen, nasalen Stimme - ein unvergesslicher Moment.
Eine lyrische Wandlung
Das wohl interessanteste Paar ist Lászó Polgár zusammen mit Peter Arens in der Rolle des Ma. Sie passen ausgezeichnet zusammen, beiden gelingt der Wechsel vom rücksichtslosen Egoisten zum über die Liebe von und zu Haitang weich gewordenen alten Mann mit lyrischem Tiefgang. Stark ist auch der kurze prägnante Auftritt von Irène Friedli und Louise Zimmermann als verzweifelte und doch geldgierige Mutter, während Rodney Gilfrey und Andreas Zimmermann den aufbrausenden, revolutionär denkenden Bruder Ling mit der nötigen Haltlosigkeit des Hasses glaubhaft porträtieren.
Das alles spielt sich in einem relativ schlichten Raum ab, dem der grosszügige Mosaik-Boden das Gepräge gibt. Auf ihm leuchtet jeweils der «Kreidekreis» auf, wenn von ihm die Rede ist. Der milde Frühling der Liebe spielt sich in einem Garten mit grünen Bambusstangen ab, die später dann in der Winterszene weiss und tief verschneit sind. Da diese schlichten Stimmungen von Jürgen Hoffmann sehr schön und mit subtilen Nuancen geleuchtet werden, haben diese Bilder eine magische Wirkung.
Machtgekreisch und Liebeslaute
In dieser ästhetisch abstrahierten Szenerie entfalten sich die Sänger und die Musik farbig und mit rhythmischer Kraft. Da stehen sprechrhythmische Songs à la Kurt Weill neben dunklen weitatmigen Kantilenen. Da prallen Macht-Gekreisch und die leisen Töne der Liebe aufeinander, Saxofon und Schlagzeug kommen genauso vor wie die Mandoline.
Diese stilistische Vielfalt weiss Zemlinsky mit dichter thematischer Arbeit und stringenter Leitmotiv-Technik zu verbinden, was der Dirigent Alan Gilbert mit den Zürcher Orchestermusikern auch genau so umsetzt. Nichts wurde übertrieben oder ausgeschlachtet, das Spiel der Farben diente dem Inhalt ebenso wie die vielen Wechsel im Rhythmischen.
Dies war der musikalische Boden, welcher auch der in Zürich debütierenden deutschen Sängerin Brigitte Hahn in der Hauptrolle der Haitang enorme Entfaltungsmöglichkeiten gab. Auch wenn sie anfangs als eingeschüchtertes Mädchen etwas gar deutschstämmig und körperfüllig wirkte, sie vermochte in dieser physisch sehr anstrengenden Partie die Kraft der leisen Töne mit glaubhafter Tragfähigkeit zu verkörpern. Schade nur, dass ihre Schauspiel-Partnerin Anikê Donáth beim Sprechen etwas zu manieriert dem Rhythmus der Musik folgte und damit die Natürlichkeit verspielte, die ihre Kollegen so bravourös ausspielten.
Sibylle Ehrismann
|
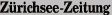
21. 10. 2003
Doppelbödiges Musiktheater
70 Jahre nach der Zürcher Uraufführung erstmals wieder in Zürich: «Der Kreidekreis» von Alexander Zemlinsky
Die Zemlinksy-Renaissance, die in der Musikwelt seit Ende der siebziger Jahre zögerlich Fuss zu fassen begann, ist bislang in Zürich nicht vorstellig geworden. Das aber dürfte sich mit einem Schlag nun ändern: dank David Pountneys wegweisender Neuinszenierung des «Kreidekreises».
WERNER PFISTER
Die Pressereaktionen auf die Uraufführung vor genau 70 Jahren fielen moderat aus, eher freundlich als wirklich begeistert. Wenn das Publikum ein verlässlicher Gradmesser ist, dürfte es diesmal anders sein: Wie Platzregen und Hagelsturm peitschte der Schlussapplaus nach der pausenlosen Premiere nieder, kollektive Erlösung aus lustvoll Gestautem, wohl zehn frenetische Minuten lang. Hat nun auch Zürich Zemlinsky entdeckt?
Dem «Kreidekreis», Zemlinskys später Oper, sind nüchterne Züge einer Spätzeit eingegraben, und zugleich herrscht atmosphärischer Luxus. Die Musik nimmt Bezug auf alles und jedes, was die damalige Zeit so im Angebot hatte: den Spätstil Gustav Mahlers, die schillernde Ornamentik des frühen Schönberg, dazu Kurt Weills «Dreigroschen»-Songstil samt Seitenblicken in Richtung Jazz in Kabarett. Zudem, da «Der Kreidekreis» in China spielt, wird das auch in der Musik nicht verleugnet: mit Pentatonik, mit modalen Wendungen und «chinesischem» Instrumentalkolorit.
Anführungszeichen
Die Anführungszeichen stehen hier durchaus zu Recht, denn mit China, dem historischen China, hat das kaum etwas zu tun. Bereits die Dichtung von Klabund, die dem Opernlibretto zugrunde liegt, gestaltet das Chinesische aus der Perspektive des Bildungseuropäers: so, wie man sich als deutscher Dichter China vorstellt, exotisch nämlich. Darauf nimmt die Zürcher Inszenierung subtil Bezug. Johan Engels, für die gesamte Ausstattung zuständig, zitiert Chinesisches ebenfalls in Anführungszeichen, nämlich als unaufdringliche Chiffre in Kostüm und Bühnenbild.
Dieses besteht aus einem einzigen, grossen Raum, mit Spiegelwänden eingegrenzt, mit Lamellenvorhängen vor unbotmässigen Einblicken geschützt und gleichzeitig zu diskreten Durchblicken animierend. Denn zumindest der erste Akt spielt im Bordell, und die Damen wollen begutachtet sein. Im zweiten Akt, im herrschaftlichen Haus von Ma, geht es um Intrigen und Ränkespiele mit entsprechend hinterhältigen Beobachterblicken durch fast verschlossene Vorhänge und letztlich einen Meuchelmord: Gift statt Zucker im Tee (wobei die Chinesen ihren Tee ohne Zucker zu trinken pflegen ... ). Im dritten Akt dann die repräsentative Räumlichkeit eines Gerichts sowie, zum Schluss, der blendend lichterfüllte Thronsaal des Kaisers von China - wahrhaft ein Sonnenkaiser, denn er sitzt auf der Sonne.
Episches Theater
Das Spiel, das in solchen fast symbolischen Räumen inszeniert wird, ist im eigentlichen Wortsinn doppelbödig. Denn im Bühnenvordergrund, auf einer unteren Spielebene, sind sechs Stühle für sechs Schauspielerinnen und Schauspieler aufgestellt. Sie sprechen (und spielen) das, was in Zemlinskys Oper gesprochen wird. Und das ist viel: reines Wort, Rezitativ, Melodram. Zu viel - nach Einschätzung des Regisseurs -, als dass die Sängerinnen und Sänger das alles selber zu sprechen vermöchten. Also mimen sie, wenn sie auf der hohen Opernbühne nicht selber singend zu agieren haben, stumm, aber gestisch durchaus beredt, was unten schauspielerisch verhandelt wird.
Diese Doppelbödigkeit bewirkt Distanz. Statt mit purem Illusionstheater haben wir es mit Verfremdung zu tun - mit epischem Theater also, und das gut zwölf Jahre, bevor Brecht selber mit seinem «Kaukasischen Kreidekreis» das epische Theater für sich entdeckte und es dann flugs als seine eigene Erfindung in die Theatergeschichte einschreiben liess. Dieses Verfremdungsmoment ist nun aber nicht einfach willkürliche Zutat des Regisseurs, sondern ist dem Werk - bereits dem Text von Klabund - inhärent. Personen, die auftreten, schlüpfen zuerst mal aus ihrer Rolle heraus, stellen sich vor, erklären, was sie hier so ungefähr zu schaffen haben, schlüpfen dann wieder in ihre Rolle, und der Zuschauer kann das Spiel nun gleichsam aus denkerischer Distanz begutachten, auf moralische Implikationen überprüfen und beurteilen.
Überhöhung
Genau das macht diesen Opernabend so spannend. Und spannend ist es, weil alles wie am Schnürchen läuft. David Pountney gelingt das grosse Kunststück, Schauspieler und Sänger, Sprechtheater und Oper nahtlos ineinander zu überführen. Einerseits als reine Verdoppelung der Figuren (und der Spielebenen), andererseits als Überhöhung des Spiels in ein exemplifizierend Symbolisches. Behutsam führt Jürgen Hoffmanns Lichtregie den Zuschauer zu den einzelnen Handlungsplätzen, den jeweiligen Zentren emotionaler Auseinandersetzung.
Und die Mitwirkenden sind alle sehr intensiv bei der Sache - auch wenn sie sich nicht alle gleichermassen eindringlich zu profilieren verstehen. Nicht zuletzt ist mit der jeweiligen Doppelfigur ja stets eine allernächste, ja allerpersönlichste Konkurrenz gegeben. Einigermassen blass bleibt Brigitte Hahn in der Hauptrolle der Haitang, stimmlich zwar sehr sauber, aber gleichzeitig auch begrenzt und emotional manchmal wie ausserhalb ihrer Rolle stehend. Ziemlich unzulänglich ihr schauspielerisches Pendant Anikó Donáth: Da fehlt es denn doch an fundierter (Sprech-)Stimme, sodass die Diktion, wenn sich Erregung breit macht, am Explodieren ist und unverständlich wird.
Souverän hingegen Cornelia Kallisch und Louise Martini in der Rolle von Yü-pei - wobei die Sängerin mit einer schauspielerisch gekonnt geformten Charakterstudie aufwartet und die Schauspielerin allein mit einem feinen Augenzwinkern in der Stimme ganze menschliche Abgründe aufzureissen scheint. Francisco Araiza, Pao und Kaiser von China, hat hörbar da und dort etwas Mühe, dem golden glänzenden Strahlen seines Sonnenthrons mit stimmlich adäquatem Strahlen Paroli zu bieten. Lászlá Polgár singt den durch die Liebe humanisierten Ma mit balsamischem Sarastro-Bass; Peter Arens gibt ihm entsprechendes schauspielerisches Profil, hat zudem als Oberrichter Tschu-Tschu (eine reine Sprechrolle) den vielleicht dankbarsten Auftritt überhaupt, weil eingedenk seiner eminenten Sprechkunst Humor zum Zuge kommt: Es darf gelacht werden.
Gleitharmonisches Gewürz
Im Orchestergraben gleisst und glänzt, flimmert und flirrt es. Zemlinskys Partitur verlangt zwar ein gross besetztes Orchester, wird aber über weite Teile kammermusikalisch aufgelockert, ist reich an koloristischen Reizen und an solistischen Girlanden und Arabesken. Perfekter Jugendstil, aber ohne schwülen Schwulst, sondern unter Wahrung einer wohlproportionierten Ökonomie, so dass selbst das eklektizistisch Zusammengemengte stets eine ganz persönliche Handschrift trägt.
Der Dirigent Alan Gilbert bringt das alles - und das ist sehr viel - delikat und durchsichtig zur Geltung, hält die Kommunikation zwischen Orchester und Bühne stets sicher in Händen und mischt die exotischen Instrumentalfarben, darunter Saxophon und Banjo, Mandoline und Celesta, gleichsam als exotisches Gewürz in den Orchesterklang: wohldosiert, bekömmlich, lecker. Zudem entfaltet er den orchestralen Glanz, die melodische und gleitharmonische Fülle sowie die lyrische Suggestivkraft dieser Musik mit spürbarem Engagement. Ein souveränes Dirigentendebüt, souveränes Musiktheater überhaupt.
|
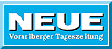
21. 10. 2003
Der Zürcher Kreidekreis
Fast auf den Tag genau vor 70 Jahren wurde Zemlinskys Oper "Der Kreidekreis" in Zürich uraufgeführt. Seit Sonntag ist das Werk in einer aufregenden Neuinszenierung David Pountneys im dortigen Opernhaus wieder zu sehen.
VON ANNA MIKA
Der Stoff ist Weltliteratur. Die Geschichte vom Streit zweier Frauen um ein Kind steht in der Bibel als Salomonisches Urteil. Er scheint aber auch in der altchinesischen Literatur auf. Dort, beim Dichter Li Hsing-tao, hat der deutsche Schriftsteller Klabund (1890-1928) ihn gefunden und zu seinem zu Beginn des 20. Jahrhunderts sehr erfolgreichen Schauspiel verarbeitet. Sein Freund Bertolt Brecht ließ sich davon zu seinem "Kaukasischen Kreidekreis" inspirieren.
Kraftvoller Musikstil
Klabunds Schauspiel liegt auch der Oper von Alexander Zemlinsky zu Grunde. Der Lehrer Alma Mahler-Werfels oder Arnold Schönbergs hat eine ungemein interessante Partitur geschaffen, die zwischen Mahler, Strauss, Debussy und Kurt Weill steht - ein kraftvoller Musikstil, der von den Nazis ausradiert wurde.
Der Dirigent Alan Gilbert weiß die faszinierende Partitur mit Licht zu durchfluten, er ballt aber auch die Klänge - etwa bei den leidenschaftlichen Szenen des Revolutionärs Ling - zu großer Dramatik oder jagt sie peitschend vorwärts wie etwa bei der heuchlerischen Gerichtsszene.
Sozialkritik
"Der Kreidekreis" ist wie eine Vorwegnahme eines Brechtschen Lehrstückes mit hörbarer Sozialkritik. Die Rollen sind je doppelt besetzt, von SängerInnen und SchaupielerInnen. Das oft überraschende Wechseln von Sprache und Gesang schaukelt die Spannung faszinierend hoch.
So singt Brigitte Hahn berührend verinnerlicht den "Gutmenschen" Haitang, während Annikó Donáth sie spricht. Ihre Widersacherin Yü-pei wird gleichermaßen stark von Cornelia Kallisch und Louise Martini gegeben. Die Liebhaber der Haitang sind Francicso Araiza bzw. Bernhard Bettermann sowie László Polgár bzw. Peter Arens. Mit ihrem Bruder Ling (packend Rodney Gilfry) kommt Haitang schließlich im Schnee um. Denn die Apotheose, in der Haitang durch das weise Urteil ihr Kind zugesprochen wird und sie mit ihrem geliebten Pao vereinigt wird, deutet David Pountney als Vision der Sterbenden.
Vorgeschmack auf Weill
Er und sein Ausstatter Johan Engels erzählen diese Geschichte mit einer klaren Bildersprache, in der Ebenen und Farben symbolhaft eingesetzt sind. Mit seiner zeitweiligen Annäherung an Kurt Weill gibt "Der Kreidekreis", der bei der Premiere einhellig bejubelt wurde, vielleicht schon einen Vorgeschmack auf die kommenden Bregenzer Festspiele.
David Pountneys Inszenierung stieß beim Publikum auf große Zustimmung.
|

