|
Aufführung
|

25. 11. 2003
(Première)
*
Musikalische Leitung: Franz Welser-Möst
Inszenierung: Nikolaus Lehnhoff
Bühnenbild: Roland Aeschlimann
Kostüme: Moidele Bickel / Amélie Haas
Lichtgestaltung: Jürgen Hoffmann
Chöre: Jürg Hämmerli
Choreographie: Denny Sayers
*
Hans Sachs: José van Dam
Veit Pogner: Matti Salminen
Kunz Vogelgesang: Martin Zysset
Konrad Nachtigall: Cheyne Davidson
Sixtus Beckmesser: Michael Volle
Fritz Kothner: Rolf Haunstein
Balthasar Zorn: Volker Vogel
Ulrich Eisslinger: Andreas Winkler
Augustin Moser: Boguslaw Bidzinski
Hermann Ortel: Giuseppe Scorsin
Hans Schwarz: Guido Götzen
Hans Foltz: Reinhard Mayr
Walther von Stolzing: Peter Seiffert
David: Christoph Strehl
Eva: Petra Maria Schnitzer
Magdalene: Brigitte Pinter
Nachtwächter: Günther Groissböck
SYNOPSIS - HIGHLIGHTS - LIBRETTO
|
|
Rezensionen
|
|
|
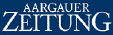
27. 11. 2003
Triumph des Spuks
Richard Wagners «Meistersinger von Nürnberg» in Zürich sind geglückt: Ein ausgefeiltes Dirigat verbindet sich mit einer sanften Regie. Beide lenken deutlich und deuten aus - und dazu gibts ein grandioses Ensemble zu hören.
Christian Berzins
Danke. Endlich wieder einmal ein Regisseur, der die Ouvertüre bei geschlossenem Vorhang spielen lässt. Dirigent Franz Welser-Möst wird Regisseur Nikolaus Lehnhoff wohl auch gedankt haben, denn im Falle von Richard Wagners «Meistersinger von Nürnberg» ist das Vorspiel als musikalische Visitenkarte berüchtigt: Welser-Möst deutet hier mit dem famosen Opernhausorchester an, was im Folgenden kommen wird: Scharf gezeichnet, aber nie übereilt sind die monumentalen Schläge - sie wirken nicht so wuchtig, da sie grandios ausgestaltet sind und das Klangbild nicht abkühlen. Wundersam lyrisch wird gezeichnet, aber auch der Witz geht nicht verloren: Da kann auch mal ein Holzbläsersolo spitz wie eine Handymelodie tönen. Musik und Bild werden sich später immer wieder ideal verbinden.
Von den Sängern schafft es José van Dam (Hans Sachs) am besten, mit Dirigent und Regie eins zu werden: Sein Nuancenreichtum ist enorm. Aber auch der überaus klar agierende Michael Volle (Beckmesser) passt sich bestens in die so dankbare Rolle des Epigonen ein: Er gibt den Geck, aber keinen, über den man lacht. Peter Seifferts Walther von Stolzing ist stimmlich wie szenisch ein Draufgänger, der aber schliesslich besänftigt wird und sein finales Preislied viel edler als zu Beginn singt. Christoph Strehl ist schlicht eine Idealbesetzung (David). Familie Pogner - Vater (Matti Salminen) und Tochter Eva (Petra-Maria Schnitzer) - kann dem hohen Niveau fast standhalten.
Getrübter Blick auf Nürnberg
Wenn der Vorhang im 1. Aufzug aufgeht, wird der Blick frei auf einen Kirchenraum mit Kanzel, zwei Bankreihen und einer Empore (Bühne Roland Aeschlimann). Warum nicht? Die Zweifel ob des traditionellen Raumes sind berechtigt, wird doch in der ersten Stunde darin nichts als brave Regieroutine gezeigt. Kein Bruch, keine Kante: Walther von Stolzing will Meistersinger werden - und scheitert vorerst.
Wenn sich der Vorhang zum 2. Aufzug heben soll, wird der Blick durch eine Gaze getrübt - ein Spuk zieht dahinter über Nürnberg hinweg. Die angedeutete Stadtszenerie ist architektonisch ein perfekter Raum, um darin wirksam mit Lichtstimmungen zu spielen. Das gelingt so gut, dass die Raufbolde in der Prügelei mehr als Elfen denn als Menschen erscheinen. Und Beckmesser taucht einem Kobold gleich in Sachs´ Stube auf.
Ein Traum verändert die Welt
War man im 1. Aufzug in der Vergangenheit, ist im 2. Aufzug in keinem erkennbaren Jahrhundert und in keiner zu zählenden Stunde mehr. Das Entscheidende geschieht hier ja auch im Traum, dem Sachs als Gelehrter entsteigt und aus dem Walther sein Preislied für den nächsten Tag gewinnt. Der Sommernachtstraum-Puck scheint für das Rechte gesorgt zu haben.
Im 3. Aufzug, auf der Wiese draussen vor der Stadt, wird Puck tatsächlich auftanzen, hier, wo die Meistersinger von einem neuzeitlichen Volk argwöhnisch beguckt werden. Vorerst ergötzt man sich an eigentümlichen Maskenwesen. Bald geht es aber nicht mehr um eine tumbe Volksfeier, sondern um die Betrachtung einer neuen Kunst - und deren Akzeptierung. Doch bei der berüchtigten Schlusslobpreisung der angeblich «heiligen deutschen Kunst» nimmt Lehnhoff noch einmal das Licht zurück, die Masse dreht sich - der Blick zum Horizont ist frei, eine idyllische Landschaft zieht sich in eine unendliche Weite, über alle Landesgrenzen hinweg. - Das Publikum dankte am Dienstagabend nach sechs (!) Stunden mit starkem, ungeteiltem Jubel.
|

27. 11. 2003
Kraftakt und Sängerfest ohnegleichen: Richard Wagners «Meistersinger von Nürnberg» am Zürcher Opernhaus
Die wundersame Wandlung des Schuster-Poeten
«Die Meistersinger von Nürnberg» von Richard Wagner gelten als fast unspielbar. Nicht nur wegen der notorischen Besetzungsprobleme des ebenso langen wie personenreichen Stücks, sondern mehr noch wegen seiner schwer zu rettenden deutsch-nationalen Ideologie, die in manchen Aufführungen nur dadurch erträglich wirkt, dass der gesungene Text kaum verständlich ist.
Von Sigfried Schibli
Auch im Zürcher Opernhaus faselt ein in Liebesdingen unterlegener Hans Sachs von deutscher Kunst und welschem Tand, auch hier gibt es den Widerspruch zwischen engstirnigem Kunstpatriotismus und der Tatsache, dass das von Hans Sachs geförderte und ausdrücklich begrüsste Preislied Walther von Stoltzings mehr mit der italienischen Operntradition als mit deutscher Sangesart zu tun hat.
Was die diversen deutschtümelnden Monologe hier erträglich macht, ist José van Dams zurückhaltend-intelligente Darstellung. Dieser noble Bassbariton gibt einen differenzierten Sachs, dem die Enttäuschung darüber, dass seine Zeit als begehrenswerter Mann offenbar abgelaufen ist, ins Gesicht geschrieben steht. Und der «Sieger» des Concours, Walther von Stoltzing, ist in der Verkörperung durch den weniger kraftmeierischen als heldenhaft-sportiven Tenor Peter Seiffert eher ein etwas unerfahrener Junker als der unglaubwürdige Naturbursche, den man in dieser Figur auch schon hat sehen wollen. Die beiden Protagonisten - und das macht den Rang der Zürcher Produktion aus - sind nun keineswegs einsame Highlights, sondern fügen sich in einer Reihe in die Besetzung, die mit Matti Salminen (Pogner), Rolf Haunstein (Kothner), Petra-Maria Schnitzer (Eva), Christoph Strehl (David) und vielen andern Sängerinnen und Sängern hoch-, ja höchstkarätig zu nennen ist.
Und Sixtus Beckmesser, der zu seiner Klampfe jämmerlich versingende und den Text grotesk verballhornende «Merker», dem man des Öfteren Züge einer Judenkarikatur hat andichten wollen? Wagner wollte ihn ursprünglich in Anspielung an den Wiener Grosskritiker Eduard Hanslick «Hans Lick» nennen. In Zürich ist er in der Person von Michael Volle eine keineswegs lächerliche Figur, sondern ein sympathischer, gut aussehender Mann in den besten Jahren, ein liebenswerter Spinner, dessen Lebenstragik darin besteht, irgendwie mit dem Dasein nicht zu Rande zu kommen und als intellektuelle Figur keine Anerkennung zu finden.
Wenn Beckmesser sich im dritten Akt in der mit Büchern vollgestopften Schusterstube des Hans Sachs als Bücherdieb versucht, eröffnet sich uns ein Täterprofil, für welches das misslungene Leben und nicht die pure Dummheit zentral ist. Und wie Michael Volle, äusserlich einem Udo Lindenberg ähnlich, das spielt und singt, verdient Höchstnoten, weil er ganz ohne stimmliche Verzerrung auskommt. Man begreift Ernst Bloch, der die Beckmesser-Musik etwas vom Modernsten nannte, das Wagner komponiert hat.
Orchestral und chorisch ist die Zürcher Produktion unter Franz Welser-Möst vorzüglich. Von Anfang an unterstützen fliessende Tempi den Konversationston des ersten Akts, wird das Krachlederne vermieden zu Gunsten filigraner Strukturen. Szenisch riskiert Nikolaus Lehnhoff eine zeitliche Progression des Dreiakters vom schrulligen Spätmittelalter bis ins 19. Jahrhundert. Untriftig ist das nicht, geht es in dem Stück doch auch um den Bewusstwerdungsprozess der Meistersinger, die erst lernen müssen, den Ton der neuen Zeit zu akzeptieren; freilich wird dadurch die Einheit des Stoffs strapaziert. Ganz ohne deutsches Zunftwesen kommt Lehnhoff im dritten Akt aus, wo er zur Belustigung einer ganz heutig gezeichneten Volksmenge eine kunterbunte Gauklerschar vor antikisierendem Panorama zeigt. Da ist Nietzsches heiteres Antike-Bild nicht fern.
Zitatenfreudig ist Roland Aeschlimanns Bühne, in der man bald Beckmessers «Gemerk» aus der Ur-Inszenierung 1868, bald Wieland Wagners nachtblaues Flieder-Bild von 1956 wiederfindet. Zwischen dem zopfigen ersten Akt in Nürnbergs Katharinenkirche und dem heiter neuzeitlichen Finale herrscht eine Spannung, die das Stück perspektivisch auffächert, ganz ähnlich dem Bruch in der Figurenzeichnung des Hans Sachs, der als Handwerker anfängt und als Bücherwurm aufhört. Vielleicht wäre dieser Schuster doch lieber bei seinem Leisten geblieben.
|

27. 11. 2003
Kurzweilige Meistersinger
Sechs Stunden Kurzweil: Richard Wagners Oper «Die Meistersinger von Nürnberg» feierte am Dienstag glanzvolle Premiere im Opernhaus Zürich.
Selbst eingefleischte Traditionalisten waren überwältigt vom Sinnesrausch der Bilder und Musik.
Der edle Ritter Walther von Stolzing dringt in die heile Welt der Meistersinger von Nürnberg. Ohne die Regeln der Gilde zu kennen, triumphiert er mit seinem Gesang und erobert das Herz der geliebten Eva. Hans Sachs, Schuster und wahrer Meister des Singens, vermittelt erfolgreich zwischen Neid und Bewunderung, zwischen Tradition und wahrer Kunst.
Regisseur Nikolaus Lehnhoff geht es wider den Wagner'schen Text um die wahre, ewige Kunst. So spielen die drei Akte in einem Kirchenraum, in einer blauen Welt und in einem griechischen Theater (Bühnenbild Roland Aeschlimann). Die prachtvollen Kostüme von Moidele Bickel beginnen ihre Zeitreise im Mittelalter und enden im Heute.
Die Stars der Szene setzen die Akzente: José van Dam als Hans Sachs, Peter Seiffert als Walther von Stolzing und Matti Salminen als reicher Goldschmied und Preisstifter Veit Pogner.
Die ambitiöse «zweite Garde» überzeugt: Petra-Maria Schnitzer als die schöne Eva Pogner, Michael Volle in der heiklen Charakterrolle des Sixtus Beckmesser und Christoph Strehl als ungestümer Geselle David.
Franz Welser-Möst dirigiert mit Tempo und überwindet kleine Unstimmigkeiten in den Massenszenen durch Geistesgegenwart.
Fazit: Sechs Stunden und keinen Moment langweilig.
Roger Cahn
|

27. 11. 2003
Zurück in die Zukunft?
In sechs Stunden von der Renaissance in eine rückwärts gewandte Gegenwart:
Wagners «Meistersinger» in Zürich
Mit den «Meistersingern von Nürnberg» ist dem Opernhaus Zürich unter der Leitung von Franz Welser-Möst musikalisch eine fulminante und höchst überzeugende Produktion gelungen. Der szenische Versuch von Nikolaus Lehnhoff hingegen scheitert.
• TOBIAS GEROSA
Um Hans Sachs Schlussmonolog führt kein Weg herum. Wenn er, die Hauptperson der Oper, «welschen Dunst und welschen Tand» verdammt und die «heilge deutsche Kunst» der «deutschen Meister» dagegensetzt, verlangt das nach einer dezidierten Bühnenlösung. Und die bleibt das Team um Regisseur Nikolaus Lehnhoff und Bühnenbildner Roland Aeschlimann schuldig, auch wenn sie keineswegs gedankenlos an die Sache herangehen.
Sie bieten einen Gang durch die Geschichte. Angefangen beim antiken Theater, den Fastnachtsspielen und Commedia dellArte, die im letzten Bild zitiert werden, über die Renaissance und das 19. Jahrhundert bis zu einer blutleeren und rückwärts gewandten Moderne im Schlussbild. Nur die Kunst schaffe den Boden, auf dem Identität entstehen könne, meint Lehnhoff am Premierentag in der NZZ. Und so habe auch Wagner mit seinem Nürnberg die europäische Kulturtradition seit der griechischen Antike gemeint. Ein Programmheftbeitrag begründet diesen Gedanken, doch auf der Bühne wirkt er papieren und didaktisch.
Manierierte Bewegungsmuster
Sähe man nur den ersten Aufzug, man könnte sich zurückversetzt fühlen in längst vergangene Theaterzeiten. Die klobige Holzausstattung, die bunten Renaissance-Kostüme von Amélie Hass und Moidele Bickel sind das eine, nicht nur der imposante Pogner Matti Salminens wirkte darin (unfreiwillig?) komisch. Das andere sind die peinlich genaue Nachbuchstabierung des Textes und die manierierten Bewegungsmuster: Als würde konstant ein Schild hochgehalten: Achtung, wir spielen Theater. Die Personen sind ziemlich streng geführt und entwickeln Profil. Trotzdem: «Wie bei den Tell-Spielen», kommentierte ein Besucher in der Schlange vor der Zwischenverpflegung.
Die Hoffnung, dass diese biedere Altmodigkeit gezielt eingesetzt ist, wird erst im zweiten Aufzug bestätigt. Er spielt im 19. Jahrhundert, und ein Zitat des Baumes aus Wieland Wagners Neu-Bayreuther Meistersinger-Inszenierung macht deutlich, dass auf der Opernhausbühne die Rezeptionsgeschichte der Meistersinger mitgedacht werden soll. Der Ritter Stolzing, von Peter Seiffert brillant gesungen, hat sich äusserlich den Bürgern angeglichen, wie auch der Stadtschreiber Beckmesser. Die üblichen Klischees findet man an ihm nicht, dafür wird er herumstolpernd zu einer lächerlichen Figur, wie ernsthaft und prägnant ihn Michael Volle vokal auch gestaltet.
Relikte aus alter Zeit
Im dritten Aufzug lässt der riesige Bücherstoss in Sachs Werkstatt an die Bücherverbrennungen des 20. Jahrhunderts denken. Die Bücher werden im Übergang zur Festwiese aber manierlich hinausgetragen, und als Basis dieses Kulturstapels erscheint ein griechisches Kapitell. Wie eine brave Volkshochschulgruppe von heute sitzen Chor und Zusatzchor in einem antiken Theater darum herum. Die Meistersinger in ihren Zylindern und langen Gehröcken wirken wie Relikte einer anderen Zeit. So wird Schustermeister Sachs berüchtigter Schlussmonolog zum konservativen «Kehret um» des Rückständigen. Wenn ihm der gemalte Prospekt einer griechischen Polis zum fernen Ideal wird, weist die Vergangenheit der Gegenwart den Weg zurück in eine imaginäre und idealisierte Zukunft. Ist Lehnhoff mit seinem auch handwerklich nicht immer überzeugenden Konzept hier nicht auch inhaltlich auf halbem Weg stehen geblieben?
So problematisch die Deutung sein mag, so bestechend überlegt und subtil singt (und nie: deklamiert) José van Dam nicht nur diese Passage und setzt so einem exzellenten Ensemble mit Petra-Maria Schnitzer als Eva und Christoph Strehl als David die Krone auf.
Schlanker Orchesterklang
Massgeblichen Einfluss darauf, dass auch ziemlich viel Text verständlich bleibt, hat wiederum Franz Welser-Möst, der ehemalige Chefdirigent des Opernhauses. Wie schon in seinen vergangenen Wagner-Dirigaten setzt er auf einen schlanken, filigranen Orchesterklang und das Orchester folgt ihm darin in dieser vertrackt schwierigen Partitur fast blind. Wiederum erstaunt, wie viele leise Stellen Welser-Möst mit Gewinn in der Partitur fand. Abgesehen von einigen wackligen Stellen und vom noch wenig organisch wirkenden Vorspiel eine zu Recht bejubelte Leistung von Dirigent und Orchester.
|

27. 11. 2003
Kunstwelt zwischen Utopie und Wahn
Dienstag, 17 Uhr: Der Premierentermin im Opernhaus ist ungewöhnlich, das Werk, dem er gilt, auch. «Die Meistersinger», ein Kraftakt. Aber mit dem Schlussakkord um 23 Uhr und dem ausbrechenden Jubel ist auch klar, dass er szenisch und musikalisch meisterlich bewältigt ist.
Herbert Büttiker
Wo liegt Richard Wagners Nürnberg, der Hort «deutscher Kunst»? Die neue Zürcher Inszenierung ersetzt im Schlussbild den einst obligaten Prospekt der mittelalterlichen Stadtsilhouette durch Friedrich Schinkels «Blick in Griechenlands Blüte». Eine Vision grossartiger Landschaft, grandioser Architektur und schöner Menschen, die am Marmorfries arbeiten. Davor gibt es das Rund eines griechischen Theaters. Auf den Stufen sitzen Menschen heutigen Schlages, ob Nürnberger Bürger oder Griechenlandtouristen, wer weiss. Ein buntes Maskenspiel wird vorgeführt, der Satyr steigt aus dem Altar des Dionysos, der als Säulenstumpf später auch zum Sängerpodest wird. Ein «klassisches» Konzert ist angesagt. Beckmesser und sein Kontrahent bestreiten es im Frack, der eine fällt durch, der andere wird vom Volk bejubelt: mit ihm die Kunst überhaupt, die Einheit von sozialem Ganzen und herausragender Individualität, die in finaler C-Dur ausgeleuchtet wird. Der Bogenschlag vom romantisch vermittelten antiken Ideal zur Gegenwart will als überzeitliche «europäische Idee» verstanden sein. «Nicht die Politik, sondern Kunst und Kultur stiften sowohl nationale als auch europäische Identität», schreibt Regisseur Nikolaus Lehnhoff in der Hauszeitung, und das Programmbuch unterlegt das mit Erläuterungen zu Wagners Utopien einer «ästhetischen Weltordnung».
Nachdem jüngste Inszenierungen gerade den Bruch mit diesen durch das Nürnberger Meistersinger-Bollwerk eben auch diskreditierten Ideen mit inszeniert haben, versucht die Zürcher Inszenierung noch einmal, diese Vision zu retten. Abgesehen von der Unsicherheit, ob es sich bei diesen Nürnbergern nicht doch eher um Patrizier handelt, die einfach ihr Hobby zu wichtig nehmen, muss dabei freilich auch der textliche Widerspruch zwischen europäischer Idee und der Rede von der heiligen deutschen Kunst offen bleiben; und ob Hans Sachs mit seiner Schimpfrede auf den welschen Tand das europäische Ideal nicht zur «Festung Europa» vermauert, bleibt erst noch die Frage. Aber dass diese Frage und wie sie gestellt werden kann, dass überhaupt «Die Meistersinger» in der Spannung von Realität und Utopie hier eine wunderbar plastische Deutlichkeit erhalten, ist die ausserordentliche Leistung dieser Inszenierungsarbeit und ihres Grundgestus: vom ersten zum letzten Bild einen Weg zugleich zurück und nach vorn zu gehen.
Virtuoses Zitieren
Architekturelemente einer Galerie, Kanzel und Chorgestühl – was der Bühnenbildner Roland Aeschlimann für den Schauplatz im Innern der Nürnberger Katharinenkirche an Realismus Grosszügigem aufbietet, um das Zeitalter des Humanismus zu suggerieren, greifen die Pluderhosenkostüme von Moidele Bickel und Amélie Haas stimmungsvoll auf. Von Dürers Nürnberg ins 19. Jahrhundert und weiter geht es dann mit dem Nachtbild, das von einer riesigen Fliederdolde – eine Hommage an Wieland Wagners Bayreuther Inszenierung von 1956 – und einer Treppenanlage dominiert wird. Viel mehr braucht es nicht, um die ganze Betriebsamkeit dieser Nacht wirkungsvoll zu inszenieren. Ein Nürnberger Stadtmodell leuchtet kurz während der Prügelszene auf, als leibhaftiges Klischee der Butzenscheibenromantik wandelt der Nachtwächter in Ritterrüstung über die Bühne, und im Stil der Fantasy-Romantik krümmt sich am Schluss Beckmesser wie eine zerzauste Fledermaus vor der riesigen Mondscheibe. All dies ist nur Zitat und wie das «Versteck» des Liebespaares, das statt im Gebüsch im offenen Souffleurkasten turtelt und nebenbei auch ein paar neugierige Blicke in den Orchestergraben wirft, im Understatement virtuoses Regietheater, das im Panoptikum theatralischer Möglichkeiten auf die Perspektive der grossen Komödie zielt, deren Humor nicht Lustigkeit, sondern wissende Distanz bedeutet.
Ohne das formidable Aufgebot gewiefter Sängerdarsteller, die allenthalben Figuren von prächtiger Plastizität auf die Bühne stellen, käme die Inszenierung damit freilich nicht weit. Zu ihnen gehören Christoph Strehls David, mit klarem Tenor munter, aber ohne naives Getue gespielt, und Brigitte Pinters Magdalene, deren Stimme allerdings ein wenig zu sehr nach Küche klingt. Für die in corpore magistrale Gruppe der Meistersinger bürgen lauter bewährte Kräfte des Zürcher Ensembles. Rolf Haunstein als Kothner führt sie an mit der auch sängerisch soliden Autorität des Vorsitzenden. Wichtiger und gewichtiger rückt natürlich Pogner in den Vordergrund mit dem Vorschlag, seine Tochter als Preisim Sängerwettstreit auszusetzen. Matti Salminen verankert diese Idee tief in der Klang- und Gemütsfülle eines jovialen und zugleich dünkelhaften Charakters und trifft auf unnachahmliche Weise die Attitüde des Bildungsbürgers, dessen Borniertheit sich weltmännisch kaschiert. Beckmesser ist in dieser Inszenierung nicht von Grund auf unsympathischer als der Mann, dessen Schwiegersohn er werden möchte. Michael Volle nobilitiert ihn gewissermassen mit baritonalem Wohlklang und gibt ihm die Statur, die ihn in seinem Merkeramt nicht unmeisterlich erscheinen lässt. Die Entgleisung dieses Charakters beginnt damit, dass er sich in eine Rolle drängen lässt, die nicht seiner Begabung entspricht. Wie Volle dieses Versagen bis zum Kontrollverlust eines Wahnsinnigen gestaltet, ist dann wieder eine mit grosser stimmlich-musikalischer Differenzierungskunst erarbeitete darstellerische Meisterleistung.
Hintergründiger Hans Sachs
Es hat wohl mit der kraftvollen Zeichnung dieser Figuren zu tun, dass der Hans Sachs in dieser Inszenierung fast ein wenig in den Hintergrund zu treten scheint. Aber dazu bei trägt auch die gleichsam stille Art, mit der José van Dam die Hauptgestalt des Werks angeht. Wie weit dabei auch die Ökonomie der Kräfte für die Bewältigung der Riesenpartie eine Rolle spielt, mag dahingestellt bleiben. Deutlich wird jedenfalls eine Auffassung, die das Abgeklärte und auch Resignative des alternden Handwerkerdichters und -philosophen akzentuiert. Das erschliesst die Musikalität dieser Figur in vielen Momenten schlichter, unsentimentaler Nüchternheit immer wieder feinnervig, verschafft ihr eine ganz eigene Konzentriertheit in den Monologen und eine hintergründige Überlegenheit in den Szenen mit Eva, Walther und Beckmesser. Aber manchmal ist der niederschwellige Gesang auch problematisch: ungelöst in der Klangbalance zum Orchester, fade im fahlen und flach artikulierten Konversationston, vor allem nicht restlos ausgefüllt in der Vitalität der Figur. Weniger Migräne, mehr Unrast im Gesicht, möchte man sagen, glühendere Erotik in der Nähe zu Eva, in der Aggression gegen Beckmesser, und Solidarität mit Walther.
Überquellender Gesang
Die grossen Ideen sind bei Wagner das eine, die intime Psychologie dasselbe: Die doppelte Identifikation mit Hans Sachs und Walther Stolzing, mit dem Künstlerfürsten und dem Aussenseitergenie zeigt sich darin, wie sich die beiden Eva «teilen». Das gehört zur Bedingung für Wagners Komödienharmonie. Dazu gehört auch, dass Eva einige Ansätze gestattet sind, ihr Geschick zu lenken und ihrem Namen gemäss als Verführerin zu handeln, im Fliedergebüsch wie in der Schusterstube. Das gibt dieser Figur eine kecke Lebendigkeit, die Petra-Maria Schnitzer musikalisch farbiger umsetzt als sie es im steifen weissen Brautkleid sichtbar machen kann. Und so dominieren dann doch die hingebungsvollen Töne, mit denen sie ihre Figur – am Rand der Sprachlosigkeit – prägt bis hin zur wunderbar ruhig gehaltenen Leuchtkraft des Quintetts.
Der überquellende Gesangsparcours ihres Geliebten ist dazu nicht nur ein Kontrast. Das zeigt ihre Begegnung im dritten Akt. Während Eva gebannt und stumm in den Anblick Walthers versunken ist, verliert auch er sich – in den Gesang der letzten Strophe seines Preisliedes: «Vortrag» statt Zwiesprache. Peter Seiffert, der sich mit unermüdlichem Elan in all die Stollen und Abgesänge stürzt, die ihm gleich in drei Szenen der «Meistersinger» aufgegeben sind, ist ein Glücksfall für die überbordende Partie. Der Schwung und dabei die Fähigkeit auch exponierte Phrasen dynamisch zu schattieren, lassen kein Gefühl von Wiederholung aufkommen, im Gegenteil. Die vulkanische Spontaneität hat etwas Mitreissendes und gibt der Aufführung insgesamt den Schub ins Finale.
Den Anstoss aber gibt Franz Welser-Möst, der mit einer Verve dirigiert, die sich in wahre Musiziertaumel aufsteigern kann, schon in der Ouvertüre. Weil das nicht in draufgängerischer Kraftentfaltung, sondern in flüssigen Tempi und gleitendem Legato geschieht, bleibt der Klang offen für alle lyrische Lineatur, musikantisch prickelndes Staccatospiel und filigranes Figurenspiel. Wenn die Durchhörbarkeit an Grenzen gelangt, wie in der Prügelszene, liegt es an den Vorgaben. Wo sie gewahrt bleibt, sind auch die souveränen Einsätze des Chores zu geniessen, überhaupt ein Musizieren in einer Konzentration und auf einem Niveau, das über die Stunden trägt.
|

27. 11. 2003
Den Wettstreit gewinnen hier die Sänger
Die Zürcher «Meistersinger» sind unter Franz Welser-Mösts Leitung eine Sängeroper, wie sie im Buch steht.
Wagners «Meistersinger» liefern ein schlagendes Argument dafür, wieso man Repertoire-Opern immer wieder neu inszenieren sollte. Denn die Geschichte des Ritters Walther von Stolzing, der mit seiner neuen Gesangskunst die altehrwürdige Meistersinger-Zunft in Nürnberg durcheinanderbringt und dafür als Preis die geliebte Eva gewinnt, hat Wagner zwar kompositorisch und dramaturgisch meisterhaft umgesetzt. Aber die pathetische Beschwörung deutscher Werte eröffnete dem Missbrauch durch die Nationalsozialisten alle Tore.
Diese Irritation kann allein durch philologische Erklärungen nicht aus der Welt geschafft werden, wie sie Udo Bermbach im Programmheft zur Zürcher Neueinszenierung liefert. Er führt zwar aus, dass Wagner bewusst die Politik ausklammerte, weil in seiner Utopie an deren Stelle die Kunst trat. Und er weist darauf hin, dass gerade diese Absenz des Politischen den politischen Missbrauch ermöglichte.
Nicht Kunstnationalismus, sondern das Primat der Kunst vor der Politik: Deutlich machen müsste aber all das die Regie selbst. Nikolaus Lehnhof scheint da tatsächlich anzuknüpfen, wenn er Wagners Nürnberg zum Modell einer «europäischen» Kulturvision umdeuten wollte. In der Inszenierung selbst allerdings erschöpft sich das in einem Pluralismus der Stile und Kostüme: Moidele Bickel und Amélie Haas bieten eine Art Modeschau vom Renaissance-Wams über Biedermeier-Gehröcke bis zum modernen Freizeitlook.
Bildstarke Ansätze ergeben sich daraus erst im letzten Akt: die wie zum Müllhaufen versammelten Bücher Sachsens sind nicht nur Zeichen dafür, dass Innovationen Stoltzings das hergebrachte Wissen entwerten und erinnern von Ferne an die Bücherverbrennungen der Nazis. Greifbar wird die gesellschaftliche Auflösung danach auf der Festwiese, wo die verschiedenen Zeitebenen sich gespenstisch durchdringen.
Grossartiges Ensemble
Für eine griffige Deutung des Werks kommt das zu spät. Tatsächlich scheint Lehnhoff seine ganze Fantasie auf die Figurenregie konzentriert zu haben. Die Rechnung geht auf, weil hier ein exzellentes Sängerensemble versammelt ist, das zwar weit gehend konventionell, aber überaus lebendig agiert. Vokale Glanzlichter setzen Peter Seiffert, der als Naturbursche Stoltzing seinen schwereren, aber immer noch geschmeidigen Tenor zu verschwenderischer Kraft und Fülle steigert.
Ebenbürtig zur Seite stehen ihm der imposante Bass von Matti Salminen (Pogner) und der Bariton von Michael Volle, der den Beckmesser nicht als pedantischen Traditionshüter karikiert, sondern mit energischer und facettenreicher Stimme aufwertet. Der leuchtkräftige Sopran von Petra-Maria Schnitzer (als szenisch farblose Eva) und der schlank gespannte Tenor von Christoph Strehl (David) fügen sich stimmig in ein Ensemble ein, das bis in die Nebenrollen das hohe Niveau wahrt.
Die Überraschung ist der Hans Sachs von José van Dam. Obwohl das Orchester die Partitur nach allen Seiten hin ausleuchtet und auflichtet (ein weiteres Wagner-Meisterstück von Franz Welser Möst), vermag sich van Dams Bariton nur unzureichend durchzusetzen. Aber er deutet stimmig diesen Sachs von Beginn weg in abgeklärte Altersmilde um: Selbst wo er nicht singt, bleibt er, als hätte es ihm angesichts der Wunder von Stoltzings Gesang und dessen Liebe zu Eva die Sprache verschlagen, stumm und das menschliche berührende Zentrum dieses musikalisch grandiosen Abends.
urs mattenberger
|

27. 11. 2003
In Nürnberg oder irgendwo
Wagners «Meistersinger» im Opernhaus Zürich
Ob es denn möglich wäre? Ob es möglich wäre, «Die Meistersinger von Nürnberg» ohne ihre Rezeptionsgeschichte auf die Bühne zu bringen? Gewiss, Wolfgang Wagner zum Beispiel hat es noch 1996 bei den Bayreuther Festspielen versucht: in einer intellektuell bescheidenen und szenisch naiven Produktion. Aber dominiert wird die Präsenz der «Meistersinger» auf der Bühne eindeutig durch den kritischen Umgang - mit dem Werk Richard Wagners an sich wie auch, und vor allem, mit den in ihm niedergelegten geistigen Strömungen und deren Ausgeburten in den dunkelsten Zeiten des zwanzigsten Jahrhunderts. In seiner Deutung, die er 1995, fünfzig Jahre nach Kriegsende, für die Niederländische Oper in Amsterdam entwickelt hat, zeigte Harry Kupfer, wie sehr es in dem von Wagner so genannten «Satyrspiel» um Sturheit, Paragraphenreiterei und Autoritätshörigkeit geht und wohin solches führen kann. Noch drastischer hatte ein Jahr zuvor Hans Neuenfels in seiner mittlerweile wieder aufgenommenen Stuttgarter Inszenierung die «Meistersinger» als ein Panoptikum des Deutschen, insbesondere der deutschen Nachkriegsgeschichte, ausgelegt. Und Peter Konwitschny liess vergangenes Jahr in Hamburg an jener Stelle in der abschliessenden Ansprache des Hans Sachs, an der es um das Deutsche als den eigentlichen positiven Wert geht, die Vorstellung für einen (allerdings ironisch distanzierenden) Moment der Reflexion unterbrechen.
Wort und Tat
Zu alldem geht die Neuinszenierung der «Meistersinger» im Opernhaus Zürich auf Distanz. Das Vorspiel nimmt der Dirigent Franz Welser-Möst weder mit pathetischer Geste noch als Einspruch dagegen, vielmehr rasch und behend, im raffiniert gearbeiteten Komödienton sozusagen. Bemerkenswert der Versuch, das Stück aus einem einzigen Tempo heraus zu gestalten und dabei jede unterstreichende Emphase zu umgehen; der Preis dafür liegt in einer gewissen Atemlosigkeit, die sich da und dort einstellt. Dafür wird durchgehend sorgfältig artikuliert - die Kritische Ausgabe der Partitur hat ja ans Licht gebracht, wie sehr Wagners Musik in den «Meistersingern» vom vielfältigen Wechsel zwischen dem Gebundenen und dem Gestossenen lebt. Nun teilt sich aber der Vorhang und fällt der Blick in jenen Kirchenraum mit seiner mächtigen Kanzel, den der Bühnenbildner Roland Aeschlimann für den ersten Aufzug vorgesehen hat: Nürnberg, die protestantische Stadt, der Protestantismus als eine Religion des Wortes und die «Meistersinger» als eine Oper, in der es ganz besonders um die Beziehung zwischen Wort und Ton geht - so mag man es sehen.
Zu verstehen ist aber einstweilen noch herzlich wenig (auch hier brächte die Projektion der Texte nützlichen Erkenntnisgewinn). Denn Peter Seiffert gibt gleich bei seinem ersten Auftritt den Ton an; als Walther von Stolzing, als der von aussen in den bürgerlichen Kreis der Meistersinger eindringende Adlige, prägt er den Abend mit seinem glänzenden, strahlkräftigen Tenor und seiner schäumenden Energie. Das hat zur Folge, dass Christoph Strehl (David), der an sich über eine wunderbar leichte Höhe verfügt, bei der umständlichen Erklärung der Tabulatur ins Pressen gerät und dass Brigitte Pinter (Magdalene) mit forciertem Vibrato in Erscheinung tritt. Matti Salminen dagegen schöpft auch hier aus dem Vollen; der Goldschmied Veit Pogner, der den fatalen Wettkampf um seine Tochter und sein Erbe initiiert, findet in ihm würdige Verkörperung. Äusserst belebt die Diskussionen im Kreis der Meistersinger, die von dem Bäcker Fritz Kothner (Rolf Haunstein) präsidiert werden. Die Herren sind von den Kostümbildnerinnen Moidele Bickel und Amélie Hass in Renaissance-Gewänder gekleidet worden und setzen sich Kopfbedeckungen auf, die an die Hüte der venezianischen Dogen erinnern - wohl eine Anspielung an ein Bild von Tizian in Venedig, das Wagner als wichtige Inspirationsquelle nennt.
Im Kreis der Meistersinger fällt er zunächst gar nicht auf, der kleine ältere Herr. Doch bald wird sichtbar: Es ist Hans Sachs mit seinem so besonderen Einfluss. Und wird hörbar: Es ist José van Dam. Tatsächlich, der belgische Sänger mit seiner aussergewöhnlichen Ausstrahlung und seinem samtenen Bariton nimmt sich noch einmal dieser Partie an, die er 1995 unter der Leitung von Georg Solti für eine CD-Einspielung gesungen hat. Ob sie ihm liegt, mag man sich fragen; kein Zweifel kann aber daran bestehen, dass van Dam den wahrhaft exorbitanten Anforderungen der Rolle nur mehr partiell gerecht zu werden vermag. Gewiss, Hans Sachs als älterer Mann, gelassen, mit natürlicher Autorität versehen, auf Ausgleich bedacht - das hat seinen Reiz. Der Fliedermonolog im zweiten Auftritt bleibt hier jedoch blass, und das so gründlich durchkreuzte Ständchen des Sixtus Beckmesser gerät zu einem ungleichen Wettkampf. Vielleicht auch deshalb, weil Franz Welser-Möst das Orchester nicht so weit dämpft, dass das Singen van Dams nicht als Markieren wirkte. Und weil Michael Volle seine Aufgabe mit der ganzen Pracht seiner Stimme angeht; die Person des Stadtschreibers und Merkers erscheint hier keineswegs als Karikatur, schon gar nicht als eine des Kritikers oder des Juden. Kräftig geht es also zu - aber die tumultuöse Doppelfuge, in die der Akt mündet, zeigt der Regisseur Nikolaus Lehnhoff in stilisierter Choreografie hinter einem Schleiervorhang - was zusammen mit der verschämten Andeutung einer Nürnberger Stadtkulisse doch ein wenig harmlos erscheint.
Reise durch die Zeit
Der zweite Aufzug hat denn auch seine Längen. Allein, wie José van Dam mit seiner Stimme umgeht, nötigt einem allen Respekt ab. Denn im dritten Aufzug, der Hans Sachs allein gehört, ist der Sänger noch gut bei Kräften und fährt er erst zu voller Form auf. Überaus eindrücklich das Geschehen in der Stube des dichtenden Schusters: das Verfassen des Preislieds mit Stolzing, die Begegnung mit Eva Pogner, bei der Petra-Maria Schnitzer etwas gehemmt wirkt, und jene mit dem zerzausten Beckmesser, schliesslich die Taufszene und das Quintett. Das Orchester der Oper Zürich findet hier zu jenem fliessenden, zugleich diskreten wie klangschönen Begleiten, das nun doch Parlando und Verständlichkeit zulässt.
Gewandelt haben sich auch die Kostüme; in einer über alle drei Aufzüge reichenden Zeitreise sind sie hier in jene frühe Gründerzeit gelangt, in der die «Meistersinger» entstanden sind: In einer Fülle bildlicher Assoziationen weist die Inszenierung auf den immensen gedanklichen Kreis hin, den das Werk abdeckt. So fehlt in der Schusterstube auch nicht ein Bücherberg - den Hans Sachs als Ausdruck des akkumulierten Wissens versteht, der aber natürlich auch an die Bücherverbrennung denken lässt. Das grosse Finale - es spielt vor einem Rundhorizont mit einem klassizistischen Gemälde von Schinkel - wird dann aber zu einem ungestört farbenfrohen Tableau - wenn auch einem aus demokratischem Geist. Die von Jürg Hämmerli geleiteten Chöre sind mit Menschen von heute in Alltagskleidung besetzt, die Meistersinger treten durch die Zuschauerreihen auf; Fahnen und pathetische Aufzüge fehlen, Maskeraden gibt es aber schon. Da klingt denn das Heil auf das echte Deutsche geradezu beiläufig.
So wäre es denn doch möglich, «Die Meistersinger von Nürnberg» als eine (freilich sehr gut gemachte) Oper wie alle anderen zu zeigen? Franz Welser-Möst plädiert für einen unvoreingenommenen Zugang zum Werk und damit für den Abschied von jener kritischen Befragung, die im weiteren Sinn auf den Geist von 1968 zurückgeht. In dieselbe Richtung weist das Abendprogramm, in dem behauptet wird, die «Meistersinger» hätten nichts mit nationalem Gedankengut, vielmehr ausschliesslich mit der gesellschaftsbildenden Kraft von Kunst zu tun. Und Nikolaus Lehnhoff behauptet gar, mit Nürnberg sei keine deutsche, sondern eine europäische Stadt gemeint. Alles in Ehren, alles diskussionswürdig - und die Produktion plädiert für ihr Anliegen auf hohem Niveau, insgesamt aber doch eher betulich. Nur ist da noch die Frage, ob ein Kunstwerk (und ein solches wie die «Meistersinger» ganz besonders) überhaupt rein immanent wahrgenommen, ob von alldem, was sich an Deutungen und Wirkungen ans Werk selbst angelagert hat, einfach abgesehen werden könne. Die Antwort darauf bleiben diese Zürcher «Meistersinger» schuldig.
Peter Hagmann
|

27. 11. 2003
Im Rückwärtsgang
Sechs zwiespältige Stunden: Richard Wagners «Meistersinger» am Opernhaus Zürich
Musikalisch sind sie meisterlich, die «Meistersinger von Nürnberg» am Opernhaus Zürich unter Franz Welser-Möst. Der szenische Versuch von Nikolaus Lehnhoff hingegen scheitert.
Tobias Gerosa
Um Hans Sachs’ Schlussmonolog führt kein (Regie-)Weg herum. Wenn die Hauptperson der Oper «welschen Dunst und welschen Tand» verdammt und die «heil’ge deutsche Kunst» der «deutschen Meister» dagegensetzt, verlangt das nach einer dezidierten Bühnenlösung. Doch dies bleiben Regisseur Nikolaus Lehnhoff und Bühnenbildner Roland Aeschlimann schuldig, auch wenn sie keineswegs gedankenlos an die Sache herangehen.
Retro-Ästhetik
Angefangen beim antiken Theater, endet ihr Gang durch die Geschichte über Renaissance und 19. Jahrhundert im Schlussbild in einer rückwärtsgewandten Moderne. Wagner habe mit seinem Nürnberg die europäische Kulturtradition seit der griechischen Antike gemeint, sagte Lehnhoff am Premierentag in der NZZ. Ein Programmheftbeitrag begründet diesen Gedanken, doch auf der Bühne wirkt er papieren und didaktisch.
Im ersten Aufzug fühlt man sich zurückversetzt in längst vergangene Theaterzeiten. Die Ausstattung ist das eine, nicht nur der imposante Pogner Matti Salminens wirkt darin (unfreiwillig?) komisch. Das andere sind die peinlich genaue Nachbuchstabierung des Textes und die manierierten Bewegungsmuster, als würde konstant ein Schild hochgehalten: Achtung, wir spielen Theater. Auch wenn die Personen genau geführt sind: «Wie bei den Tell-Spielen», kommentierte ein Besucher in der Schlange vor der Zwischenverpflegung.
Ist man dann im zweiten Aufzug im 19. Jahrhundert gelandet, stellt man immerhin beruhigt fest, dass die biedere Altmodigkeit des vorherigen Akts Absicht war. Ein Zitat des Baumes aus Wieland Wagners Neu-Bayreuther «Meistersinger»-Inszenierung macht deutlich, dass auch die Rezeptionsgeschichte der Oper mitgedacht werden soll. Der Ritter Stolzing, von Peter Seiffert brillant gesungen, hat sich äusserlich den Bürgern angeglichen, wie auch der Stadtschreiber Beckmesser. Die üblichen Klischees findet man an ihm nicht, dafür wird er herumstolpernd zu einer lächerlichen Figur, wie ernsthaft und prägnant ihn Michael Volle vokal auch gestaltet.
In Aufzug drei lässt der riesige Bücherstoss in Sachs’ Werkstatt an die Bücherverbrennungen des 20. Jahrhunderts denken. Die Bücher werden im Übergang zur Festwiese dann aber manierlich hinausgetragen und als Basis dieses Kulturstapels erscheint ein griechisches Kapitell. Wie eine brave Volkshochschulgruppe sitzen Chor und Zusatzchor in einem antiken Theater possierlich darum herum.
Die Meistersinger in Zylindern und langen Gehröcken wirken wie Relikte einer anderen Zeit. So wird Schustermeister Sachs’ berüchtigter Schlussmonolog zum konservativen «Kehret um» des Rückständigen. Wenn ihm der gemalte Prospekt einer griechischen Polis zum fernen Ideal wird, weist die Vergangenheit der Gegenwart den Weg zurück in eine imaginäre und idealisierte Zukunft. Lehnhoff ist mit seinem auch handwerklich nicht immer überzeugenden Konzept hier auch inhaltlich auf halbem Weg stehen geblieben.
Zum Glück die Musik
So problematisch die Deutung sein mag, so bestechend überlegt und subtil singt (und nie: deklamiert) José van Dam nicht nur diese Passage. Er setzt so einem exzellenten Ensemble mit Petra-Maria Schnitzer als Eva und Christoph Strehl als David die Krone auf. Massgeblichen Einfluss darauf, dass viel Text verständlich bleibt, hat wiederum Franz Welser-Möst, der ehemalige Chefdirigent des Hauses. Wie schon in seinen vergangenen Wagner-Dirigaten setzt er auf einen schlanken, filigranen Orchesterklang, und das Orchester folgt ihm darin durch die vertrackt schwierige Partitur fast blind.
Wiederum erstaunt, wie viele leise, kammerspielartige Passagen Welser-Möst in der Partitur findet. Abgesehen von einzelnen wackligen Stellen und vom noch wenig organisch wirkenden Vorspiel eine zurecht bejubelte Leistung von Dirigent und Orchester.
|

27. 11. 2003
Rosenmontag statt Nazi-Parteitag
Das Opernhaus Zürich inszeniert Wagners «Meistersinger»
Das Zürcher Opernhaus strahlt mit seinen Wagner-Produktionen hell in die Welt hinaus. «Die Meistersinger» wurden wiederum zum Musikfests während die Inszenierung im Grossen unentschieden, im Kleinen präzis gearbeitet war.
Von Reinmar Wagner
«Heilge deutsche Kunst»! Einen fatalen Satz hat Richard Wagner da gedichtet. Erst gings mit der deutschen Kunst ab in den zweifelhaften Olymp der Nürnberger Parteitage, und solcherart befleckt, blieb stets ein grosses Misstrauen und Unbehagen diesem Stück gegenüber, das so weit ging, dass man die «Meistersinger» stets verteidigen musste, wenn man sie auf die Bühne brachte.
Solide Regiearbeit
Nikolaus Lehnhoff, der Regisseur dieser aufwendigen Zürcher Inszenierung, sieht die Verhältnisse nüchtern. Karl Friedrich Schinkels Monumentalgemälde «Blick in Griechenlands Blüte» ziert das Schlussbild (Bühnenbild: Roland Aeschlimann), während die Meistersinger in einer unentschiedenen Mischung aus Zunftverein und Karnevalsclique aufmarschieren.
Rosenmontag statt Nazi-Parteitag, und Lehnhoff bricht das Pathos nicht. Dass er den ersten Akt ins Mittelalter versetzt, trägt nichts zum Verständnis des Zusammenhangs bei, im Gegenteil, erst einmal schockiert das biedere Bühnenbild mit einer monumentalen Kanzel, bis die Inszenierung an Fahrt gewinnt und sich Langhoffs Detailtreue durchsetzt und seine solide Regiearbeit lebendiges, kurzweiliges Theater ergibt.
Die Lebendigkeit und Natürlichkeit seiner Personenführung ist Langhoffs erste Qualität, die zweite, dass er der Musik nicht im Weg steht. Für wichtige Auftritte holt er die Sänger stets unauffällig an die Rampe, hält sie aber auch dort in subtiler Bewegung, so dass nie der Eindruck von Statik entsteht.
In Würde und Grösse
Damit ist schon die erste Bedingung für den musikalischen Höhenflug erfüllt, die zweite sind die Sänger und die dritte, vielleicht entscheidendste ist der Dirigent: Franz Welser-Möst polarisiert mit seinen Wagner-Dirigaten. Es gibt Zuhörer, welche die stundenlangen Klangorgien vermissen.
Aber um wie viel mehr gibt er uns mit seinem subtilen, detailreichen Musizieren! Keine Linie im polyphon geführten Orchester geht verloren, alle Klangfarben dürfen heraustreten, und jeder Aufschwung ist aufgebaut, aus dem Piano kommen Wucht und Wirkung.
Und das ist noch nicht alles. Bis auf Peter Seiffert und Matti Salminen sangen in Zürich nicht die Gigantenstimmen, die von Wagner-Produktion zu Wagner-Produktion weitergereicht werden, sondern zahlreiche Ensemblemitglieder, die man nicht von vorneherein in dieses Repertoire steckt.
Keiner unter ihnen ging unter in den Klangwogen, allen rollte Welser-Möst den roten Teppich eines kammermusikalisch aufgelockerten Klangbilds aus, mit dem angenehmen Effekt, dass man praktisch jedes Wort verstehen konnte und dass die alternde Stimme eines José van Dam in der kräftezehrenden Partie des Sachs sich nicht mühselig von Einsatz zu Einsatz hangeln musste, sondern selbst in Würde und Grösse ihre klangfarblichen Qualitäten ausspielen konnte. Nicht einmal Peter Seiffert schien der Sache so recht zu trauen: Viel zu schnell war er nach seinen schönen Piano-Einsätzen wieder im sicheren Forte-Hafen seiner berauschenden Stimme angelangt.
Chor hervorragend eingestellt
Einen Walther wie ihn gibt es momentan keinen zweiten, aber auch die anderen überzeugten: Matti Salminen, luxuriös besetzt in der Rolle des Pogner, Rolf Haunstein als Kothner oder der junge Christoph Strehl als David. Petra-Maria Schnitzer fehlten hin und wieder ein wenig die Reserven, aber so makellos klar und intonationssicher singt nicht manche Eva, und das Quintett leitete sie wundervoll zart ein, um dieses zentrale Ensemble zu einem Gänsehaut-Moment des Abends werden zu lassen.
Das Orchester brillierte mit sehr schönen Einzelleistungen, bewies einen kompakten Klang und eine disziplinierte Umsetzung von Welser-Mösts Vorgaben, spielte an der Premiere allerdings noch nicht immer völlig homogen innerhalb der Register. Der Chor war wiederum hervorragend eingestellt und sang auch in der grossen Masse nie massig.
Mehr als alle anderen aber war Michael Volle die Entdeckung des Abends. In seinen bisherigen Zürcher Einsätzen hat er nicht immer richtig überzeugt, den Beckmesser aber füllte er nun mit grandiosem Format aus, gerade weil er ihn nicht zur Karikatur werden lässt, sondern stets nachvollziehbar bleibt, stets die passenden Zwischentöne trifft, die einen sicher nicht einfachen, aber im Grunde rechtschaffenen und in der sich abzeichnenden Niederlage zunehmend verzweifelten Charakter zeigen. Und dies nicht nur stimmlich begeisternd, sondern vom ersten bis zum letzten Moment auch schauspielerisch herausragend.
|

27. 11. 2003
Mit Gesundbeten gegen das Problem
Oper als Kammerspiel: Erstmals nach siebzehn Jahren werden Richard Wagners «Meistersinger von Nürnberg» in Zürich gespielt.
Von Thomas Meyer
In seiner Hamburger Inszenierung des Werks wagte Peter Konwitschny vor einem Jahr den Bruch. Er liess im Schlussmonolog des Hans Sachs beim «Ehrt Eure deutschen Meister» abbrechen und inszenierte eine Diskussion, die das Stück in Frage stellte. Danach erst wurde es zu Ende gespielt. Konwitschny setzte am gleichen Punkt an wie Wagner. Der hatte ebenfalls den Jubel nach Stolzings Preislied abgebrochen und dort seine Botschaft von der deutschen Kunst platziert, bevor er zu einem zweiten und letzten Jubeln ansetzte. In Hamburg wurde für einmal sogar in die Musik eingegriffen - ein Sakrileg geradezu.
Das wirkt wie Gesundbeten
Wagners «Die Meistersinger von Nürnberg» bleiben ein hinterfragwürdiges Stück, auch wenn Konwitschnys Lösung nicht einfach wiederholbar ist. In Zürich freilich wird mit Programmheft und Opernhaus-Magazin von vornherein gegen die Problematik argumentiert: Die Schlussansprache von Sachs sei keineswegs nationalistisch gemeint, und in Beckmesser, dieser Karikatur des Wiener Musikkritikers Eduard Hanslick, habe Wagner keinen Juden gesehen, sondern den «Deutschen in seinem wahren Wesen». Das wirkt wie ein Gesundbeten, um einer in diesen Punkten garantiert unkritischen Inszenierung den Boden zu bereiten.
Wie singt doch Hans Sachs? Der Künstler stelle sich die Regeln selber und folge ihnen dann. Regisseur Nikolaus Lehnhoff jedenfalls übt sich geradezu in Abstinenz von jeder sowohl wagnerschen als auch antiwagnerschen Ideologie, er setzt auf die Story und die Konflikte zwischen den Personen um Liebe und Kunst, um bürgerliche Tradition und Innovation. Erzählt ist diese Oper ziemlich schlüssig, zuweilen fast als Kammerspiel. Die Personenführung überzeugt, weil sie die Sänger wenig zwängt. Bei heiklen Massenszenen lenkt die Regie mehr oder weniger geschickt, aber immerhin auf fantasievolle Weise ab: Geprügelt wird in Zeitlupe und in einem weichzeichnenden Dämmerlicht. Der Aufmarsch der Zünfte ist ein buntes, karnevaleskes Treiben, und überhaupt macht Lehnhoff aus der Prachtfeierlichkeit des Schlusses eher ein volkstümliches Allmendfest. Heterogen dazu die Mittel: die Kostüme von Moidele Bickel und Amélie Haas sowie das Bühnenbild von Roland Aeschlimann. Naturalistisch die Kirche des 1. Akts, atmosphärisch die Johannisnacht, symbolträchtig Bücherberg und Bienenwabenmuster der Tapete im Studierzimmer des Hans Sachs. Das schafft Assoziationsräume, die nicht einengen, die eine Spur Alltäglichkeit zulassen.
Die Menschen werden mit ihren Stärken und Schwächen gezeigt. Man schaut Charakteren zu. Wenn der Junker Stolzing in der Kirche nach Eva sucht, gleicht er einer Katze, die in alle Höhlen guckt. Neugierig besteigt er ebenso die Kanzel wie später den Merkerstuhl. Da ist einer sich und seiner Weltanschauung sicher. Peter Seiffert kann in dieser Rolle auftrumpfen, und er tut es stimmlich überzeugend, aber er lässt auch jene Portion trotziger Ablehnung spüren, die den Meistersingern zunächst so missfällt. Die Eva von Petra-Maria Schnitzer (deutlich, aber zuweilen etwas scharf in den Höhen) schwankt in ihren Gefühlen für Sachs; der Veit Pogner von Matti Salminen ist ein liebevoller, aber etwas unbeweglicher Vater. Und Sachsens so lebensfroher Lehrbub David, der Jungfer Lene (Brigitte Pinter) liebt, neigt je nachdem zu Servilität oder zu einer besserwisserischen Arroganz. Christoph Strehls Darstellung ist vokal und szenisch ein Höhepunkt dieser Inszenierung.
Den Gegensatz zu diesen Figuren bildet eben Hans Sachs: ein sehr ruhiger, weiser Mann, der auch Züge der Ermattung, ja der Depression mit sich trägt, der überzeugen, nicht überreden will und der so keine wuchtige Ausstrahlung anstrebt. Mit Ernsthaftigkeit gibt José van Dam diesen alternden Mann, der auf unscheinbare Weise geradezu alles um sich drehen lässt: Er ist kein Blender - was auch seinen Schlussmonolog wohltuend prägt. Vermissen wir da doch etwas? Es ist halt die Konsequenz aus dieser Inszenierung, die nicht auf Charisma, sondern auf menschliche Regung angelegt ist. Das ist «konventionell», aber nicht auf plakative Weise. Zu viele Fragen sind gestellt, zu viele Gefühle sind angesprochen, als dass der Jubel zum Schluss ganz frei davon wäre. Der Zweifel ist implantiert.
Das stimmt auch für die Musik. Was die «Meistersinger»-Partitur so faszinierend macht, ist die Verbindung von Schwung und Nachdenklichkeit, die auch das Thema des Stücks ist: Auf der einen Ebene: Sollen wir die Tradition bewahren, sollen wir sie durchbrechen, und was verlieren wir dabei? Auf der anderen: Läuft uns die Zeit, das Leben davon? Diese Konflikte rücken hier wieder ins Zentrum. Damit ist auch Wagners Kompositionstechnik durchsetzt. Die Leitmotive sind mehr als gesetzte Chiffren, sie sind Erinnerungsmotive; die Montagetechnik ist nicht mechanisch, sie pulsiert. Franz Welser- Möst arbeitet diese Elemente mit dem Orchester der Oper deutlich heraus, er lässt Nebenstimmen und Details hören, die oft untergehen. Noch nicht immer gelingt es ihm dabei, den Schwung zu bewahren, aber die wichtigsten Eigenschaften werden schon in den ersten Sekunden des Vorspiels hörbar: zügige Tempi und ein warmer Klang.
Eigenständig in seinem Wahn
Und der Beckmesser? Dem Kritiker das letzte Wort. Dieser Beckmesser ist zumindest eigenständig in seinem Wahn, eine durchaus boshafte Figur, gross gewachsen und gut gekleidet, mit einer überheblichen Eleganz gar auftretend, ein Bürgerlicher aus den Reihen der «Meistersinger», der bis zuletzt an sich selber glaubt. Kein Knicker, selbst in der Niederlage nicht: Man wird auf ihn zurückkommen müssen. Michael Volle macht die Rolle zum Ereignis.
PS: Der Vorstellung dauerte bei der Premiere mitsamt Pausen sechs Stunden.
|

27. 11. 2003
«Meistersinger» mit Sängertriumph
Premiere von Richard Wagners «Die Meistersinger von Nürnberg» im Opernhaus Zürich
Es ist einfach wie ein Wunder. Da plant Richard Wagner nach seinem harmonisch so revolutionären «Tristan» eine Komische Oper und macht daraus ein exorbitant langes, mit den Pausen fast sechsstündiges durchkomponiertes Lustspiel-Meisterwerk: die «Meistersinger von Nürnberg». Und wäre da nicht die Komik, die Regisseur Nikolaus Lehnhoff mit brillanter Personenführung subtil, aber deutlich auszudrücken vermag, dieser «deutsche» Kunststreit um traditionelle Regeln und progressive Gefühlskunst wäre unerträglich. Die neue Zürcher Produktion der «Meistersinger» unter der musikalischen Leitung von Franz Welser-Möst wurde an der Premiere vom Dienstag zu einem Sängertriumph ersten Ranges.
Bester Wagner-Tenor seit Jahrzehnten
Endlich, endlich wieder ein Wagner-Tenor, der diesen Namen verdient! In der Rolle des intuitiv die Regeln der Meistersinger-Kunst erneuernden Ritters Walther von Stolzing sang Peter Seiffert seine Seele aus dem Leib. Mit grossartigen Steigerungen beseelte er die weitatmigen Phrasen, wagte dabei das Orgiastische und behielt doch immer die Kontrolle über seine Stimme. Diese Technik, gepaart mit solcher Ausdruckskraft, Diktion und Musikalität ist unerhört. Dazu kommt die Bühnenpräsenz und das physische Stehvermögen, um nach über vier Stunden höchst exponiert die neue Meisterweise zum Besten zu geben und damit im Wettstreit zu siegen. Einen solchen heldischen Tenor wie Peter Seiffert gab es seit Jahrzehnten nicht mehr.
Das musste einfach zuerst gesagt werden, doch nun genug des Schwärmens. «Die Meistersinger von Nürnberg» ist Wagners einzige Oper mit ausschliesslich normalen, wenn auch sehr kunstsinnigen Menschen. Die Mythologie darf für einmal ruhen. Regisseur Nikolaus Lehnhoff stammt aus der Schule des Wagner-Regie-Erneuerers Wieland Wagner, an dessen revolutionäre «Meistersinger»-Produktion von 1956 in Bayreuth Lehnhoff mit subtilen Zitaten anknüpft. Gleichzeitig aber spürt man seiner szenischen Sprache an, dass er manch wichtige moderne Oper wie Rudolf Kelterborns «Kirschgarten», Wolfgang Rihms «Lenz» oder Hans Werner Henzes «Prinz von Homburg» erfolgreich inszeniert hat.
Lehnhoff findet eine stimmige Balance zwischen konventionell historischer «Nürnberger»-Biederkeit und modernem Outfit. So wird der 1. Akt, in dem die Prüfung für die Aufnahme in die Meistersinger-Zunft und damit die erste Konfrontation des in Evchen verliebten Ritters mit dem die Fehler zählenden Beckmesser stattfindet, mit historischen Kostümen, strengen Meister-Hüten und mit durch Wipptüren verschlossenen Richterstühlen ausgestattet. Der zweite Akt mit dem im Freien schusternden einsamen Hans Sachs, der Beckmessers Ständchen und dessen «Fehler» mit Hammerschlägen auf die Schuhsolen lautstark stört, taucht diesen in ein samtenes Nachtblau. Damit kommt das berühmte Wieland-Wagner-Bild von 1956 wieder zum Zug, auch wenn dessen zwei im Raum schwebenden Holunderdolden hier durch eine silberne Blätterkugel ersetzt werden. Eine grosse Treppe ermöglicht dem Chor, der die nächtliche Ruhestörung durch Sachs und Beckmesser mit einer Prügelei quittiert, von oben nach unten zu den Protagonisten zu strömen und sie so regelrecht im Tumult zu ertränken. Das Licht lässt die Konturen dieser Prügelei verschwimmen, das Chaos wird versinnbildlicht.
Sachs eher Bücher- als Naturweiser
Im dritten Akt betont Lehnhoff die Weisheit des Hans Sachs, der als Einziger die künstlerische Qualität des jungen Ritters erkennt, indem er in der Schusterstube einen ganzen Berg von Büchern auftürmt. Das irritiert etwas, ist Sachs doch nicht der Bücherweise, sondern eben der Naturweise. Auch erinnert dieser unordentliche Bücherberg an die verheerende Bücherverbrennung der Nazis. Interessant ist dann jedoch der Effekt im Übergang zur Sängerwiese, tragen doch die Leute alle Bücher eigenhändig fort, um das Podest für den Wettstreit frei zu bekommen. Dies symbolisiert sehr schön das «Wegtragen» der Bücherweisheit, um der freien Kunst Platz zu machen. Und das Volk, welches danach im Halbrund sitzt und zuhört, ist in moderne Kostüme gekleidet - wir sind im Heute angekommen. Die tierischen Dämonen, die Lehnhoff hier zuerst zur Volksbelustigung auftreten lässt, wirken zwar etwas deplaziert, doch symbolisieren sie wohl den niederen sinnlichen Trieb, der allein eben nicht Kunst ist.
In dieser konventionellen, aber doch stimmigen Ausstattung des Schweizer Bühnenbildners Roland Aeschlimann und in den schönen Kostümen von Moidele Bickel und Amélie Haas werden die Protagonisten und die Volksmassen bis ins Detail charakteristisch geführt. So ähnlich sich die Meistersinger und Regelhüter sind, jeder bewegt sich mit typischen Gesten des Gehabes, des Protestes, des die heiligen Regeln hochhaltenden Menschen. In diesem Kreis des Protests wird der als betont alt und weise gezeichnete Hans Sachs zum Ruhepol. Er bleibt als einziger sitzen, bricht beim Gesang des jungen Ritters nicht in Protest aus und sinniert ihm nach.
Christoph Strehl mit brillantem Rollendebut
José van Dam spielt und singt den Sachs mit rührig menschlichem Schmelz und farbenreichem Timbre, dies aber ausgesprochen introvertiert - der robuste Handwerker tritt ganz hinter den weisen Kunstkenner zurück. Dass sich Evchen zuerst in ihn, diesen alten Weisen, vergucken soll, wirkt dadurch aufgesetzt. Ähnliches passiert auch bei der so altbacken dargestellten Amme Magdalene (Brigitte Pinter), die als Liebhaberin des schmucken und agilen Lehrbuben David überhaupt nicht passt. Pinter singt diese Partie zudem mit einem etwas forcierten Flimmern in der Stimme. Sachsens Lehrbub David jedoch gibt der Tenor Christoph Strehl mit frischem Temperament und jugendlicher Agilität auch in der Stimme - ein brillantes Rollendebüt.
Zentral ist in dieser Regie, dass die Kritiker-Karikatur Beckmesser so ernsthaft und echt dargestellt wird. Michael Volle gelingt es dabei, die musikalische Ständchen-Posse mit echtem Ernst zu geben, und gleichzeitig als gut aussehender junger Mann doch ein valabler Freier-Konkurrent zu Stolzing zu sein. Seine schauspielerische Leistung ist seiner sängerischen ebenbürtig. Viel Applaus gab es auch für Matti Salminen als Goldschmied Pogner, der in seinen im Vergleich wenigen Auftritten stimmlich und szenisch ein markantes Profil gewann. Daneben wirkte das Evchen von Petra-Maria Schnitzer zwar schön gesungen, aber zu farblos in ihren bewegendsten Momenten.
Welser-Möst betonte rhythmische Komponente
Dass dieser so exorbitant lange Opernabend überhaupt nicht ermüdete und im Gegenteil die Spannung und die Aufmerksamkeit bis zum Schluss anstieg, das war auch das Verdienst von Franz Welser-Möst und dem Opernorchester. Sein eher schnelles Tempo hatte zwar einige Koordinationsprobleme mit der Bühne zur Folge, vor allem in der Doppel-Fuge des sich prügelnden Chores und in Hans Sachs' berühmten Schlussworten zur hohen deutschen Kunst, doch der dramaturgische und eher linear gedachte Zug war brillant. Der grosse Chor (Einstudierung Jürg Hämmerli) beeindruckte sonst mit ausgesprochen weichem und homogenem Klang.
Trotz einigen im Orchester klanglich sehr schön aufblühenden Momenten im Bezug auf die Gefühle von Sachs und Stolzing betonte Welser-Möst die rhythmische Komponente sehr stark, was vor allem auch in der musikalischen Komik des Beckmesser-Ständchens gar trocken und hart daherkam. So ernst und scharf ist das doch nicht, es ist ja eine Komödie. Die unerhörte Konzentration des Orchesters, dessen Sinn für die faszinierenden Farbmischungen der Instrumentation und die treffsicher eingelösten musikalischen Pointen der Partitur machten diesen Premierenabend zu einem herzerfrischenden und tief bewegenden Ereignis.
Sibylle Ehrismann
|
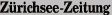
27. 11. 2003
Subtiles, detailreiches Musizieren
Dank Franz Welser-Möst strahlt das Zürcher Opernhaus mit seinen Wagner-Produktionen hell in die Welt hinaus. «Die Meistersinger» wurden wiederum zum Musik- und Sängerfest, während die Inszenierung von Nikolaus Lehnhoff im Grossen unentschieden, im Kleinen präzis gearbeitet war.
REINMAR WAGNER
«Heil'ge deutsche Kunst!» Einen fatalen Satz hat Richard Wagner da gedichtet. Erst gings mit der deutschen Kunst ab in den zweifelhaften Olymp der Nürnberger Parteitage, und solcherart befleckt, blieb stets ein grosses Misstrauen und Unbehagen diesem Stück gegenüber, das soweit ging, dass man die «Meistersinger» stets verteidigen musste, wenn man sie auf die Bühne brachte, oder - wie kürzlich Peter Konwitschny in Hamburg - das Pathos der Schlussszene durch Zwischenrufe und inszenierte Polemiken zu durchbrechen suchte.
Harmonische Raffinesse
Richard Wagner kann nichts dafür - schlimmer noch: Hatte er nicht Recht? Seit seiner Arbeit am «Tannhäuser» hat er sich mit dem «Meistersinger»-Stoff beschäftigt und schliesslich in den 1860er Jahren die Oper fertiggestellt. Gegen «welschen Tand» schimpft Hans Sachs auf der viel geschmähten Festwiese, und wenn man denn vergleicht, was in Italien oder Frankreich in der gleichen Zeit entstanden ist, - Verdis «Forza» und «Don Carlos», Gounods «Roméo et Juliette» und Thomas' «Hamlet» -, dann war Wagner doch wohl ein anderes Kaliber, dann hat seine Musik, in jeder Beziehung - harmonische Raffinesse, orchestrale Klangfarben, kunstvolle Kontrapunktik - Massstäbe gesetzt, die in Frankreich erst von Debussy und in Italien teilweise im Verismo, teilweise bis nach dem Ersten Weltkrieg gar nicht erreicht wurden.
Und Wagner blieb nicht bei der Behauptung. Das eigentliche Sujet der «Meistersinger» ist nichts anderes als die emotionale und kompositorische Überlegenheit seiner musikalischen («Tristan»)-Sphären über die Kunsthandwerker rundherum. Walthers Preislied setzt sich über alle Regeln hinweg - und gewinnt dennoch, auch weil Hans Sachs, der Doyen der Nürnberger Meistersinger, dessen Grösse erkennt und ihr zum Durchbruch verhilft. Wagner hat sich mit beiden Figuren ein bisschen identifiziert, den Beckmesser hingegen als Juden zu sehen ist ein (gewolltes) Missverständnis, allenfalls stand der Wiener Kritiker Eduard Hanslick Pate oder allgemein das «wahre deutsche Wesen», wie Wagner sich Cosima gegenüber 1873 ausdrückte.
Schinkel-Schinken
Nikolaus Lehnhoff, der Regisseur dieser aufwändigen Zürcher Inszenierung, sieht die Verhältnisse ähnlich. Karl Friedrich Schinkels Monumentalgemälde «Blick in Griechenlands Blüte» ziert das Schlussbild (Bühnenbild: Roland Aeschlimann), während die Meistersinger in einer unentschiedenen Mischung aus Zunftverein und Karnevalsclique aufmarschieren. Rosenmontag statt Nazi-Parteitag, und Lehnhoff bricht das Pathos nicht. Dass er den ersten Akt ins Mittelalter versetzt, trägt nichts zum Verständnis des Zusammenhangs bei, im Gegenteil, erst einmal schockiert das biedere Bühnenbild mit einer monumentalen Kanzel, bis die Inszenierung an Fahrt gewinnt und sich Lehnhoffs Detailtreue durchsetzt und seine solide Regiearbeit lebendiges, kurzweiliges Theater ergibt, selbst dort, wo es gilt, haufenweise verschiedenen Figuren unauffällig zu arrangieren. Die Lebendigkeit und Natürlichkeit seiner Personenführung ist Lehnhoffs erste Qualität, die zweite, dass er der Musik nicht im Weg steht. Für wichtige Auftritte holt er die Sänger stets unauffällig an die Rampe, hält sie aber auch dort in subtiler Bewegung, so dass nie der Eindruck von Statik entsteht.
Musikalischer Höhenflug
Damit ist schon die erste Bedingung für den musikalischen Höhenflug erfüllt, die zweite sind die Sänger und die dritte, vielleicht entscheidenste ist der Dirigent: Franz Welser-Möst polarisiert mit seinen Wagner-Dirigaten. Es gibt Zuhörer, welche die stundenlangen Klangorgien vermissen. Aber um wie viel mehr gibt er uns mit seinem subtilen, detailreichen Musizieren! Keine Linie im polyphon geführten Orchester geht verloren, alle Klangfarbe dürfen heraustreten, die Traumsequenzen des zweiten Akts sind von wirklich traumhafter Durchsichtigkeit. Und jeder Aufschwung ist aufgebaut: Welser-Möst hat etwas kapiert, was selbst manche der allergrössten Pultstars nie verstehen werden: Ein Fortissimo ist nicht umso kräftiger, je lauter es dröhnt, sondern je grösser der Unterschied zum Vorher ist. Aus dem Piano kommen Wucht und Wirkung.
Und das ist noch nicht alles. Bis auf Peter Seiffert und Matti Salminen sangen in Zürich nicht die Gigantenstimmen, die von Wagner-Produktion zu Wagner-Produktion weitergereicht werden, sondern zahlreiche Ensemblemitglieder, die man nicht von vorneherein in dieses Repertoire steckt. Keiner unter ihnen ging unter in den Klangwogen, allen rollte Franz Welser-Möst den roten Teppich eines kammermusikalisch aufgelockerten Klangbilds aus, mit dem überaus angenehmen Effekt, dass man praktisch jedes Wort verstehen konnte und dass die alternde Stimme eines José van Dam in der kräftezehrenden Partie des Sachs sich nicht mühsam von Einsatz zu Einsatz hangeln musste, sondern selbst in Würde und Grösse ihre klangfarblichen Qualitäten ausspielen konnte. Nicht einmal Peter Seiffert schien der Sache so recht zu trauen: Viel zu schnell war er nach seinen schönen Piano-Einsätzen wieder im sicheren Forte-Hafen seiner berauschenden Stimme angelangt .
Einen Walther wie ihn gibt es momentan keinen zweiten, aber auch die anderen überzeugten: Matti Salminen, luxuriös besetzt in der Rolle des Pogner, Rolf Haunstein als Kothner oder der junge Christoph Strehl als David. Petra-Maria Schnitzer fehlten hin und wieder ein wenig die Reserven, aber so makellos klar und intonationssicher singt nicht manche Eva, und das Quintett leitete sie wundervoll zart ein, um dieses zentrale Ensemble - wieder unter Welser-Mösts subtiler Anleitung - zu einem Gänsehaut-Moment des Abends werden zu lassen. Das Orchester brillierte mit sehr schönen Einzelleistungen, bewies einen kompakten Klang und eine disziplinierte Umsetzung von Welser-Mösts Vorgaben, spielte an der Premiere allerdings noch nicht immer völlig homogen innerhalb der Register. Der Chor war wiederum hervorragend eingestellt und sang auch in der grossen Masse nie massig.
Die Entdeckung des Abends
Noch mehr als alle anderen aber war für mich Michael Volle die Entdeckung des Abends. In seinen bisherigen Zürcher Einsätzen hat er nicht immer richtig überzeugt, den Beckmesser aber füllte er nun mit grandiosem Format aus, gerade weil er ihn nicht zur Karikatur werden lässt, sondern stets nachvollziehbar bleibt, stets die passenden Zwischentöne trifft, die einen sicher nicht einfachen, aber im Grunde rechtschaffenen und in der sich abzeichnenden Niederlage zunehmend verzweifelten Charakter zeigen. Und dies nicht nur stimmlich begeisternd, sondern vom ersten bis zum letzten Moment auch schauspielerisch herausragend.
|

27. 11. 2003
(…)
Dass Wagners "Meistersinger" in Nürnberg zu Hause sind, verweigerte Nikolaus Lehnhoffs Neuinszenierung für das Opernhaus Zürich mit Konsequenz. Das karge Holzgestühl im ersten Akt, auf dem die Meister Platz nehmen dürfen, um dem Probegesang des Ritters Stolzing zu lauschen, hätte zu manch' anderer Oper gepasst. Immerhin: Das Publikum darf und soll lachen. Zürichs neue "Meistersinger" erinnern optisch an die Kargheit von Wieland Wagners - dessen Assistent Lehnhoffeinst war - Bayreuther Inszenierung. Statt mit überladener Bühne zu protzen, siedelte Lehnhoff das Stück in einem Niemandsland an. Die Festwiese wird beherrscht von einem riesigen Prospekt, der wohl daran erinnern soll, dass die Wiege unserer gesamteuropäischen Kultur in Griechenland stand. Dazu Satyr-Spiele (Choreographie: Denni Sayers) und ungezwungene, nur scheinbar uninszenierte Ausgelassenheit. Ein Event fürs Volk und nicht nur für ein paar Auserwählte. Lehnhoff hat Wagners "Meistersinger"-Visionen zwar erkannt - musste aber letztlich am Text scheitern..Auch Dirigent Franz Welser-Möst versuchte immer wieder, die Musik vom Pomp zu befreien, sie neu zu hören: spontaner, ehrlicher, aufregender hat man die vielen Facetten dieser grandiosen Partitur selten gehört. Dazu drei prächtige Rollendebüts: Petra-Maria Schnitzer (Eva), Christoph Strehl (David), vor allem aber Michael Volle, der als Beckmesser trotz herrlichster Stimme einmal so richtig unsympathisch sein durfte: ein arroganter Yuppie, nichts dahinter, zeitgemäß. Auch auf Peter Seiffert (Stolzing) und Matti Salminen (Pogner) war Verlass. Nur José van Dam enttäuschte. Hans Sachs ist kein langweiliger Aussenseiter. Er ist das Zentrum des Stücks. Aber das fehlte diesmal.
V. Boser
|
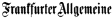
27. 11. 2003
Heute stehst du in der Oper an der Kasse
Blick in Schweizerlands Blüte: Nichts erinnert bei der Zürcher "Meistersinger"-Premiere mehr an die Revolte vor zwanzig Jahren
(…)
Als das Opernhaus im Dezember 1984 wiedereröffnet wurde, herrschte Belagerungszustand. Ein immenses Aufgebot martialisch ausstaffierter Polizei mit Helm, Hund, Gewehr und Schilden aus - Handwerk hat goldenen Boden - Korbgeflecht sorgte für perfekte Absicherung. Um das Haus herum blieb es ruhig, dafür gingen in anderen Regionen der Innenstadt Schaufensterscheiben zu Bruch. Doch die ganz grosse Schlacht immerhin hatte nicht stattgefunden, mancher Dampf war wohl vorher abgelassen worden. Und Claus Helmut Dreses "Meistersinger"-Inszenierung konnte als Einlenken verstanden werden: die Meister als boshafte Karikaturen verknöcherter Altvorderer, unfähig, Jüngere zu verstehen, die nächtliche Prügelei durchaus mit Anspielungen an den Limmatquai.
Nun gab es wieder "Die Meistersinger". Doch diesmal herrschte wieder ungetrübtes Einverständnis: als habe es zwischen Stadt und Stück nie Analogien im Streit zwischen Alt und Jung, exzessive kollektive Gewalt gegeben. Wagners Werk, durchaus politischer Implikationen voll, schien auf die Frage reduziert: Wieviel Kunst braucht das Land, und wie könnte sie aussehen? Nikolaus Lehnhoff ist eine schöne, ausgewogen-lockere Inszenierung gelungen, ganz ohne krassere Seitenblicke, gar -hiebe; an Nel (Frankfurt), Neuenfels (Stuttgart) oder Konwitschny (Hamburg) darf man nicht denken. Und mit immerhin Pathos vermeidender Lässigkeit wird das Stück über weite Strecken als das Lustspiel serviert, das in ihm steckt, und auf Zeitreise geschickt: beginnend in der Renaissance mit Wämsern. Pluderhosen und Kappen, schon beunruhigender in der Belle Epoque, mit Bratenröcken und Zylindern an Dreses Zürcher Gottfried-Keller-Welt erinnernd, doch der Nachtwächter erscheint als Ritter-Phantom - und mündend in die Gegenwart.Der Bühnenbildner Roland Äschlimann hat dabei zusätzlich Zitate montiert: Die Johannisnacht wird mit einer riesig-magischen Blütenkugel nach dem Vorbild von Wieland Wagners Bayreuther Modell von 1956 drapiert. In der Schusterstube des Poeten erinnert ein Bücherberg an einen Topos Herbert Wernickes - und als Finaltableau dient Schinkels "Blick in Griechenlands Blüte", eine arkadische Landschaft mit antikischer Kunstaktivität. In diese sinniert der gefeierte Sachs, mit dem Rücken zum Publikum auf einem Säulenstumpf stehend: An die Stelle nationaler Beschwörung tritt versöhnlich-verklärender Rückblick. Nichts, aber auch gar nichts erinnert mehr an Revolten irgendwelcher Art. Und die wie meist erlesenen Kostüme Moidele Bickels legen das Ganze vollends aufs Schaubühnen-Design seliger Zeiten fest. Musikalisch ist die Aufführung lebhafter: Franz Weiser-Most akzentuiert den Komödienton, nimmt schon das Vorspiel beschwingt, wahrt das Tempo im E-Dur-Teil, bei fast stufendynamisch abgesenkter Lautstärke, verzichtet auch beim "Wach auf"-Chor auf die Giga-Fermaten der Furtwängler-Knappertsbusch-Tradition. Man hört manches neu, begreift, dies auch ein Verdienst Lehnhoffs, daß die Art, wie David Stolzing examiniert, verblüffend den Dialog Parsifal-Gurnemanz vorwegnimmt. José van Dam ist ein souverän-abgeklärter Sachs, ohne unangebrachte, ihm auch nicht mehr zu Gebote stehende Stentor-Töne, Peter Seiffert ein unermüdlich strahlkräftiger Stolzing, Michael Volle ein dunkel markanter Beckmesser, Matti Salminen ein gewohnt sonorer Pogner. Eine runde Aufführung, der weniger Unbefangenheit gut täte.
G. R. Koch
|

28. 11. 2003
Fein gepflegt und entpolitisiert
Als 1984 mit Richard Wagners "Meistersingern" das teuer renovierte Zürcher Opernhaus eingeweiht wurde, gab es Straßenschlachten von Aktivisten der Off-Gegenkultur. Als wolle er diese Erinnerung tilgen und die katastrophale Rezeptionsgeschichte der Oper gleich noch dazu, inszenierte Nikolaus Lehnhoff jetzt total entpolitisiert. Dafür ist José van Dam als Sachs ein ganz großer Sänger-Darsteller. Ähnliche Bühnenpräsenz und ein vergleichbares Stimmpotential lässt sich nur noch Matti Salminen (Pogner) und Michael Volle (Beckmesser) attestieren. Nicht ganz so souverän Peter Seiffert als Stolzing, der zumal beim Preislied mit Höhenproblemen zu kämpfen hatte, und Petra-Maria Schnitzer, die als Eva recht farblos blieb. Star derAufführung war Franz Welser-Möst am Pult des Zürcher Opernorchesters. Seine absolute Klarheit, sein fettfreier Interpretationsansatz, der bei diesem Werk schon einer politischen Willenserklärung gleich kommt, sein musikalischer Witz, der viel amüsanter war als die oft krampfigen Humor-Bemühungen der Regie - all dies machte Vergnügen. Ansonsten: Eine geschmackvolle Inszenierung von gepflegter Indifferenz.
|

2. 12. 2003
Humanistischer Faltenwurf in der Prospektidylle
Im Morgen kein Gestern: Nikolaus Lehnhoff inszeniert Richard Wagners "Meistersinger" in Zürich - unpolitisch, resignativ, privat
Von Götz Thieme
In Friedrich Nietzsches berühmter Paraphrase des "Meistersinger"-Vorspiels - sie stammt aus "Jenseits von Gut und Böse" - findet sich ein verblüffender Satz: "Diese Art Musik drückt am besten aus, was ich von den Deutschen halte: sie sind von vorgestern und von übermorgen - sie haben noch kein Heute." Im Jahr 2003 ringen die Deutschen immer noch um ihr Heute, vielleicht weil sie ihr Vorgestern und Gestern zu wenig verstanden haben - ein Name wie Martin Hohmann ist dafür Symptom, nicht mehr, nicht weniger. Mag sein, dass dieses Land nie seinen Frieden machen wird, machen darf mit der Zeit des Nationalsozialismus. In welchem Maße diese Auseinandersetzung allein die Deutschen selbst zu betreffen scheint, erfährt man durch Nikolaus Lehnhoffs Inszenierung von Richard Wagners "Meistersingern von Nürnberg" am Opernhaus Zürich.
Wenige Inszenierungen der letzten Jahre sind der fatalen Rezeptionsgeschichte des Werks als Reichsparteitagsoper ausgewichen, ob sie die szenisch thematisierten, wie Wolfgang Mehring in Nürnberg und Peter Konwitschny in Hamburg, oder sie wie Hans Neuenfels in Stuttgart als mitschwingenden Anhang, als geschichtliche Erfahrung in symbolhafte Bilder und Figuren einschlossen.
Neben Neuenfels" subtilem Schnitt in die Mentalität einer Nation wirft Lehnhoffs auf der Bildebene ähnliche Zürcher Zeitenreise nicht annähernd so tiefenscharfe Erkenntnismomente ab. Als ob der Regisseur glaubt, sich in der neutralen Schweiz (die so neutral nicht gewesen ist) dieser aus dem Werk erwachsenden Herausforderung nicht stellen zu müssen, hüllt er Szenen in historischen Faltenwurf (Bühnenbild Roland Aeschlimann, Kostüme Moidele Bickel). Im ersten Akt in den der Renaissance Dürers, im zweiten in den biedermeierlichen eines Spitzweg, oder auch des Vormärz, dazu als selbstgefällig sentimentales Zitat des Regisseurs, Wieland Wagners ehemaligem Assistenten, dessen Bayreuther Fliederkugel von 1956.
Die Festwiese des dritten Akts spielt in einem zeitgenössischen Arkadien, einem Amphitheater, das Menschen in hellen Polohemden, Leinenhosen besetzen, vor einer gemalten hellenischen Prospektidylle: Tempel, Säulen, Knaben. Allzu deutlich fingerweisende Humanismuskulisse, als solle sie Hans Sachs" Schlussansprache neutralisieren, seine Warnung vor den "üblen Streichen", der "falschen welschen Majestät", dem "welschen Dunst", sein Beschwören des "Deutschen und Echten".
Tatsächlich gewinnt Wagners Wendung - verlören wir auch alles, Politik, Systeme, Ordnungen, es bliebe doch die "heil"ge deutsche Kunst" - auf diese Weise weniger einen auftrumpfenden als einen resignativen Ton, als ob das Ende aller Politik, des Gesellschaftlichen längst besiegelt sei. Es ist fraglich, ob sich diese Nuancierung die Regie zugute halten darf, die zuvor schludrig, absichtslos die Figuren zugeschnitten hat - oder nicht eher der Sänger der zentralen Sachs-Figur. Nach über vierzig Berufsjahren singt der 63-jährige belgische Bassbariton José van Dam diese Partie mit einer bewundernswert sonoren und nobel geführten Stimme, klar artikulierend, nie den Gesangston verlassend und den Wortakzent in die musikalische Linie einbindend.
Natürlich hat das tiefe Register ein wenig an Substanz verloren, steht ihm nicht mehr restlose jugendliche Gespanntheit zur Projektion zu Gebote. Klug hält er sich zurück, auch wenn Franz Welser-Möst ihn mit dem Orchester übertönt. Er weiß, an welchen Stellen er präsent sein muss. Dann singt er mit berückender Zartheit, schmerzlich Eva anblickend, die Frau, die er liebt und die er doch dem jüngeren Stolzing lässt: "Mein Kind, von Tristan und Isolde kenn ich ein traurig Stück: Hans Sachs war klug, und wollte nichts von Herrn Markes Glück." Van Dams Sachs ist ein Mann, der die Jugendstürme hinter sich hat, ein resignativ Weiser, aber nicht verzagt depressiv. Ein ironischer Blick, eine dem Gegenüber leicht auf die Schulter gelegte Hand, eine sehnsuchtsvolle Angespanntheit der Brust, wenn Eva ihm die Arme um den Hals schlingt, sind sprechender als alle konzeptuelle Regie: Hier steht ein Meister, der - wäre er mutiger oder jünger - so wie Stolzing möglicherweise gleichfalls ein Nichtdazugehörender wäre, einer, der mit all seiner "armen Poeterei" ein Einzelner bliebe.
Zu diesem großen Singdarsteller gesellte sich ein Ensemble, das kaum ein Haus derzeit so aufzubieten vermag. Van Dam ebenbürtig als ein exzeptioneller Beckmesser debütierte in der Rolle Michael Volle: plastisch sprechend, fein singend, leichtfüßig spielend. Zugleich klug und doof, eitel und selbstironisch, täppisch und elegant. Die Pantomime in der Schusterstube zur geradezu filmischen Musik, so schwierig zu realisieren - und meist misslingend -, hat er sich als Traum- und Erinnerungswahnstanz choreografiert.
Der Dritte in diesem fulminanten Handwerkstrio war Christoph Strehl, der mit dem David debütierte und einen belehrte, dass die Rolle bei Mozarttenören besser aufgehoben ist als bei knödelnden Charaktertenören. Peter Seiffert sang den Stolzing souverän, blieb aber etwas zu selbstgewiss, Petra-Maria Schnitzer als Eva stimmte mit schönen Pianotönen das Quintett an.
Kein Zweifel, diese "Meistersinger" sind kein politisch garstig Lied. In der Tendenz zum Harmlosen schien der Dirigent Franz Welser-Möst fast zwei Akte der Szene zu folgen: trocken die Ouvertüre, mild brutal die Prügelfuge. Erst im dritten Akt knüpfte er das Motivgewebe atmosphärisch dichter, begleitete individueller und nahm kaltblütig heikle Stellen wie den "Wach-auf"-Chor. Bewundernswürdig auch das Orchester, das durch den schlanken hellen Ton der Holzbläser und Hörner eine französische Farbe einbrachte, kontrastiert von den athletisch-virtuosen Streichern.
|

1. 12. 2003
Opera: Die Meistersinger von Nürnberg
By Shirley Apthorp
Can Wagner's Die Meistersinger von Nürnberg be washed clean of all that happened to it during the 20th century? At least in the German-speaking world, few opera houses would dare to try.
But Nikolaus Lehnhoff's new Meistersinger dares to suggest that there's nothing to apologise for. It strips off the obligatory interpretative layers of recent years, presenting the piece as pure and worthy. Wagner's "holy German art", apparently, is about the independence of art from politics, about democracy and innovation and respect. Not about chauvinism or xenophobia.
This Meistersinger is visually stunning, beautifully crafted, detailed and never overdone. In the end it is also depressingly inconclusive. History happened, and it wil l take more than beauty to make us forget.
Peter Seiffert was a Rolls Royce of a Stolzing, his voice huge and unfettered, natural and free. Michael Volle was a revelation as Beckmesser, lithe and charismatic, delivering some of the evening's most beautiful singing.
To rob the role of its caricature is both subtly subversive and healing. Matti Salminen brought a vast paternal warmth to the role of Pogner, Christoph Strehl was a fresh-toned, winning David. Casting Jose van Dam as Hans Sachs could have been a coup a few years back; now it is a disappointment, however impressively he manages the remnants of his once-great voice.
Franz Welser-Möst began the overture briskly but infused the third act prelude with funereal gloom. Everything is thought through, often startlingly intimate, never bombastic. Presented like this, the music itself is the work's best defence against all charges.
|

