Aufführung
|

4. 12. 2004
(Première)
*
Musikalische Leitung: Christoph von Dohnányi
Inszenierung: David Pountney
Ausstattung: Robert Innes Hopkins
Video: Jane und Louise Wilson
Lichtgestaltung: Jürgen Hoffmann
Chor: Jürg Hämmerli
*
Senta: Eva Johansson
Holländer: Egils Silins
Daland: Matti Salminen
Erik: Rudolf Schasching
Mary: Irène Friedli
Steuermann: Christoph Strehl
SYNOPSIS - LIBRETTO - HIGHLIGHTS
|
Rezensionen
|
|
|
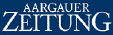
6. 12. 2004
Den flimmernden «Holländer» flach inszeniert
Aufgetakelt Richard Wagners «Fliegender Holländer» wird in Zürich mit zu viel Video-Kunst angereichert
Aus einer einzigen optischen Idee heraus lassen sich keine mythischen Geschichten erzählen und schon gar nicht erklären: David Pountneys Inszenierung von Wagners «Fliegendem Holländer» erleidet Schiffbruch.
Christian Berzins
Überall wird geklagt, wie dilettantisch Opern- und Theaterregisseure Videos benutzen - dass sie es tun, hat man hinzunehmen. Im Opernhaus Zürich steht nun eine flimmernde Video-Installation im Zentrum, die sonst im Guggenheim-Museum in Bilbao zu bewundern ist - anerkannte Videokunst also. Um sie herum hatte Inszenierung zu entstehen. Die knifflige Aufgabe hat sich Regisseur David Pountney selber gestellt: Er meint nämlich, dass diese Video-Arbeit von Jane und Louise Wilson perfekt ausdrückt, was in Wagners romantischer Oper «Der fliegende Holländer», in der ein Verdammter einen ihn erlösenden Engel sucht, geschieht. Wilsons «Star-City» zeigt Bilder aus einem ehemaligen sowjetischen Raumfahrtzen- trum: die Kamera huscht durch leere Büros und Korridore, Garderoben und Abschussrampen.
Robert Innes Hopkins hatte die Aufgabe, ein Bühnenbild zu bauen, das die Videos ins Zentrum stellt, aber doch zur Handlung der Oper passt. Er versucht, ein Schiff erkennbar zu machen, in dessen «Bug» Platz für die Leinwände ist. Da die Akustik in diesem Leinwandbug offenbar schlecht ist, agieren die Protagonisten meist vorne im leeren Raum oder auf dem Deck.
Und so flimmern während 135 Minuten flache, teilweise zusätzlich für die Inszenierung gefilmte Bilder an den Figuren vorbei. Das Geschehen wird damit nur selten effektvoll angereichert, sondern meist verdrängt. Es bleiben die grossen Fragen, die sich jedes Kind bei Wagners «Fliegendem Holländer» stellt: Wer ist dieser Holländer, der verflucht durch die Weltmeere jagt und nur von einer treuen Frau erlöst werden kann? Mensch oder Dämon? Und wer ist Senta? Eine Irre oder ein Engel? Pountney schweigt. Dass Matrosen derb sind, haben wir vorher schon gewusst; dass man, um das zu unterstreichen, zeigen muss, wie sie die Frauen des Dorfes vergewaltigen, scheint uns eher eine eigenartige Idee.
Buhs für das Regieteam
Gegen die Buhs für das Regieteam wollte sich bezeichnenderweise keine Opposition einstellen. Mehr Erfolg hatten die Interpreten, allen voran der Titelheld Egils Silins. Seine schwarze Sanftheit in den tiefen Lagen, seine so präzise Beherrschung der Höhen (nur ganz selten wird die Stimme etwas hart), seine dynamische Bandbreite sowie seine Diktion sind bewundernswert. Eva Johansson (Senta) ist keine Frau der leisen Töne, aber wenn sie ihre Schlussphrasen ins Rund schleudert, glaubt man ihr, dass sie dem Holländer ohne Zögern in die Fluten nachspringen wird.
Erfreulich gut sind die Nebenrollen besetzt: Christoph Strehl (Steuermann), Rudolf Schasching (Erik), Irène Friedli (Mary) und Matti Salminen (Daland) geben dank ihrer vokalen Präsenz den Figuren Gewicht. Etwas durchzogen bleibt der Eindruck vom Opernhaus Orchester unter Christoph von Dohnanyi: Ein trotziges Dirigat - rau wie der Nordwind. Doch schon in der Ouvertüre erschienen Passagen verwischt und zu wenig ausgearbeitet, die Dynamik war nicht eben Differenziertheit, Ungenauigkeiten schlichen sich den ganzen Abend ein.
Die letzte Zürcher «Holländer»-Inszenierung liegt nur gerade neun Jahre zurück. In der umstrittenen Arbeit von Ruth Berghaus hatte man vorgeführt bekommen, wie sehr man ein Stück deuten kann, indem man jede Figur genaustens zeichnet. Mit Pountneys Fixierung auf ein einziges optisches Hilfsmittel ist das nicht zu erreichen. Seine Arbeit ist so zeitgeistig, dass sie schon in weniger als neun Jahren alt aussehen wird. Wehmütig erinnern wir uns an Claus-Helmut Dreses Inszenierung aus den frühen 80er-Jahren zurück. Ausgehend von Wagners Text hatte er die Geschichte in traumschönen Bildern - zeitlos - erzählt. Nebenbei: Auch er hatte mit Projektionen gearbeitet.
|

6. 12. 2004
Romantik-Zappen
Opernhaus Zürich: Wagners «Fliegender Holländer»
SIGFRIED SCHIBLI
In zwei Stunden und zehn Minuten absolviert das Zürcher Opernhaus Richard Wagners erste von ihm für vollgültig genommene Oper: «Der fliegende Holländer». Mit einigem Mut zum Risiko.
Herausragende Inszenierungen sind für ein Theater nicht immer von Vorteil. Sie können ein Stück im Bewusstsein der Kenner und Liebhaber für Jahre gleichsam besetzt halten. So ergeht es dem Zürcher Opernhaus jetzt wohl mit Wagners «Fliegendem Holländer», den Ruth Berghaus vor etlichen Jahren in einer äusserst präzisen, die Personen bis ins Detail auslotenden Inszenierung vorgelegt hat. Jetzt hat der Bregenzer Festspiel-Chef David Pountney unter Zuhilfenahme eines Ausstatters und zweier Videokünstlerinnen (Robert Innes Hopkins, Jane und Louise Wilson) dasselbe versucht - und heraus kam eine zwar musikalisch fesselnde, aber bilderüberflutete, in der Feinzeichnung spannungsarme Produktion, in der man öfter die Personenführung vermisst.
Am genauesten gelingt dem Team noch die Zeichnung der Senta, einer manischen Künstlerin, die überall ein Auge hinmalt - Ausdruck ihrer egozentrischen Wahnvorstellung, von allen beobachtet zu werden. Eva Johannsson verkörpert das mit identifikatorischem Spiel und einer Stimme, die alle Höhen und Tiefen erklimmt, die klar und durchdringend und doch nicht allzu scharf klingt. Da weitgehend die einaktige Dresdner Erstfassung gegeben wird, bei der die Senta-Ballade in a-Moll steht (Wagner senkte sie später nach g-Moll), sind die sauberen Spitzentöne dieser Sängerin besonders hoch zu schätzen.
Bei den Männergestalten nimmt die Beschreibungsgenauigkeit der Regie ab, und die unentwegt und in postmoderner Beliebigkeit über die Leinwände flimmernden Videobilder können nicht verbergen, dass die Figuren in ihrer menschlichen Komplexität zu wenig ausgelotet werden. So singt der Steuermann (herrlich hell: Christoph Strehl) am Anfang ungerührt seine Ballade und fällt dann unmotiviert in Ohnmacht. Sentas Vater Daland (Matti Salminen) wirkt bei aller Jovialität eher steif; dabei sind Salminens Vertrautheit mit der Rolle und seine die Übertitel konkurrenzierende deutliche Diktion allemal ein Vorzug.
In der Titelpartie ist der früher am Theater Basel engagierte lettische Sänger Egils Silins zu erleben: ein differenziert geführter Bariton mit noblem Material, der sich in jeder Hinsicht von Daland abhebt. Doch bleibt unverständlich, weshalb der mephistohaft gezeichnete Holländer seinen ersten Monolog mit einer Triumphgeste beendet, während er doch von ewiger Verdammnis spricht. Da ist spürbar die Zeit für die Personenregie knapp geworden, während für die Ausstattung kein Aufwand zu gross war.
Stark gefordert ist in diesem Werk mit seinen markigen Matrosen- und reizenden Mädchenchören der Zürcher Opernchor, der einmal mehr eine längere Anlaufzeit braucht, bis er sich auf die Tempi des Dirigenten Christoph von Dohnányi eingestellt hat. Dieser hat mit dem Opernhausorchester ein vorzügliches Ensemble zur Verfügung, das seinen sehr exakten Vorstellungen jederzeit folgt. Dohnányi, der vor zehn Jahren eine glänzende CD-Aufnahme dieses Werks in der späteren dreiaktigen Fassung vorgelegt hat, hält wenig vom romantischen Zauber dieser Oper, viel dagegen von klarer Artikulation, sauberer Klangprofilierung und einer Ausleuchtung der Details wie etwa der Paukenschläge im Holländer-Monolog. Damit setzt er vielfach überraschende Akzente und beleuchtet manches psychologische Moment im Orchestersatz Wagners.
|

6. 12. 2004
Schau mir in die Augen
«Der fliegende Holländer» im Opernhaus Zürich
VON ROGER CAHN
Musikalisch ein Wurf, inhaltlich verstaubt: Richard Wagners «Der fliegende Holländer» spaltete das Premierenpublikum am Samstag im Zürcher Opernhaus. Stein des Anstosses ist wieder mal die Regie.
Die Musik kennt keine Schwächen: eindrückliche Leitmotive, herrliche Arien, mitreissende Chöre.
Die Handlung hat ihre Tücken. Der zum ewigen Reisen verdammte Holländer, Kapitän eines mystischen Schiffes, kann nur durch die Treue einer liebenden Gattin erlöst werden. Diese scheint in einem einsamen Ort an der norwegischen Küste auf ihn zu warten. Senta ist bereit, Doch die Wirklichkeit lässt ein glückliches Ende nicht zu. Senta stürzt sich ins Meer und feiert im Liebestod Auferstehung.
Der «Holländer» reizte Regisseur David Pountney zu gewagten Interpretationen. Bei ihm landet er per Video-Installation in einem Raumschiff. In diesem entschweben Senta und ihr Geliebter am Ende dann auch ins All. Durch die Grossprojektionen ihrer Gesichter gewinnt ihre Beziehung eine enorme Dichte: Holländer und Senta finden sich in ihren Traumbildern, zur wirklichen Vereinigung kommt es nicht.
An dieser Wirklichkeit aber scheitert die Inszenierung. Wo Wagner irdisches Glück und Behaglichkeit schildert, zeichnet Pountney wirre Bilder: Räume verschieben sich, Matrosen tanzen mit Girlies, die Spinnerinnen stöpseln in einer Schaltzentrale.
Das unruhige Regiekonzept erlaubt den Sängern, sich aufs Singen zu konzentrieren. Das ist auch nötig, Dirigent Christoph von Dohnányi lässt runden, vollen Wagner-Sound erschallen. Der muss erst einmal übersungen werden.
Eva Johansson (Senta) und Eigils Silins (Holländer) lösen die schwierige Aufgabe überzeugend. Dass bei diesem Musizieren feinere Töne auf der Strecke bleiben, wundert kaum.
Fazit: Da nimmt ein Regisseur den Werktitel einmal wörtlich und inszeniert den «Holländer» fliegend. Trotzdem funktionierts nicht.
|

6. 12. 2004
Endstation Raumbahnhof
David Pountney und Christoph von Dohnányi inszenieren Wagners «Fliegenden Holländer» am Opernhaus Zürich
Wie Weihnachtsengel schweben Senta und der Holländer mit ausgebreiteten Armen durch die projizierten Wassermassen: Erlöst im Kitsch, dem Schlusspunkt einer unfertig wirkenden Inszenierung. Einmal mehr zeigt sich, dass der Einsatz von Video noch keine Interpretation ergibt.
Tobias Gerosa
Worum geht es im «Fliegenden Holländer»? Regisseur David Pountney, der den Fliegenden Holländer schon auf der Seebühne der Bregenzer Festspiele inszenierte, hat sich für die Beantwortung dieser Frage vor allem auf die englischen Videokünstlerinnen Jane und Louise Wilson verlassen. Um gescheiterte Träume, wie sie sie in der technisierten Biederkeit ehemaliger sowjetischer Weltraumeinrichtungen aufgenommen haben, ist ihre erstaunliche Antwort.
Einsam dreht der Schwerelosigkeitssimulator, säuberlich aufgebahrt liegen Raumanzüge, in die kein Kosmonaut mehr steigen wird. Und das Wasser, in dem Senta und der Holländer ihre Erlösung suchen (und finden?), ist ein Trainingsbassin mit einem Mir-Modell. Nicht erst dieses Schlussbild ist schief. Vom filmisch gezeigten Unort fliegt niemand mehr ab, die Titelfigur in Richard Wagners romantischer Oper kann aber nicht ankommen, bevor sie eine Frau durch ewige Treue erlöst. Diesen Widerspruch löst Pountney nicht, sondern umspielt ihn in mehreren Ansätzen, die nicht zusammenfinden.
Kritik an Seefahrergesellschaft
Da ist zunächst die textnahe Ebene der Sage. Der spinnende Frauenchor beschäftigt sich zwar mit leuchtenden Glasfaserkabeln, doch bleiben das Äusserlichkeiten, wie die überzeichnete Volksszene im dritten Akt. Zwar singt der von Jürg Hämmerli gut vorbereitete Chor präzise und verständlich, doch die plötzliche Kritik an der machistischen Seefahrergesellschaft um den Steuermann Christoph Strehls wirkt aufgesetzt, nachdem der Patriarch Dalands ungebrochen und der bassgewaltige Matti Salminen szenisch unterfordert bleibt.
Der Holländer wird derart zur reinen Projektionsfläche, unbestimmt wie sein Blick, der während seines Monologs dreifach von den Leinwänden sticht. Daland und Senta (Eva Johansson mit differenzierter Gestaltung gerade in ihrer Ballade, aber auch mit einigen schneidend scharfen Tönen und relativ kleiner Textverständlichkeit) schauen neben ihm vorbei und durch ihn hindurch: Wie im Schwerelosigkeitssimulator kreisen sie umeinander, angezogen von geheimnisvollen Kräften, die auszudrücken die Regie ganz der Musik überlässt. Im kindlich vertrauten Verhältnis Sentas zu Erik fehlt dieses Geheimnis offensichtlich. Rudolf Schasching gestaltet das verzweifelte Unverständnis gegenüber diesem Mangel überzeugend.
Farbig, aber ohne Geheimnis
Und dann sind da die Videoprojektionen, neben dem Weltraumbahnhof immer wieder die Gesichter und vor allem Augen des Holländers und Sentas in Nahaufnahmen. Ihre Wirkung ist zunächst gross und im Duett vor der Verlobung durchaus überzeugend, nur können sie keine Personenführung ersetzen, wie es ihnen Pountney im Monolog des Holländers zumutet. Egils Silins steht und singt so farbig, textverständlich wie packend – und doch wirkt seine Figur weder unheimlich noch geheimnisvoll. Und dass die wie ein Schiffsbug spitz zulaufenden Wände immer wieder auf- und zugeschoben werden für einen neuen Blick aufs Video (Ausstattung: Robert Innes Hopkins), macht es ihm auch nicht gerade leichter.
Umso wichtiger wird die Unterstützung durch das Orchester. Christoph von Dohnányi leitet seinen ersten Wagner in Zürich und trägt die Solisten aufmerksam mit. Nie besteht die Gefahr, dass sie zugedeckt würden. Aufgeraut erscheint der Klang, durchsichtig und sehr plastisch. Dem Rausch versagt sich Dohnányi, und doch droht auch die Musik auseinander zu fallen, so antithetisch legt er sie schon in der Ouvertüre an. Nichts scheint zwischen dem wilden Meer und dem sehnsüchtigen Lyrizismus zu vermitteln – ein Ansatz, der szenisch nicht genügend aufgenommen mit zum heterogenen Eindruck beiträgt.
Trotz bedenkenswerten Ansätzen geht so das Ganze wenig auf. Den letzten Zürcher «Holländer» und Ruth Berghaus’ geheimnisvoll verstörende Interpretation von 1995 kann die aktuelle Neuinszenierung weder steigern noch vergessen machen.
|

6. 12. 2004
Werktreue und Treue zum Werk
Auch in den Videozitaten einer maroden Moderne bleibt der fliegende Holländer die Figur der Sage: Im Schrecken der Gegenwart lebt die alte Oper. David Pountneys Inszenierung sagt es in der Kollision der Bilder, Christoph von Dohnányis Dirigieren im direkten dramatischen Zugriff der Musik.
Herbert Büttiker
Eine «romantische Oper» hat Richard Wagner das Werk genannt – eine technisch kühle Welt konfrontiert die Zürcher Bühne mit der eher mythischen als realen Figur des Holländers, der, auf Erlösung hoffend, die Weltmeere durchfährt. Ein quadratisches Metallgerüst in der Höhe, begehbar, Schiebewände, Projektionsflächen, farbiges Licht und vor allem Videobilder mischen Robert Innes Hopkins (Ausstattung) und Jane und Louise Wilson (Video) in kaleidoskopartiger Bewegung zur Szenerie einer maroden Moderne. Die Gesichter der Protagonisten in Grossaufnahmen wechseln mit Aufnahmen aus einem sowjetischen Weltraum-Trainingszentrum mit rotierender Zentrifuge, Kommandozentrale, Astronautenanzügen, trostlosen Garderobenräumen. Dalands Matrosen tragen hier Pilotenkappen, und die Frauen in ihren grauen Schürzen arbeiten nicht an Spinnrädern, sondern an leuchtenden Kabeln. Die grosse Chorszene enthüllt brutal die kolossale Lieblosigkeit dieser Welt. Um mit den saufenden und im stampfenden Takt singenden Männern überhaupt anbändeln zu können, nähern sich die Frauen in hingebendem Tussi-Blond – und haben es prompt zu bereuen.
Liebe und Ironie
Der Holländer, der wie alle sieben Jahre hier den Boden betritt und schon sehr desillusioniert wieder sein Glück versucht, aber eigentlich nur noch auf sein Vergehen im Nichts hofft, kontrastiert seltsam zu dieser lemurenhaften Arbeitswelt, in der Daland wohl ein Parteibonze ist. Der verzweifelte Held passt im langen, schwarzen Mantel eher ins Klischee des romantischen Dämons als in die Realität der untergehenden Sowjetunion. Ungewiss ist am Ende – und das wohl mit Bedacht –, ob Liebe zu dieser genuinen Opernfigur oder Ironie die Phantasie des Regisseurs David Pountney beflügelt. Wenn der Holländer im Finale zusammen mit Senta, die nun im wehenden Weiss ebenfalls dem mythische Opernreich angehört, davonschwebend in den Seilen hängt, befinden auch wir uns in der Schwebe, misstrauen dem Erlösungskitsch (oder denken an Heine, von dem Wagner die Holländer-Geschichte ja hat) und hoffen zugleich, dass das Bild von der absoluten Liebe wahr ist.
Diese Inszenierung scheint (im Unterschied etwa zum «folternden Holländer» vom vergangenen Jahr in Luzern) durch alle komplexe ästhetische Zurichtung hindurch an den romantischen Wagner glauben zu wollen. Das ist – Wagner kann ja auch irritieren – vielleicht nicht zwingend, aber führt zu einem spannenden Umgang mit dieser Oper – und mit der Oper überhaupt. Denn was sich wie ein schon fast befremdlicher Rückgriff auf «Werktreue» – die Szenenanweisungen sind in diesem Finale genau befolgt – durchsetzt, ist auch die Bildlichkeit der guten alten Oper. Die Inszenierung rettet Wagners Imagination in eine und gegen eine Ästhetik der kruden Gegenwart. Die technisch-mediale Hochrüstung der Bühne hat ihre Parallele im Alltag der TV-Wirklichkeit, die heute den Blick auf mythisch klare Bilder zu versperren droht und herkömmliche Opernerzählungen so zu desavouieren scheint, dass «Werktreue» nicht mehr nur ein Stilproblem darstellt.
Beschwörung im Klang
Ob Treue zum Werk heute wirklich nur verbunden mit der radikalen Verfremdung zu haben ist, mag man sich fragen. Der Klang der nordischen Meereslandschaft findet in den Bildern der untergehenden Sowjetunion nur eine ungefähre Resonanz, und die phantastische Erscheinung des Geisterschiffes, die die Musik beschwört, bleibt blass. Unter den Händen von Christoph von Dohnányi, der für ein Musizieren unter Hochspannung sorgt, wird einem die «dramatische Ballade» allerdings im Klang mit aller wünschbaren Plastizität nahe gebracht. Das Orchester lässt keine Wünsche offen, und das Ensemble besitzt alle Qualitäten, um die Rollenbilder der Inszenierung zwischen ihrem romantischen und zeitkritischen Pol differenziert zu realisieren.
Der Chor, der auf der Zürcher Bühne mit Wucht und agiler Präzision über sich hinauswächst, steht ganz im Dienst der in den «Holländer» hineinprojizierten Bilderwelt und wird im uniformen Auftritt zum monströsen Menschenkörper. Dagegen betont Egils Silins in seiner statuarischen Erscheinung, die vom Spiel her wie von der kraftvoll düsteren Monochromie seiner Stimme gegeben ist, die Opernkonvention der auf sich selbst fixierten Figur jenseits der realen Menschenwelt. Um so greifbarer erscheinen Erik und Senta als wirkliches Liebespaar. Zu den faszinierenden Aspekten der Aufführung gehört, wie dieses ins dramatische Zentrum der Aufführung rückt und Sentas Wahl bis zum Schluss offen bleibt. Rudolf Schasching macht mit impulsiv deklamierendem Einsatz Erik zur gewichtigen Figur, und Eva Johansson zeigt mit stimmlicher Überlegenheit und schillerndem Spiel Eva als eine junge, ungestüme Frau voller Sehnsucht, aber auch voller Realitätssinn. Tief eingegraben in Matti Salminens Bass ist Dalands joviale Krämerseele. Mit prägnantem Einsatz runden Irène Friedlis Mary und Christoph Strehl ein packendes Holländer-Ensemble in einer schwierigen Inszenierung ab.
|

6. 12. 2004
«Ist sie Euch recht?»
«Der fliegende Holländer» im Opernhaus Zürich
Wagner in Paris, das war ein Moment der gescheiterten Ambition, der narzisstischen Verletzung und der Eifersucht. Unter abenteuerlichen Umständen war der damals 26-jährige Komponist 1839 mit seiner jungen Gattin Minna von Riga aus in die Capitale gekommen; dort und nur dort, so glaubte er, würde er reüssieren können. Doch alle Versuche, zu einem Auftrag der Opéra zu kommen, gingen schief, selbst das Projekt des «Fliegenden Holländers» fand keine Gnade, die Geldnot nahm bedenkliche Masse an. Vollkommen enttäuscht wandte sich Wagner nach knapp drei Jahren von der damaligen Hauptstadt der Musik ab und ging nach Deutschland zurück, um ein deutscher Komponist zu werden; die Schuldzuweisungen konzentrierten sich auf Meyerbeer, dem Wagner den Erfolg neidete und den er mangelnder Unterstützung bezichtigte.
Ein Männertraum
In diesem Licht kann man den «Fliegenden Holländer» verstehen - kann man zum Beispiel begreifen, warum dieses 1841 in der unglaublich kurzen Zeit von nur vier Monaten komponierte, allerdings auch noch reichlich konventionelle Stück von einer männlichen Egomanie kündet, wie sie von heute aus kaum mehr erträglich scheint. Die Rede ist hier ja von einem Seemann (in dem man durchaus Wagner sehen kann) und seinem Leiden; erst wenn sich eine Frau findet, die sich ihm voll und ganz ergibt, kommt er zur Erlösung. Die Frau findet sich, denn Daland, ein anderer Seemann, hat zufälligerweise eine Tochter, und die ist dem reichen Unbekannten rasch in die Ehe gegeben. Ob sie ihm recht sei, fragt Daland den Holländer nach der ersten Begegnung mit seiner Tochter. Senta wird um ihre Meinung erst gar nicht gebeten, was darum nicht so schlimm ist, weil sie dem Fremden ohnehin auf den ersten Blick verfallen ist.
Ein bisschen etwas von dieser eigenartigen Konstellation deutet die Inszenierung von Richard Wagners «Fliegendem Holländer» an, die David Pountney für das Opernhaus Zürich entworfen hat. Daland - Matti Salminen singt es mit ungebrochener Grösse, aber auch bemerkenswerter Agilität - erscheint als ein durchtriebener Geschäftsmann, der seinem Verhandlungspartner ganz und gar erbötig ist, um nur umso schneller ans Ziel zu gelangen. Alles hat er unter Kontrolle. Den jungen Seemann, den er mit aller Selbstverständlichkeit zur Wache abkommandiert (Christoph Strehl singt sein Lied dennoch schön entspannt). Die Amme Mary (Irène Friedli), die sich als Sekretärin zwischen Börsenkurven hin und her bewegt. Die Frauen überhaupt, die als blonde Girlies ihre Reize zeigen und von den nach Hause zurückgekommenen Seeleuten dementsprechend behandelt werden - der von Jürg Hämmerli einstudierte Chor des Opernhauses hat hier einen grossen Auftritt.
Auch seine Tochter Senta hat Daland im Griff - allerdings nur scheinbar und nur auf Zeit. Eindrücklich bringt Eva Johansson zur Geltung, wie sich Senta vom kleinen Mädchen, das einem Inbegriff von Mann nachträumt, über das schockartige Erwachen zur selbstbestimmten Frau wandelt. Und bemerkenswert, wie die Sängerin mit ihrem so ausgeprägten Timbre in die grosse Ballade des ersten Akts nicht nur sehnsüchtige, sondern auch fahle, zerbrechliche Töne mischt und wie sie dann in dem Moment, da sich Senta für den Fremden ins Meer stürzt, zur grossen Heroine wird. Den Holländer selbst gibt Egils Silins, der sich seit seinen Anfängen am Theater Basel prächtig entwickelt hat, als einen ganz auf sich bezogenen, ja in sich gefangenen Mann; kernig und klar konturiert klingt dieser Bass, dazu herrlich in der Tiefe verankert, aber nicht mit dem breiten Strich, über den Matti Salminen verfügt. Dass einer so viel Wirkung ausübt wie dieser Holländer, das kann der bodenständige Erik nicht begreifen - Rudolf Schasching, der hier als Pavarotti-Double erscheint (und dem szenischen Ansatz stimmlich sehr wohl zu genügen weiss), macht es mit seinem eigenen komischen Talent deutlich.
Doch über diese grobe Zeichnung hinaus beschränkt sich die Inszenierung auf die gefällig modernisierende, durchaus beliebig wirkende Illustration durch den Ausstatter Robert Innes Hopkins. Den Einheitsschauplatz bildet die Kante eines Würfels, was um so eher als Schiffsbug verstanden werden kann, als es auch einen ersten Stock gibt: eine Kommandobrücke oder ein Felsenriff, je nachdem. Wie im Traum ist da alles in Bewegung, wozu nicht zuletzt der Einsatz der Drehbühne sorgt. Die Wände selbst sind teils transparent gehalten, teils dienen sie als Bildschirme: für Videoaufnahmen, welche die Engländerinnen Jane und Louise Wilson unter anderem in russischen Raumfahrtszentren erstellt haben. Was das genau mit dem «Fliegenden Holländer» zu tun haben soll, darf noch ein wenig hinterfragt werden; Technokratie contra Gefühlswelt vielleicht? Tatsache ist, dass diese Bilder mit ihren Nahaufnahmen von Gesichtern allzu sehr an die DVD-Ästhetik erinnern und in ihrer Penetranz von der Sache selbst ablenken.
Hang zum Lauten
Wie stets bei David Pountney ist der szenische Eindruck durch mächtige räumliche Elemente und eher plakative Personenführung bestimmt. Überraschend aber, wie sehr sich dieser Ansatz in den Orchestergraben verlängert. Das Vorspiel gibt das Orchester der Oper Zürich als ausgefeiltes Konzertstück, mit dem der Dirigent Christoph von Dohnányi erkennen lässt, was Altersweisheit am Pult heissen kann. Mitreissend das Feuer, das gleich zu Beginn entfacht wird, grossartig die Ruhe, mit der dann das zweite Thema ausgemalt wird, meisterlich die Kontrolle, mit der das Stück unter einen einzigen Bogen gestellt wird. Doch schon bald beginnen sich Schwachstellen in der Koordination innerhalb des Orchesters, aber auch zwischen Orchestergraben und Bühne bemerkbar zu machen. Und vor allem drängt sich der Hang zum lauten Spiel immer störender in den Vordergrund - auch wenn manche Stelle kammermusikalisches Filigran annimmt. Klar, wenn der Weltuntergang beschworen wird, darf und soll die Pauke scharf dazwischenfahren; aber am Ende des pausenlos, gleichsam als Einakter durchgespielten Abends fühlen sich Zuhörer und Zuhörerin überfahren, erschlagen und ermattet, von den Orchestermitgliedern ganz zu schweigen. Jubel für die Sänger, ein Bühchen für den Dirigenten und das Regieteam.
Peter Hagmann
|

6. 12. 2004
Licht und Schatten im Wechsel
«Der fliegende Holländer» im Opernhaus Zürich überzeugt szenisch nicht
Wenn David Pountney inszeniert, entstehen normalerweise spannende, eigenständige Produktionen. Beim «Fliegenden Holländer» von Richard Wagner gelang dem britischen Regisseur jedoch wenig.
von reinmar wagner
Die Inszenierungen des britischen Regisseurs und Bregenzer Festspiel-Chefs bestechen jedes Mal durch völlig unverbrauchte und eigenständige Ideen. Das ist auch diesmal der Fall: Eine Video-Installation - «Star City» der beiden britischen Künstlerinnen Jane und Louise Wilson über ein Astronauten-Trainingszentrum in Russland - dient Pountney als Ausgangspunkt. Ein Holländer im Weltraum, Hightech und Maschinen gegen Aberglauben und schwärmerische Irrationalität. Solche Spannungsfelder lotet Pountney normalerweise tiefgreifender aus.
Die Ideen blieben Episoden
Diesmal blieben die Ideen Episoden. Der Zusammenhang fehlte, die Wirkungen verpufften. Ein riesiges Gestell mit zwei beweglichen Leinwänden für die Video-Einspielungen wurde nicht zur Projektionsfläche für Gefühlswelten und Seelenzustände, sondern blieb Gestell: ein fröhliches Wände-Schieben und Drehbühnen-Rotieren, das zunehmend sinnlos erscheint. Zwischen den eindrücklichen Videobildern und der «Holländer»-Handlung entstehen kaum Zusammenhänge, und wo doch, dort fasern sie aus oder werden nicht weitergedacht, weil Pountney diesmal zu wenig exakt gearbeitet hat.
Aber es gab auch Szenen von grosser Dichte und Eindringlichkeit: Eriks Traum-Erzählung etwa, wo Pountney sowohl die Verzweiflung Eriks über das zunehmende Entgleiten seiner Verlobten als auch die romantische Übersteigerung Sentas, die bis ins Körperhaft-Erotische reicht, eindringlich schildert. Auch die unsägliche Geldgier Dalands, der nichts Eiligeres zu tun hat, als händereibend seine Tochter in die Arme des reichen Unbekannten zu treiben, ist hier so deutlich wie selten herausgearbeitet worden. Anderes bleibt wiederum im Unbestimmten. Der Holländer wird als Figur kaum fassbar: Ein Irrender, fast Verwirrter, dessen Sehnsucht nach Erlösung kaum greifbar wird. Die Chor-szenen, die für Pountneys Verhältnisse seltsam statisch und schematisch bleiben, sogar dort, wo er, wie auf dem Fest der Seeleute, sehr viel Action hineininszenieren wollte. Und das Schlussbild mit den beiden Protagonisten als Wasserleichen wirkt auch ziemlich unausgegoren.
Musikalisch hervorragend
Wenn diese Produktion szenisch zu wenig durchgearbeitet wirkt, so gilt das Gegenteil für die musikalische Seite, vor allem für das Orchester, dem unter Christoph von Dohnányi einer seiner ganz grossen Abende gelang. Mit nie nachlassender Intensität führte Dohnányi durch Wagners erste Meister-Partitur und blieb dabei differenziert bis in die kleinsten Details: Kammermusik, aber auch mächtiger Klangrausch, und vor allem aufgefächerte Instrumentalfarben, die jeder Szene ihre ganz eigene Prägung gaben.
Sängerfreundlich dirigierte Dohnányi noch nie - ausser dass er gestochen scharf und zuverlässig die Einsätze gibt. Aber klanglich hat die Partitur für ihn Priorität, was heisst dass ein Wagner-Tutti auch zu mächtiger Klanglichkeit aufgebaut wird, und die Sänger entweder ihr Letztes geben oder untergehen. Da kommt selbst ein vokales Schwergewicht wie Matti Salminen an seine Grenzen. Freilich ist seine Partie nur selten laut, und Salminen bewies viel Fingerspitzengefühl für die treffende Charakterisierung der Krämerseele Daland.
Dasselbe gilt für den Erik, der vom Ensemblemitglied Rudolf Schasching überraschend stark und intensiv gesungen wurde. Andere mussten weiter über ihre Grenzen hinausgehen: Christoph Strehl als Steuermann wie Irène Friedli als Marie, aber auch die beiden Protagonisten. Egils Silins als Holländer schien in seinem Monolog schon auf das kräftezehrende Finale zu schielen und sich noch zu schonen - und avancierte am Ende dann tatsächlich zur überragenden Figur: eine intakte, kraftvolle Stimme mit klarem Fokus, aber nicht gerade ein Wunder an Farbigkeit. Bei Eva Johannsson wechselten Licht und Schatten. Manche Phrasen sang sie mit berückender Delikatesse, andere wollten nicht zum Blühen kommen. Risiken ging sie viele ein, und oft wurden sie belohnt: auf jeden Fall eine packende Darstellung der Senta, die sich in ihrer Intensität und Expressivität sehr schön mit Dohnányis dramatischer Dichte mischte.
|

6. 12. 2004
Untergehen im Strudel der Videobilder
Starke Stimmen, viele Bilder, wenig Tiefgang: «Der fliegende Holländer» von Richard Wagner hatte am Samstag Premiere am Zürcher Opernhaus.
Von Susanne Kübler
Gestern kam Frischs «Homo Faber» am Zürcher Schauspielhaus mit zwei Tagen Verspätung auf die Bühne, am Opernhaus dagegen läuft die Premierenmaschinerie wie immer wie geschmiert. Diesmal sass der Brite David Pountney an den Schalthebeln der Regie, und er hat sie wie gewohnt alles andere als zurückhaltend bedient: Der Chef der Bregenzer Festspiele ist sich opulente Bühneneffekte und immensen Materialaufwand gewohnt, und so nutzt er auch bei diesem «Fliegenden Holländer», was die Technik zu bieten hat.
Er liess den Ausstatter Robert Innes Hopkins ein Karree von halb transparenten Wänden bauen, die sich unablässig verschieben, öffnen und schliessen, die mal Schiff, mal Wohnzimmer sind. Der Steg darüber dient als Brücke für den Kapitän, ist aber auch praktisch, wenn heimlich gelauscht werden soll. Jürgen Hoffmanns Beleuchtungsteam hat viel zu tun an diesem Abend, und dann sind da noch die Zwillinge Jane und Louise Wilson, deren Videos auf die Wände projiziert werden: Ihr Projekt «Star City» aus dem Jahr 2000 (das unter anderem auch im Zürcher Migros-Museum zu sehen war) zeigt miefige Büros, verlassene Konferenztische und nutzlos gewordene Apparaturen in einem einstigen russischen Raumfahrtzentrum. Nicht übers Meer, sondern durchs All segelt der verfluchte Seemann hier also, seine magische Anziehung auf Senta erhält kosmische Dimensionen, und am Ende versinken beide völlig losgelöst (und anders als bei Wagner: gemeinsam) im Strudel der Unterwasser-Videobilder.
Astronauten statt Antworten
Es gibt viel zu schauen an diesem Abend, und manche Bilder sind stark. Das verlassene Raumfahrtzentrum etwa wirkt tatsächlich geisterhaft; anders als vor drei Wochen bei «Pelléas et Mélisande», wo eine Anspielung auf «Star-Wars»-Laserschwerter eher unpassend war, wird der «Fliegende Holländer» hier keineswegs zur Sciencefiction-Oper aufgemotzt. Und wenn sich beim Duett zwischen Senta und dem Holländer nur ihre Grossaufnahmen anschauen, sie selber aber getrennt und ohne Blickkontakt bleiben, dann trifft das den Kern der Geschichte: Da ist einer im wörtlichsten Sinn die Projektion des anderen.
In anderen Momenten scheint dagegen die Freude an der (virtuos gehandhabten) Technik und an den materiellen Möglichkeiten grösser gewesen zu sein als das Interesse an einer inhaltlichen Auseinandersetzung. Überspitzt gesagt: Pountney hat für einen zwanzigsekündigen Auftritt der Geistermatrosen ein Dutzend Astronautenpuppen mit leuchtenden Helmen anfertigen lassen, obwohl die leeren Raumanzüge im Video als Bild vollkommen genügt hätten; aber die Frage, warum diese doch ziemlich unsägliche Schauergeschichte heute noch erzählt werden soll, warum er sie erzählen will, die hat er nicht beantwortet.
Diese Frage stellt sich umso dringender, als Pountney mit den Figuren dieser Geschichte offenbar wenig anzufangen weiss (obwohl er sie hier bereits zum dritten Mal auf eine Bühne bringt). Ziemlich orientierungslos irren sie durch die ständig wechselnde Dekoration - wenn sie nicht in bewährter Opernmanier an der Rampe stehen. Selbst der kraftvoll singende Chor, den Pountney in anderen Inszenierungen oft geschickt individualisiert hat, tritt hier als unpersönliche Masse auf.
Das ist nun tatsächlich gespenstisch, denn die Sängerinnen und Sänger haben allesamt höchst differenzierte Vorstellungen von ihren Figuren. Erik, der glücklose Verehrer Sentas, tritt mit Fellmütze als eine Art russischer Holzfäller auf: eine lächerliche Gestalt, die nur Rudolf Schaschings variabler Tenor vor dem Absturz in die reine Karikatur rettet. Matti Salminen, der bewährte Daland, wird als nicht besonders interessanter Geschäftemacher vorgeführt, obwohl sein Bass immer wieder persönliche Tiefe und eine gar nicht stromlinienförmige Bauernschläue verrät.
Auch Eva Johansson ist stimmlich weit mehr als die fanatische Jungfer, die sie vor allem zu Beginn darzustellen hat. Ihr sehr spezielles, im Piano metallisches Timbre mag Geschmackssache sein; aber wie sie die bei Wagner ziemlich einseitig veranlagte Senta lebendig werden lässt, wie sie deren sturen Opferwillen durch eine breite Palette von Emotionen abstützt, wie sie ihren Sopran vom fast vibratolos schneidenden Sottovoce bis zur Explosion bringt, das ist grossartig.
Präzision gegen Effekt
Und dann ist da noch Egils Silins als Holländer: Er macht gestisch fast nichts - und drückt damit alles aus. Er ist kein Schauerromantiker, sondern ein klar und klug gestaltender Bariton; Präzision bedeutet ihm mehr als der vordergründige Effekt, und gerade deshalb wirkt er enorm beunruhigend. Ein Getriebener, dessen geheimnisvolle Faszination nachvollziehbar wird.
Christoph von Dohnányi im Orchestergraben macht derweil das Gegenteil von Silins: Er setzt eher auf Effekt als auf Präzision. Schon in der Ouvertüre zeigt er an, dass sein bevorzugtes Gestaltungsprinzip der Kontrast ist: Flott startet er (wobei man die Akzente der Blechbläser weit deutlicher hört als den komplexeren Untergrund der Streicher); betont lyrisch fährt er dann fort - und so langsam, dass nicht nur die Musik den Schwung verliert, sondern auch die Einsätze im Orchester der Oper auseinander fallen.
Ungenau wirkt vieles, und weil diese Partitur sowieso zu den plakativeren Wagners gehört (ein Sturm ist ein Sturm ist eine stürmische Ballung von sinistren Akkorden), bleibt da über weite Strecken nicht viel mehr als ein zwar klangvolles, manchmal auch intensives, oft aber ziemlich ungefähres dramatisches Aufbrausen und ein ebenso vages Versinken im Sehnsüchtigen. Vielleicht hätte es einfach ein paar Proben mehr gebraucht. Aber dafür läuft die Premierenmaschinerie an diesem Haus wohl allzu geschmiert.
|

6. 12. 2004
Wo nur ist Richard Wagner geblieben?
Die Neuproduktion des Evergreens «Fliegender Holländer» am Opernhaus Zürich überzeugte kaum
Richard Wagners «Fliegender Holländer» gehört zu den Evergreens auf den Opernbühnen, denn er fasziniert durch Handlung und Musik: hier die beschauliche Welt der Seeleute und deren Frauen, die am Spinnrad sitzend warten, dort der Holländer, der unvermittelt in diese biedermeierliche Welt eindringt, und Senta, die daraus ausbricht. Wagner hat sich den perfekten Plot für seine Musik geschaffen, für die volksliedhafte Diesseitigkeit und die harmonisch kühne, ausbrechende Romantik.
Das Team der Neuproduktion des «Holländers», der am Samstagabend am Opernhaus Zürich Premiere feierte, scheint allerdings nicht viel von solchen Vorgaben zu halten - im Gegenteil, es warf kurzerhand alles über Bord. Regisseur David Pountney ebnete die beiden Gegenwelten rigoros ein und zerstörte damit die Wagnersche Dramaturgie gründlich. Dirigent Christoph von Dohnànyi bot dafür eine überlaute, undifferenzierte Interpretation, die schwerlich zu überbieten ist.
Handlung nach Baikonur in Kasachstan versetzt
Pountney versetzt die Handlung nach Baikonur in Kasachstan, in das marode russische Raumfahrtzentrum. Hier haben die beiden Künstlerinnen Jane und Louise Wilson Anfang der 1990er Jahre Videoinstallationen von beissender Schärfe realisiert, die nun als grossdimensionale Videoprojektionen im «Holländer» verwendet werden. Entsprechend funktional ist das Bühnenbild gestaltet, das aus einem freischwebenden, begehbaren Metallquadrat besteht, an dem die vier Projektionswände hängen. Bühnenbildner Robert Innes Hopkins findet damit eine raffinierte Lösung, denn durch das ständi- ge Verschieben der lichtdurchlässigen Wände entstehen immer neue Raumkonstellationen.
Inkonsequente Handhabung
So einleuchtend diese «Raumfahrtlösung» scheint, so inkonsequent wird sie gehandhabt. Schon zu Beginn sieht man zwei Zentrifugen, mit denen in Baikonur die Schwerelosigkeit simuliert wird. Nur befinden wir uns in der «diesseitigen Welt» des Daland, und so müssen die Matrosen in Raumfahrtanzügen «Segel auf» singen. Holländer- und Daland-Welt werden in Zürich eins. Am abstrusesten wird diese Vermengung im dritten Aufzug, wenn die beiden Welten in einer dramaturgisch genial komponierten Szene aufeinander treffen. Bei Pountney vergewaltigen die Daland-Matrosen ihre als strohblonde Barbiepuppen aufgepeppten Mädels im Takt der Schauermusik des Holländers.
Dramaturgie ist an diesem ärgerlichen Opernabend überhaupt ein Fremdwort. Der Regisseur bürstet das Werk gründlich gegen den Strich, allerdings ohne neue Lösungen zu präsentieren. Die faszinierende Kernszene des Werkes, das Aufeinandertreffen von Senta und Holländer, führt Pountney gar ad absurdum.
Spannung verpufft
Die Spannung der Musik wird konterkariert, Holländer und Senta rennen ständig aneinander vorbei, Blickkontakt ist verboten. Die Annäherung findet nur durch die Videoprojektion der zwei übergrossen Köpfe der Protagonisten statt. Musik und Spannung aber verpuffen.
Selbstüberbietung führte zu Unsauberkeiten
Dass es das Sängerensemble bei solcher «Entmenschlichung» schwer hatte, sich seinen Rollen zu stellen, versteht sich. Dass ihnen Christoph von Dohnànyi zusätzlich das Leben erschwerte, war die grösste Enttäuschung.
Berühmt-berüchtigt für seinen Hang zur Lautstärke, überbot er sich an diesem Abend gleich selber. Schon die sinfonisch gestaltete Ouvertüre liess nichts Gutes erahnen, denn neben expressivstem Fortissimo kamen auch technische Unsauberkeiten dazu.
Am schlimmsten war, wie die Musik sozusagen taktweise aus dem Boden gestampft wurde, von Phrasierung oder Legato blieb nichts übrig, von einer Unterscheidung der Welten auch nicht.
Brillianter Holländer
Egils Silins als Holländer brillierte mit einer Diktion, die jedes Wort verständlich machte, es aber auch derart betonte, dass der musikalische Fluss verloren ging. Schade um diese dunkle, kernig fundierte Stimme, die zwar die Kraft, aber nicht die Musikalität für den Holländer mitbrachte. Bei Eva Johanssons Senta erlebte man ein Wechselbad der Gefühle: Einerseits mit kräftigem und höhensicherem Sopran ausgestattet, andererseits durch das Orchesterbrausen derart unter Hochdruck singend, dass auch hier Interpretation und Gefühle verloren gingen.
Nur Bassstimme liess die Grösse der Musik erahnen
Sinnfällig für die musikalischen Schwierigkeiten waren die beiden Tenöre. Hier Rudolf Schasching, ein bestandener «hochdramatischer» Siegmund und Siegfried, der hier an Dohnànyi-Erik scheiterte. Wo war nur die wunderbare Kantilene bei den beiden Erik-Arien, diesen kantablen Vorläufern des Stolzing? Schasching musste «parlieren», «schreien», «hauchen» und durfte nur zwischendurch seine kraftvolle, gut geführte Stimme «laufen lassen». Und da war das Rollendebüt von Christoph Strehl als Steuermann. Wir kennen seine wunderbare lyrische Stimme, hier wirkte sie brüchig und forciert. Unbeeindruckt zeigte sich einzig Matti Salminen als Daland. Mit seinem mächtigen Bass liess er sich nicht provozieren, sang mit fabelhafter Phrasierung, artikulierte und interpretierte die Rolle des biedermeierlichen Seefahrers. Hier spürte man etwas von der Grösse Wagnerscher Musik.
Der Chor hatte es schwer
Schwer in diesem Szenario hatte es der Chor. Im Off oder in luftiger Höhe singend, ohne Blickkontakt zum Dirigenten, schlugen sich die Sängerinnen und Sänger dank der Einstudierung von Jürg Hämmerli gut und lärmten in der Gespensterszene wacker mit. Der Chor wie viele andere werden sich allerdings wehmütig gefragt haben: Wo nur ist Richard Wagner geblieben?
Sibylle Ehrismann
|
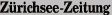
6. 12. 2004
Weltall-Streben und Weltverlust
Neuinszenierung von Richard Wagners «Fliegendem Holländer» mit Daviod Pountney und Christoph von Dohnányi
Der Fliegende Holländer als Welt-Raum-Schiff-Fahrer: unromantischer geht es kaum, was mit einem Buh-Konzert für die szenisch Verantwortlichen quittiert wurde. Doch ist das zu kurz gedacht, denn David Pountney hat die Fabel vom Holländer, vom «ewigen Juden des Ozeans», konsequent weiter gedacht, packend aktuell.
WERNER PFISTER
Treu bis in den Tod muss sie sein und kein Jota weniger, jenes Weib nämlich, das den Fliegenden Holländer erlösen könnte. In solcher Sehnsucht nach dem Weib, «nach dem erIösenden Weibe», in solcher Fixierung auf «das Weib überhaupt, das ersehnte, geahnte, unendlich weibliche Weib», ja noch mehr: «das Weib der Zukunft», das «noch unvorhanden, dessen Züge mir in keiner sicheren Gestalt entgegentraten» (so Richard Wagner) - was würde sich darin anderes manifestieren als ein schon pathologisch zu nennender, objekthafter Umgang mit der Frau, und das aus männlicher Selbstüberhebung heraus? Wobei, in Klammern angemerkt, diese Vorstellung vom hehren Weib zur regressiven Thematik der deutschen Romantik gehört.
Fragt sich, wie man das inszeniert. Denn solche Sehnsucht, solch übersteigerte Fixierung ist Folge jener Weltschmerzthematik, wie sie die Romantik des 19. Jahrhunderts beherrschte: von Lord Byron über Schuberts Winterreisenden zum Fliegenden Holländer und schliesslich zu Wotan, dem Wanderer. Wanderer nämlich sind sie alle, unbehaust und ausgestossen, ausgeliefert ihrem tragischen «Wanderlos» (Lenau), das Herz voll von «Wanderleid» (Keller), auf der vergeblichen Suche nach jenem Glück, welches stets dort ist, «wo du nicht bist» (Schubert).
Mutterbindung
Alle leiden sie an der Enttäuschung über die Welt und die Menschen, und der Fliegende Holländer insbesondere: einen «ewigen Juden des Ozeans» nennt ihn Heine, von dem Wagner die ganze Story her hat, «gleich einer leeren Tonne, die sich die Wellen ei-nander zuwerfen». So wird der arme Holländer «zwischen Tod und Leben hin und her geschleudert» (wobei die Tiefenpsychologie diese fatale Bin-dung zum Meer als ebenso fatale Mutterbindung interpretiert). So oder so, nirgends kann der Holländer Fuss fassen, was meint: als ein res-pektables Glied sich in die bürgerli-che Gesellschaft einordnen.
Senta also fühlt sich urplötzlich berufen, ihn zu erlösen: «Treu bis in denTod.» Bei Heine heisst es just in diesem Moment verräterisch: «Bei dieser Stelle hörte ich lachen.» Man könnte über so viel impulsive Opferbereitschaft respektive Erlösungsmission schon lachen, zumindest den Kopf schütteln. Handelt es sich um Selbstpreisgabe für einen andern oder, im Gegenteil, um Selbstfindung? Individuation oder Selbstverlust? Ist Senta eine pathologische Hysterikerin oder eine närrische Schwärmerin? Rebellin oder Romantikerin? Fragt sich abermals, wie man das inszeniert.
Künstlerproblematik
Regisseur David Pountney brachte den «Fliegenden Holländer» bereits 1989 auf die Bühne, nämlich auf die Seebühne der Bregenzer Festspiele. Damals angesiedelt in der Zeit der Industrialisierung und der Welt des Kapitals, beides vom pragmatischen Daland verkörpert, und der Holländer war ein idealistischer Aussenseiter. In seiner Zürcher Neuinszenierung geht Pountney noch einen entscheidenden Schritt weiter (im historischen Zeitablauf) und in die Tiefe (der geistigen Konsolidierung). Künstlerproblematik heisst nun das Stichwort; denn, was in Heines Erzählung als geheime Judenproblematik angelegt ist, wird nun als faustisches Prinzip des ewig suchenden Künstlers, ja Wissenschaftlers interpretiert - stets auf der Suche nach neuen Welten und Einsichten und gleichzeitig heimat- und beziehungslos in der eigenen Welt.
Entsprechend hat Robert Innes Hopkins einen nüchternen, technisch-funktionalen Bühnenraum eingerichtet, Eisen und Beton, so weit man blickt. Ein frei hängendes Metallkarree mit der Spitzkante zum Publikum hin ausgerichtet erinnert an einen Schiffsbug mit Kommandobrücke, wo der Kapitän seine Wachrunden dreht und der Matrosenchor singt. Darunter, in strenger Geometrie angeordnet, verschiebbare Bildwände, die Ein- und Durchblicke in drehbare Innenräume auf- und zuschliessen.
Auf diesen Bildwänden werden am laufenden Band Videos projiziert, die diesen bislang kahlen, ortlosen Raum nun konkretisieren. Es handelt sich dabei um eine speziell für diese Operninszenierung angefertigte Adaption der Video-Installation «Star City» der Zwillingsschwestem Jane und Louise Wilson: laufende Bilder von einem (nach 1989) verlassenen sowjetischen Kosmonauten-Trainingszentrum. Einst getragene Raumanzüge stapeln sich, Maschinen und, Trainingsmodule drehen sich leer - weit und breit ist kein Mensch (mehr) zu sehen: Der Traum vom technischen Fortschritt, die Sehnsucht nach dem Weltall, beides hat sich verselbständigt, hat nichts mehr mit dieser Welt zu tun.
Das dritte Auge
Das ist konsequent gedacht und wird auf der Bühne auch konsequent ins Bild gebracht: von beklemmender Wirkung zum Teil. Zum andern Teil indes - und als Folge dieses einheitlichen Bühnenbilds - ergibt sich daraus auch eine Verflachung von Wagners Vorlage: Der Gegensatz von Dalands bürgerlich-spiessiger Kapitalistenwelt und der Welt des faustischen Strebens hinaus ins Weltall, dieser Gegensatz wird eingeebnet bis zur Verständnislosigkeit: Auch bei Daland zuhause weben die Spinnerinnen an Leuchtkabeln, im (SkIaven-)Dienst des raumfahrttechnischen Fortschritts auch sie.
Und Senta, die Tochter Dalands? Sie ist nicht von dieser Welt, denn sie hat Visionen von einer besseren Welt, verfügt über ein so genanntes drittes Auge, das sie unentwegt auf den Boden und den Spinnerinnen auch mal auf deren blinde Stirn malt. Mag sie auch eine Idealistin sein - in dieser rein auf den technischen Fortschritt ausgerichteten Welt, in der Ideale längst keinen Platz mehr haben, wirkt sie wie eine pathetische Hysterikerin: ein pathologischer Befund also, Selbstverlust.
Frisch durchlüftet
Wirklich Wagners «Weib der Zukunft»? Diese und andere Fragen wurden letztlich mit einem lautstarken Buh-Konzert für die szenisch Verantwortlichen beantwortet. Eine Quittung vielleicht auch für die totale Abwesenheit von Romantik in dieser Neuinszenierung, einer Romantik, die dem «Fliegenden Holländer» seiner Thematik wie seiner Musik nach, (die bewusst an den erfolgreichen Nummern aus Webers «Freischütz» anschliesst) inhärent ist. Umgekehrt ist das alles derart schlüssig weiter gedacht und derart bildhaft in Szene gesetzt, dass man sich dieser Inszenierung und ihrer Aufforderung zum Mitdenken nicht entziehen kann: spannend und beeindruckend allemal.
Hochspannung vibriert auch im Orchestergraben: Welch ein Klang, welch bewegender Fluss, welch sensibel durchleuchtete Schönheit, die sich da unter den Händen Christpph von Dohnànyis entfaltet. Dohnànyis Wagner ist ein Musterbeispiel an formalem Kalkül und frisch durchlüfteter analytischer Transparenz, ist trotzdem gefühlsbetont, vor allem aber dramatisch effektvoll gesteigert. Er legt das thematische Beziehungsgeflecht erhellend frei, und das Orchester der Oper Zürich agiert mit bemerkenswerter Präzision und Klangfantasie. Ein Sonderlob auch für den mit stimmlicher Schlagkraft überwältigenden Chor des Opernhauses Zürich.
Souveräne Sänger
In Zürich wird die pausenlose Erstfassung der Oper gespielt, was für die Sänger eine zusätzliche Belastung darstellt. Sie meistern das famos - besonders Egils Silins in der Titelpartie. Sein mächtiger Bariton hat vor allem in der Höhe eine mitreissende Strahlkraft, die über alles dominiert: faustisch und mephistophelisch zu gleichen Teilen. Eva Johansson als Senta ist ganz pathetische Gestalt: existentiell bewegt von dem, was zukünftig sein soll. Entsprechende Gewalt geht von ihrer Stimme aus, eine fast selbstzerstörerische Gewalt, doch die Stimme meistert das souverän.
Matti Salminen schöpft als Daland ebenfalls aus dem Vollen: ein so genannt senkrechter Bürger, der listig auf seinen Vorteil zu achten versteht. Dagegen wirkt Rudolf Schasching als der von Senta verschmähte Liebhaber Erik wie ein ungehobelter Naturbursche: keiner, der mit tenoralem Schmelz verführen könnte. Christoph Strehl singt den Zigarette rauchenden Steuermann mit lyrischem Impetus, und Irène Friedli stellt als Mary eine intensive, zuweilen fast schon überinterpretierte moderne Version einer KZ- oder Kolchose-Aufseherin vor. Es ist letztlich genau diese Intensität auf der Bühne wie im Orchestergraben, die einen in Bann zieht: im hörenden Mitvollzug, im reflektierenden Weiterdenken.
|

2004 - Odyssee im Opernraum
David Pountney inszeniert Wagners "Fliegenden Holländer"
Von Alexander Dick
Senta muss ins Wasser. So will es der Dichterkomponist Richard Wagner, der seiner ersten großen Frauenfigur am Ende des "Fliegenden Holländers" einen Sturz ins Meer verordnet, auf dass die Liebende den zu ewigem Herumirren verdammten Titelhelden erlöse. Regisseur David Pountney hat diese szenische Anweisung schon damals, 1989, auf der Bregenzer Seebühne mit einem spektakulären Sturz von einem Leuchtturm in den Bodensee erfüllt. Auch 15 Jahre später, auf der Zürcher Opernbühne, findet sich Senta, diesmal mit dem Umherirrenden vereint, im Wasser wieder. Im virtuellen. Denn die beiden "schweben" hinter großen Leinwänden, auf die Wasserwogen projiziert werden.
Gesamtkonzept missfiel
Das klingt kitschig - und ist es auch. Wenngleich Pountney Wagners szenische Schlussanweisungen, denen zufolge die beiden Protagonisten "in verklärter Gestalt" dem Meer entsteigen, fast wörtlich umsetzt.
Was das Publikum in Zürichs Musentempel dazu sagt, zeigt es dem Bregenzer Festspielintendanten danach unverblümt: Buh. Vermutlich galten die Missfallenskundgebungen aber eher dem Gesamtkonzept. Wagners romantische Seefahrtsoper wieder einmal ohne Segelschiff . . .
Reise durch Raum und Zeit
Dabei hält Pountney es im Grunde auch hier mit Wagner. Nur wird des Holländers Irrfahrt auf den Meeren der Welt zur Odyssee im Weltraum, zur real-surrealen Reise durch Raum und Zeit. Und das ist durchaus packend und spannend gemacht - selten hatten Videoinstallationen auf der Opernbühne eine solch zwingende, über das Illustrative hinausgehende Funktion.
Zu verdanken ist das den beiden Londoner Künstlerinnen Jane und Louise Wilson, deren Videoinstallation "Star City" aus dem Guggenheimmuseum in Bilbao Pountneys Regiekonzept entscheidend prägte. Sie zeigt Aufnahmen aus dem in Auflösung begriffenen sowjetischen Raumfahrtzentrum, das in seiner Verlassenheit und technologischen Tristesse zur Metapher wird für Heimatlosigkeit und Entfremdung.
Den Kern getroffen
Womit Pountney genau den Kern von Wagners erstem großen Operndrama trifft. Im Kontrast dazu stehen Nahaufnahmen der Gesichter des Holländers und Sentas, fokussierte psychologische Studien zweier Seelenverwandter. In Robert Innes Hopkins' Bühne mit ihrer überzeugenden Lichtgestaltung (Jürgen Hoffmann) kennzeichnet Raum nicht einen Zustand, sondern dessen stetige Veränderung. Wer sich auf diese nicht so schwer zu dechiffrierende Bildsprache einlässt, kommt auf seine Kosten, zumal Pountneys Personenregie nicht auf die Wirkung der Bilder allein baut, sondern die Akteure in steten Dialog mit diesen treten lässt.
Militaristische Züge
Die reale Welt dagegen charakterisiert Pountney weniger originell, indem er deren Vertreter wie den immer auf geschäftlichen Vorteil bedachten Daland sowie dessen Seeleute militaristische Züge verleiht. Dass er die Seemanns- und Geisterchöre im III. Aufzug in einen brutalen Vergewaltigungsakt umdeutet, hinterlässt einen beklemmenden Eindruck, aber auch die Frage, ob eine solche Interpretation sich tatsächlich aus dem Inhalt ableitet.
Dennoch bleibt zu konstatieren, dass Pountney mit seiner mittlerweile dritten "Holländer"-Deutung bewegendes Theater gelungen ist, wohlgemerkt mit der und nicht gegen die Musik.
Christoph von Dohn|2anyi ist deren kundiger Anwalt am Pult des sich nach Anfangsschwierigkeiten in Festspielformat steigernden Opernorchesters: Seine Lesart der Partitur zeichnet sich durch eine äußerst differenzierte Auseinandersetzung mit dieser Oper in Balladenform aus; kein vorüber brausendes Dauer-Prestissimo, sondern ein in puncto Nuancierung der Tempi und Klangfarben ganz vielschichtig aufgebauter, dem Zuhörer ganz neue Seiten dieser Musik entdeckender "Holländer"-Abend.
Festspielbesetzung
Mit Festspielbesetzung: Egils Silins gestaltet die Titelpartie facettenreich, leidenschaftlich. Matti Salminen ist der Daland schlechthin, meisterlich von der Artikulation bis zur Tongebung. Eva Johansson gibt eine Senta, die der hochdramatischen Partie gerade ob der immer noch vorhandenen Jugendlichkeit ihres Soprans einerseits hoch gerecht wird, andererseits im Ansatz gerade bei den leiseren Tönen unsicher wirkt. Rudolf Schaschnigs, in der Höhe fein gedeckter, opulenter Erik, Christoph Strehls brillanter, sich für Bayreuth empfehlender Steuermann und Irène Friedlis Mary runden das hohe musikalische Niveau einer Produktion ab, in der auch der von Jürg Hämmerli einstudierte Chor (besonders bei den Herren) Marken setzt.
Gespielt wird übrigens die "Holländer"-Fassung mit dem weicher ausklingenden "Erlösungsschluss" - wozu wiederum das verklärende Schlussbild nicht schlecht passt. Kitsch hin oder her.
|