Aufführung
|

23. 5. 2004
(Première)
*
Musikalische Leitung: Carlo Rizzi
Inszenierung: Cesare Lievi
Ausstattung: Maurizio Balò
Choreographie: Daniela Schiavone
Lichtgestaltung: Jürgen Hoffmann
Chor: Ernst Raffelsberger
*
La duchesse Elena: Paoletta Marrocu
Ninetta: Katja Starke
Guido di Monforte: Leo Nucci
Giovanni da Procida: Ruggero Raimondi
Arrigo: Marcello Giordani
Il sire di Bethune: Reinhard Mayr
Il conte Vaudemont: Günther Groissböck
Danieli: Andreas Winkler
Tebaldo: Miroslav Christoff
Roberto: Valeriy Murga
Manfredo: Mauricio O'Reilly
|
Rezensionen
|
|
|
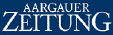
25. 5. 2004
Hier die Zukunft, da die Vergangenheit
Opernvergleich: Neuwirths «Lost Highway» in Basel, Verdis «I vespri siciliani» in Zürich
Zwei Städte, zwei Opernpremieren, zwei Welten:
Basel spielt die Oper zum Kultfilm «Lost Highway» nach David Lynch,
Zürich eine für Sängerstars arrangierte Verdi-Oper.
Christian Berzins
Gewiss, auch das Theater Basel spielt seinen Verdi. Doch die zeitgenössische Oper hat hier trotz Finanzsorgen viel mehr Platz als in Zürich. Und stehen die «alten» Opern auf dem Spielplan, wird versucht, sie neu zu erzählen. Dabei hat auch das Experiment Platz. Auch als solches - äusserst geglücktes - ist die neuste Produktion zu sehen.
In Zusammenarbeit mit Graz 2003 zeigte man am Samstag in der Reithalle der Kaserne Olga Neuwirths letztes Jahr erfolgreich uraufgeführte Opernfassung von David Lynchs Film «Lost Highway». Die österreichische Schriftstellerin Elfriede Jelinek hat zusammen mit der Komponistin Neuwirth (2002 war sie am Lucerne Festival «Artiste in residence») ein englisches Libretto geschrieben. Erzählt wird nach wie vor die Geschichte von Fred (Vincent Crowley), der seine Frau Renee (Cons-tance Hauman) tötet und deswegen ins Gefängnis kommt. Dort erwacht er eines Tages als Pete (Georg Nigl) und wird wieder zu Gewalttaten getrieben.
Joachim Schlömer und der Bühnenbildner Jens Kilian bringen die so vielschichtige wie verwirrende Geschichte unerwartet klar auf die Bühne: Das geht nicht ohne wohltuende Vereinfachungen, dafür mit einer manchmal etwas simplen Personenführung. Lynch bleibt immer sicht- und fühlbar.
Traumhafte Rätselorgie
Neuwirth hat zu dieser traumhaften Rätselorgie eine faszinierende Musik geschrieben, die jeden Moment im Innersten brodelt - zu Beginn ist nur ein tiefes Brummen, zum Schluss ein ekstatisches Klangzucken zu hören. Das Ensemble Phoenix Basel - recht traditionell besetzt, wenn auch die Elektronik in der Komposition eine eminent wichtige Rolle spielt - musiziert unter der Leitung von Jürg Henneberger äusserst engagiert.
Da Neuwirth anfänglich konsequent auf den Gesang verzichtet und nur die Sprechpassagen begleitet, umgeht sie den vermeintlich immergleichen zeitgenössischen Operngesang. Ja, man könnte das Werk gar als Schauspielmusik bezeichnen; eine Gattung, die wir seit Mozart kennen . . . Erst im zweiten Teil wird auch gesungen - und dann tönt es so, wie Neue Oper eben tönt. Da aber Stimmkünstler David Moss mitwirkt, erhält der Gesang ironische Brechung: Das Röcheln eines Erstochenen wird zu einer skurrilen Koloratur-Arie.
Hundert falsche Diven-Töne
Koloraturen ganz anderer Art waren am Sonntag am Opernhaus Zürich zu hören. Giuseppe Verdis «I vespri siciliani» standen auf dem Programm - eine 1855 uraufgeführte Oper, die den Volksaufstand der Sizilianer gegen die Besetzer aus Frankreich im Jahre 1282 behandelt. Und diese Koloraturen hat darin vor allem Paoletta Marrocu als Elena zu singen. Sie ist eine Sängerin, die den rührenden Versuch wagt, 27 Jahre nach Maria Callas´ Tod eine ihrer Epigoninnen zu werden. Fünfeinhalb ihrer Töne klingen ähnlich wie jene der (späten) Callas, etwa hundert sind falsch und der Rest langweilig. Ihrem Bühnenpartner Marcello Giordani (Arrigo) gelingt alles besser, nur überzeugt auch er nicht ganz: Glänzend und messerscharf sind die Spitzentöne des 41-Jährigen, mutig seine Ausbrüche, aber der ganze lyrische Bereich ist ihm bereits abhanden gekommen und die Stimme klang im 5. Akt belegt. Beim mittlerweile 62 Jahre alten Bass Ruggero Raimondi stimmt dafür noch sehr viel: Leicht wackelig sind nur wenige Töne, aber darin ist dafür ein enormer, fast zärtlicher Ausdruck. Doch keiner gelangt an Leo Nuccis (als Guido di Monforte) Kunst heran. Der ebenfalls 62-jährige Bariton ist in blendender Verfassung: Seine Diktion, sein kluge Tongebung, seine unglaubliche Färbung kleinster Regungen und somit die Schönheit der Stimme sind einzigartig.
Carlo Rizzi dirigiert impulsiv, in Ansätzen fast gestisch, was den Sängern entgegenkommt. Auf- und abtreten tun sie inmitten eines Trümmerhaufens (Bühne Maurizio Balò). Im Programm ist Cesare Lievi als Regisseur angegeben: Er bestimmte demnach wohl, wer wann an der Rampe vorne den Arm wie heben musste.
Zwei Städte, zwei Opernwelten: Ist es nur eine Frage der Heimatliebe, wo man hingeht? Waren die Buhs für Cesare Lievi, der mässige Jubel für die Sänger, die leeren Plätze im Parkett ein Anzeichen dafür, dass die Ära des teuren Zürcher Sänger-Startheaters bald vorbei ist? Die Auslastung, letztes Jahr auf 77 % gesunken, wird es bald zeigen. In Basel jubelte ein durchmischtes Publikum im vollen Saal ungeteilt.
|

25. 5. 2004
Sizilien ein Trümmerhaufen
Mit «I Vespri Siciliani» bringt das Zürcher Opernhaus wieder einmal Giuseppe Verdi. Die herrlichen Arien begeisterten das Publikum, die verstaubte Regie langweilte es. Premiere war am Sonntag.
Darum geht es: Politik und Liebe. Im Jahr 1282 metzeln sizilianische Revoluzzer tausende französische Besatzungssoldaten nieder. Zuvor gibt es eine verzweifelte Liebesgeschichte zwischen Arrigo, dem französischen Gouverneurssohn, und der sizilianischen Herzogin Elena.
«I Vespri Siciliani» (Die sizilianische Vesper) war nicht Verdis Lieblingsoper. Aber sie enthält einige der schönsten Arien, Quartette und Terzette. Sie machen den neusten Zürcher Verdi sehenswert. Ansonsten ist es eine Aufführung, die schon vor zwanzig Jahren für den langweiligen Ruf der Oper gesorgt hätte.
Alles ist dunkel, weil tragisch. Styroporblöcke stellen sizilianische Ruinen dar. Sängerinnen und Sänger verdrehen leidend die Augen und rudern mit stets denselben Gesten. Sie stehen an der Rampe, singen den Dirigenten an, statt ihre Partner zu lieben oder zu hassen. Aus dem Orchester tönt es schön, aber uninspiriert. Obwohl der Dirigent sehnsuchtsvoll mit den Händen die Arien in die Luft malt: Die Musik ist laut oder leise und wenig dazwischen.
Erst mit der Zeit bekommt das Palermo von Cesare Lievi (Regie) und Maurizio Balo (Ausstattung) etwas Farbe. Die Gefühle bleiben unglaubhaft. Dabei könnten Leo Nucci und Ruggiero Raimondi so tolle Darsteller sein. Hier werden sie als Gouverneur und dessen Gegenspieler Procida auf gängige Operngestik reduziert. Ihre Bühnenpräsenz sorgt aber für Knistern und ihre grossen Stimmen für Schaudern.
Paoletta Marrocu kämpfte als Elena zwischen der Liebe zum Vaterland und jener zum Geliebten, aber auch mit den Höhen der schwierigen Rolle. Für Glanzlichter sorgt Marcello Giordani als Arrigo: ein natürlicher Darsteller mit schönem, kraftvollem Tenor bis in höchste Töne.
|

25. 5. 2004
Endspiel eines Patrioten
Die Patrioten, die Besatzungsmacht und der Frieden sind Thema von Verdis «Sizilianischer Vesper». Opernschematik dominiert die neue Zürcher Inszenierung, aber Verdis Musik lässt niemanden im Stich.
Herbert Büttiker
«I vespri siciliani» enthalten Musik, die zum Ergreifendsten gehört, was Verdi komponiert hat, und manches, so die Ouvertüre, die Siciliana der Sopranistin, die Ballettmusik, zählt zur Konzerthitliste. Dennoch erscheint die nach der grossen Trias «Rigoletto», «Il Trovatore», «La Traviata» entstandene, 1855 uraufgeführte Oper selten auf dem Spielplan, in Zürich zuletzt vor mehr als dreissig Jahren. Gründe dafür sind wohl vor allem die sperrige Grösse des für die Pariser Opéra komponierten Fünfakters und vor allem die besonderen Anforderungen, die die Aufmischung des italienischen Melodramma mit typisch französischen Stilelementen in dieser Musik für die Interpreten mit sich bringt.
Gründe, sich gerade heute mit diesem faszinierenden Komplex zu befassen, gibt es aber auch. Dabei geht es vor allem um die Thematik. Dass sich das Opernhaus stilistisch mit dem Kompromiss einer italienischen Fassung der «Vêpres Siciliennes» begnügt, die viel Französisierendes mit einbezieht, aber auf das grosse Ballett verzichtet, mag man dabeials nebensächlich betrachten. Zumal das rein italienische Solistenensemble mit Paoletta Marrocu, Marcello Giordani, Leon Nucci und Ruggero Raimondi eindrücklich für genuinen Verdi-Gesang bürgt.
Kolorit und aktuelle Thematik
Als historisches Ereignis liegt der Oper der Aufstand der Sizilianer im Jahr 1282 zu Grunde. Aber die Geschichte des Librettos von Eugène Scribe – es ist ursprünglich als «Le Duc d’Alba» für Donizetti im Kontext des niederländischen Aufstandes angesiedelt – zeigt auch, dass damit nicht viel mehr als ein Kolorit festgelegt ist. Diesem zollt Verdi mit Siziliana und Tarantella auch farbigen Tribut, im Wesentlichen aber geht es um dramatische Konstellationen, die ins Zentrum von Politik und Privatem, Macht und Menschlichkeit zielen und an keine Epoche gebunden sind.. Für den Konflikt zwischen Besatzungsmacht und edlen Patrioten, die auch vor terroristischen Mitteln nicht zurückschrecken, und für einen Lauf der Dinge, in dem Friedenschancen gewalttätig ignoriert werden, sollte es an Hellhörigkeit gerade heute nicht fehlen. Dass der tyrannische Herrscher Guido di Monforte im Hoffnungsträger des sizilianischen Widerstandes seinen mit einer Italienerin gezeugten Sohn Arrigo erkennt, um seine Anerkennung und Liebe kämpft und am Ende auch dessen Ehe mit einer italienischen Fürstin segnet, ist von einer symbolischen Kraft, die heute genauso berührt wie der rabenschwarze Schluss der Oper: Der sizilianische Patriot Procida, der unbeirrt seine Sache weiter betreibt, funktioniert das Läuten der Hochzeitsglocke zum Signal für den Aufstand und ein blutiges Gemetzel um.
Das alles zwingt nicht zur Aktualisierung im vordergründigen Sinn (elegante Militäruniformen verweisen im Opernhaus auf die Zeit des Ersten Weltkriegs), aber eine Vorgabe zu packenderer szenischer Intensität, als sie Cesare Lievi (Inszenierung) und Maurizio Balò (Ausstattung) bieten, könnten «I Vespri Siciliani» schon sein. Mit einer im Laufe der fünf Akte nur wenig variierten Trümmerlandschaft ist ein an sich stimmungsvoller Ausgangspunkt gegeben, aber es scheint wenig damit gearbeitet worden zu sein (Licht!). Im Bewegungsgeschehen fehlen Ideen oder das Interesse am szenischen Detail, und es beschränkt sich vor allem in den grossen Tableaus allzu sehr auf pure Opernschematik.
Autorität und Menschlichkeit
Die Inszenierung gewinnt an Dichte in den beiden Schlussakten, und insgesamt ist immerhin das Feld offen für das musikalische Geschehen – für die Entfaltung von Verdis unmitelbarer Gesangsdramatik, die sich gewissermassen selbst in Szene setzt. Obwohl Leo Nuccis Monforte wohl auch von der baritonalen Statur her dort besonders stark ist, wo die intimen Seiten der Figur angesprochen sind, ist es doch auch eine Frage von Kostüm und Auftritt, dass ihn der Despotismus eher schlecht zu kleiden scheint. Schön, wie Nucci dann in der Arie und im Duett des zweiten Aktes mit Arrigo – Säbel und Ordensbrust müsste er hierbei nicht tragen – sängerisches und menschliches Format in der erfüllten Kantilene zu Deckung bringt. Wie von selbst versteht sich dagegen der autoritäre Auftritt voller Pathos bei Ruggero Raimondis Procida. Sein «O tu Palermo» hat dunkel-pastosen Glanz wie je, die intriganten Anweisungen haben Griff und Schwärze, und die Mischung aus Vaterlandsliebe und eigensüchtiger Machtpolitik erhält in der imponierenden Erscheinung ihre verhängnisvolle Brisanz.
Nicht weniger spannungsvoll als die gegenläufige Entwicklung der beiden Vater- bzw. Führerfiguren verläuft diejenige des Liebespaares. Paoletta Marrocus Sopran mobilisiert einiges an zündender Attacke in ihrem aufwieglerischen ersten Auftritt, Marcello Giordanis Tenor besitzt die mühelose Spannkraft für den hochfahrenden Stolz im ersten Duett mit Monforte. Berührender Lyrismus macht dann des grosse, von unlösbarer Tragik geprägte Duett der beiden im Gefängnisakt zu einem Höhepunkt des Abends, und unvergesslich bleibt, wie beide schliesslich den anmutig leichten Ton finden, Paoletta Marrocu insbesondere für das Glanzstück ihrer Siciliana («Mercé, dilette amiche»), Marcello Giordani mit einem Aufstieg zum hohen D: Melodische Heiterkeit in schöner Übereinstimmung mit dem Moment, da für einen Augenblick politische Gegensätze aufgehoben scheinen und die Musik – Utopie oder tragische Ironie – davon spricht, was Leben auch noch sein könnte.
Wendige Frische
Man fühlt sich in dieser Szene an «Ernani» erinnert. «I Vespri Siciliani» haben überhaupt in der politischen Thematik viele Berührungspunkte mit Verdis Frühwerk, und doch ist alles aufgebrochener, komplexer. Carlo Rizzi am Dirigentenpult hatte damit kaum Probleme, vielleicht eher zu elegant musizierte er durch die Partitur, teilweise auch in schnellen Tempi, die eine gewisse Glätte mit sich bringen mochten. Momente der Gefährdung blieben aber marginal, und sehr vieles war in seiner wendigen Frische auch ungemein bezwingend, das Finale des dritten Aktes mit seinem Schwung, das Quartett-Finale des vierten Aktes in seiner gelösten Transparenz. Neben den erwähnten Protagonisten waren zahlreiche Solisten in kleineren Partien, aber auch der musikalisch auf vielfältige Art geforderte Chor und das mit Bläserbrillanz aufwartende Orchester, bei allen Vorbehalten, die im Übrigen auch das Publikum gegenüber dem Inszenierungsteam machte, an einem eben doch reichen Verdi-Abend beteiligt.
|

26. 5. 2004
Sängerfest in kargem Ambiente
Verdis nur selten gespielte «I Vespri Siciliani» wird im Opernhaus Zürich zu einem erstklassigen Sängerfest. Die Regie bleibt eindimensional.
Die Hochzeitsglocken zur Vesper sind gleichzeitig das Zeichen für das Massaker der Sizilianer an den Franzosen. Dolche blitzen auf, die Rückwand zeigt riesige rote Blutflecken. Unter Rachegeschrei stürzen sich die Unterdrückten auf die Besatzer, töten den Tyrannen Monforte und die übrigen Franzosen. Blackout und Ende der Oper.
Das Blutbad von 1282 ging als «Sizilianische Vesper» in die Geschichte ein. Giuseppe Verdi rückte bei seinem Auftragswerk für Paris (1855) die Beziehungen der Protagonisten ins Zentrum: Elena, die den sizilianischen Widerstandskämpfer Arrigo liebt, der erfahren muss, dass er der Sohn des Besatzers Monforte ist.
Düstere Versatzstücke
Der Konflikt zwischen Unterdrückern und Unterdrückten bildet das eine Hauptelement der Oper. Das zweite das Verhältnis von Monforte zu Arrigo mit den aufwallenden Vater-Sohn-Gefühlen. Die Verflechtung dieser beiden Ebenen wäre der Ansatzpunkt für die Inszenierung. Doch Regisseur Cesare Lievi überlässt die Sänger über weite Strecken sich selber - hilflose Gestik und immer wieder Rampensingen. Die grossen Chorszenen geraten überaus statisch. Ausstatter Maurizio Balò schuf ein karges Einheitsbühnenbild aus düsteren Versatzstücken. Auch die Lichtregie vermag keine stimmigen Akzente zu setzen.
Sängerische Glanzlichter
Musikalisch indes erweisen sich diese «Vespri Siciliani» als reiche Entdeckung. Zeitgenosse Hector Berlioz hatte 1855 «die Verschmelzung von französischen Opernelementen und Italianità» und die «Intensität des melodischen Ausdrucks» hervorgehoben. Bereits die (Potpourri-) Ouvertüre liess aufhorchen: Dirigent Carlo Rizzi musizierte mit dem Orchester der Oper Zürich drei Stunden überaus farbig und rhythmisch pointiert: Ausladende Concertati und Tableaus kontrastierten mit filigranen Piano-Stellen. Rizzi trug die Sänger auf Händen.
Diese liessen sich nicht zweimal bitten. Paoletta Marrocu sang die schwierige Sopranpartie der Elena mit dramatischer Attacke, nicht ganz frei von Schärfen, aber dennoch - wo gefordert - auch lyrisch-empfindsam. Als ihr Geliebter Arrigo liess Marcello Giordani aufhorchen: Ein kraftvoller Tenor mit offenbar unbegrenzten Reserven in der Höhe, subtilen Piani und schönem, wohlklingendem mezza voce.
Leo Nucci gestaltete den Monforte als vielschichtigen Charakter, geadelt durch seinen warmen, weich strömenden Bariton. Ein Höhepunkt seine Arie «In braccio alle dovizie», gesungen ohne jede Larmoyanz. Der vierte Italiener im Bunde war Ruggero Raimondi als Procida. Der Bassist beeindruckt noch immer durch die kluge Disposition seiner Mittel, obwohl die Stimme inzwischen an Glanz verloren hat. Die Nebenfiguren und der schlagkräftige Chor fügen sich harmonisch ins Ganze ein. Für das Produktionsteam setzte es an der Premiere kräftige Buhrufe ab, während Sänger und Dirigent enthusiastisch gefeiert wurden. Eine Rarität, die mit einem hochkarätigen Sängerquartett überzeugt und Zürichs umfangreiches Verdi-Repertoire bereichern dürfte.
|

25. 5. 2004
Konzert in Ruinen
Giuseppe Verdis «Vespri Siciliani» im Opernhaus Zürich
Es hätte noch schlimmer kommen können: Ein Land unter der Herrschaft fremder Eroberer, Besatzer, die die Bevölkerung demütigen und Bräute rauben, ein fanatischer Rebellenführer, der zum Widerstand aufruft - eine Aktualisierung von Giuseppe Verdis «Vespri Siciliani» unter aktuellen politischen Vorzeichen wäre leicht möglich gewesen. Der Regisseur Cesare Lievi und sein Ausstatter Maurizio Balò haben sie uns glücklicherweise erspart. Doch was sie stattdessen bieten - ein gefälliges Bildarrangement zwischen monumentalen Ruinen mit sizilianischen Einsprengseln in Gestalt von Puppenfiguren -, geht ebenso an dem Werk vorbei.
Wenn der politische Hintergrund der Handlung, die französische Belagerung Siziliens und das Massaker von 1282, derart neutralisiert wird, dass von Zwang, Gewalt und Auflehnung gar nichts mehr zu spüren ist, stehen auch die Figuren im Leeren. Denn die Liebesgeschichte zwischen der Herzogin Elena, die Rache für ihren von den Franzosen ermordeten Bruder geschworen hat, und dem Sizilianer Arrigo, der mit Entsetzen erkennt, dass er der illegitime Sohn des verhassten französischen Gouverneurs Monforte ist, erhält ihr dramatisches Potenzial einzig aus dem politischen Kontext, in dem sie steht. Dass dieser allerdings mehr schematischer als konkret historischer Art ist, belegt der Werdegang der von Verdi als Grand Opéra für Paris komponierten «Vêpres Siciliennes». Eugène Scribe hatte das Libretto ursprünglich unter dem Titel «Le Duc d'Albe» für Donizetti geschrieben, für Verdi wurde die Handlung aus den Niederlanden nach Sizilien verlegt, die spätere italienische Fassung erlebte weitere Orts- und Titeländerungen, bevor sie nach Aufhebung der Zensur im Original gespielt werden konnte.
Trotz ihrem melodischen Reichtum und ihrer ausgeprägten musikalischen Stimmungshaftigkeit sind die «Vespri Siciliani» ein Aussenseiter im Verdi-Repertoire geblieben, auch in Zürich, wo sie zuletzt 1971/72 auf dem Spielplan standen. Das hat zum einen wohl dramaturgische Gründe: Dem Werk fehlt der grosse Atem anderer Verdi- Opern, es wirkt uneinheitlich, inkonsistent. Zum andern stellt es extreme sängerische Ansprüche an die Interpreten der Hauptpartien. Dabei sind diese nicht einmal dankbar. Ihre innere Zerrissenheit, ihr Schwanken zwischen Liebe, Ehre und Pflicht machen es schwierig, mit den Figuren zu fühlen. Und der in seine Heimat zurückkehrende Rebellenführer Procida, der zu Beginn mit edlem Wohlklang sein Palermo besingt, entpuppt sich nur allzu bald als finsterer Fanatiker.
Auch in der Personenführung erweist sich Lievis Regie als weitgehend inexistent. Bei der Besetzung der drei männlichen Hauptrollen dagegen hatte Intendant Alexander Pereira eine ausgesprochen glückliche Hand. Leo Nucci präsentiert sich als Monforte in Bestform, sein Bariton «sitzt» in allen Lagen perfekt, der Ton entfaltet sich voll und rund, mit vielfältigen Schattierungen zwischen väterlicher Milde und Herrscherallüre. Marcello Giordani bewältigt die Partie des Arrigo - mit kleinen Abstrichen im zweiten Teil - souverän und verleiht seinem Tenor gerade so viel Druck, dass er Spannung gewinnt, ohne die Eleganz der Linienführung einzubüssen. Ruggero Raimondi zeichnet den Patrioten Procida mit dunklem Bass in all seiner Unbeugsamkeit und Härte. Paoletta Marrocu als Elena ist in diesem Männerkreis zwar die ambitionierteste Darstellerin, doch fehlt ihrem Sopran jene Stabilität, die die Stimmen ihrer Partner kennzeichnet. Deshalb empfindet man den Wechsel von hohen und tiefen, scharfen und dunklen, dünnen und durchdringenden Tönen weniger als Ausdrucksvielfalt denn als ein Nebeneinander unterschiedlicher Stimmen.
Der Dirigent Carlo Rizzi hält das grosse Ensemble mit festem Griff zusammen, dosiert den Klang differenziert, entwickelt Spannung nicht durch Lautstärke, sondern durch straffe Tempi und erhält vom Orchester - mit etwas dünn besetzten Streichern - guten Sukkurs. Die Chöre (Leitung: Ernst Raffelsberger) sind nicht nur einheitlich kostümiert - zartes Blau für die Franzosen, tristes Schwarz für die Sizilianer -, sie singen auch homogen. Als konzertante Aufführung könnte diese Neueinstudierung in Ehren bestehen.
Marianne Zelger-Vogt
|

28. 5. 2004
Strahlender Sieg über die Opernkonvention
Verdis unterschätzte Oper «I vespri siciliani» erhielt im Opernhaus Zürich dank hervorragender Solisten eine verdiente Rehabilitation, die leider von einer katastrophalen Inszenierung getrübt wurde.
Von Reinmar Wagner
Dass Verdis «Vespri siciliani» grob unterschätzt wird, zeigte die Zürcher Produktion deutlich. Nur weil Eugène Scribes Libretto nicht so geschickt und logisch ist, weil es zudem nach dem glücklichen Finale einen tragischen fünften Akt aufgepfropft erhielt und in der italienischen Fassung aus Zensurgründen in Holland oder Portugal angesiedelt werden musste, ist seine Musik nicht ebenfalls zweitrangig.
Im Gegenteil: «Les Vêpres Siciliennes» war Verdis erster Auftrag aus der damaligen Opernmetropole Paris - entsprechend war sein Einsatz. Grosse Chortableaus, ein Ballett, wirkungsvolle Szenen und eine raffinierte Orchesterpartitur heben das Stück mindestens auf das Niveau von «Simon Boccanegra». Diese Spannungsbögen waren in der Hand des Dirigenten Carlo Rizzi bestens aufgehoben. Mit der Koordination zwischen Bühne und Graben und mit der Präzision im Orchester selber tat sich der Italiener aber noch recht schwer.
Hervorragende Solisten
Der zweite, wohl wichtigere Grund, warum «I vespri siciliani» selten aufgeführt wird, ist die ausserordentliche Schwierigkeit zur Besetzung der vier Hauptrollen. Alexander Pereira hat das Wagnis auf sich genommen und dank eines hervorragenden Solistenquartetts einen strahlenden Sieg über die Opernkonvention davongetragen.
Vor allem die weibliche Hauptrol- le Elena stellt fast unerfüllbare Ansprüche: Martialisch ist die Auftrittsarie, die einen kräftigen, dramatischen Sopran verlangt, lyrisch klingen die Liebesszenen, und zum Schluss verlangt Verdi quirlige Beweglichkeit für akrobatische Koloraturen. Ein Fall für die Italienerin Paoletta Marrocu. Nicht alles gelang perfekt, aber auf höchstem Niveau beachtlich war jede ihrer Linien, glänzendes Metall lag ebenso in ihrer Stimme wie abgedunkelte, glühende Wärme. Und wo die Technik an ihre Grenzen stiess, da half ihre sängerische Ausdruckskraft weiter.
Pittoreskes Stehtheater
Drei Männer stehen ihr gegenüber, und auch hier bewies Pereira ein goldenes Händchen bei der Besetzung: Der Sizilianer Marcello Giordani begeisterte mit purem, bezauberndem Belcanto und einer wandlungsfähigen Tenorstimme, die auch fähig ist, grosse emotionale Ausbrüche ohne Forcieren zu gestalten.
Leo Nucci als Graf Monforte sang imposant und intonationssicher. Seine grosse Szene im zweiten Akt steht musikalisch der parallelen Stelle König Philipps im «Don Carlo» nicht nach. Etwas manieriert wirkte einzig das permanente Ansingen der Töne von unten, ein Stilmittel, das typisch ist für die Singweise dieses Baritons. Und auch Altmeister Ruggero Raimondi setzte seine ganze grosse Erfahrung und die dunkelsten Klangfarben zur mitreissenden Charakterisierung des Verschwörers Giovanni da Procida ein.
Es gab auch einen Regisseur für diese Opernhaus-Produktion: Cesare Lievi arrangierte Chöre und Solisten ausschliesslich als pittoreskes Stehtheater, dessen erste, einzige und wichtigste Regel lautet: Wenn du singst, dann bleib vorne in der Mitte und bewege ausser dem Kiefer höchstens die Arme. Tröstlich immerhin, dass man dafür heute in Zürich ausgebuht wird.
|

25. 5. 2004
Ansingen gegen die Besatzer
Verdis Oper «I Vespri Siciliani» handelt von Krieg, Besetzung, Gewissenskonflikten und Rache. In der Aufführung im Zürcher Opernhaus geht es aber vor allem um die prächtige Musik.
Von Susanne Kübler
Das Jahr 1282 ist lange her, und das war schon im 19. Jahrhundert so. Wenn Giuseppe Verdi den mittelalterlichen Aufstand der Sizilianer gegen die französischen Besatzer als Plot für eine Pariser Auftragsoper wählte, so tat er es trotzdem nicht für die historische Bildung seines Publikums, sondern aus aktuellem Interesse. Die Gegenwart war die Herausforderung, sie war auch das Problem des Komponisten und seines eher unwilligen Librettisten Eugène Scribe: «Die Franzosen sind beleidigt, weil sie niedergemetzelt werden», schrieb Verdi an den Direktor der Pariser Opéra, «die Italiener, weil Monsieur Scribe den historischen Charakter des Procida veränderte und einen ganz gewöhnlichen Verbrecher mit dem unvermeidlichen Dolch in der Hand aus ihm gemacht hat.»
Da traf der historische Konflikt eine gegenwärtige Spannung, so sehr, dass eine Aufführung des Stücks in Verdis Heimat erst 1861 möglich war, nach der Einigung Italiens (und sechs Jahre nach dem Pariser Erfolg). Kein Zufall also, dass Verdi an die weltverändernden Kräfte der Musik glaubte und den sizilianischen Aufstand auf Grund eines Liedes der Protagonistin ausbrechen liess.
Eine Oper ist eine Oper
Für Regisseur Cesare Lievi ist eine Oper dagegen kein Zeitstück, sondern eine Oper. Mit fast schon beeindruckender Konsequenz setzt er Themen wie die Demütigung der Besiegten oder ihre Rachelust rein dekorativ um: In düsterem Rahmen zwar, Ausstatter Maurizio Balò hat die stilisierten Ruinen auf der Einheitsbühne extra dunkelgrau gefärbt. Aber die Franzosen wirken mit ihren schmucken himmelblauen Uniformen genauso folkloristisch wie die Sizilianer mit ihren Kopftüchern. Und die Pferdestatue mit dem geköpften Reiter, die einem im ersten Bild den Hintern zukehrt, hat ihren einzigen Grund in der optischen Attraktivität; allfällige Ähnlichkeiten mit echten Statuen sind rein zufällig und liegen nicht in der Absicht des Regisseurs.
Was man vermisst in dieser Inszenierung, sind allerdings weniger «Tagesschau»-Bilder als eine eigene Position, eine durchaus in Verdis Sinn heutige intellektuelle Auseinandersetzung mit dem Stoff. Diese fehlt, nicht zum ersten Mal auf dieser Bühne. Dafür ist, ebenfalls nicht zum ersten Mal, ein wunderbares Ensemble zu hören: Gleich vier Hauptrollen gibt es in dieser Oper, und sie sind sängerisch und von der Bühnenpräsenz her auf höchstem Niveau gleichberechtigt besetzt.
Da sind einmal die Liebenden Elena und Arrigo (Paoletta Marrocu und Marcello Giordani), die den Aufstand gegen den französischen Gouverneur Monforte planen. Da ist eben dieser Monforte (Leo Nucci), der sich als Arrigos Vater zu erkennen gibt und diesen damit in schlimmste Gewissenskonflikte stürzt. Und da ist schliesslich der sizilianische Rebell Procida (Ruggero Raimondi), der seinen Rachefeldzug auch dann nicht stoppt, als alles zum Guten gewendet scheint.
Spannung an der Rampe
Auch wenn der Regie zu den Psychodramen dieser Protagonisten ebenso wenig einfällt wie zum politischen Hintergrund des Stücks: Es kommt erstaunlich viel Spannung auf beim Rampensingen. Zwar wirft sich Raimondi nach seinem Schlager «O Palermo» rezitalmässig in die Pose des Applausempfängers, zwar werden Liebe und Hass gleichermassen ohne Blick- und Körperkontakt behauptet, aber musikalisch vibriert es gewaltig.
Paoletta Marrocu zeichnet die Entwicklung der Elena mit starkem, virtuos geführtem, manchmal auch ganz zartem Sopran nach; Marcello Giordani bewältigt die enorm hohe Partie des Arrigo ohne jegliche Verkrampfungen, mit nur wenigen tenoralen Schluchzern und viel emotionaler Kraft. Ebenso überzeugend singen die beiden «elder statesmen», Ruggero Raimondi mit seinem substanzreichen Bass und Leo Nucci mit seinem trockeneren, aber immer noch charismatischen Bariton.
Auch der von Jürg Raffelsberger vorbereitete Chor nutzt die prächtigen Vorlagen engagiert und klangvoll. Nur selten wird er (wie manche der kleineren Vokalpartien) vom Orchester der Oper übertönt: Carlo Rizzi, der elastisch, mit schwungvollen Tempi und einer zuweilen überdeutlichen Hierarchie zwischen Haupt- und Nebenstimmen seine erste Zürcher Premiere dirigiert, setzt starke, auch lautstarke Akzente. Durchaus gezielt: Nach der missglückten Offenbarung von Monfortes väterlicher Liebe pfeift es zu Recht schrill aus dem Orchestergraben. So wird nicht nur eine Partitur gespielt, sondern eine Atmosphäre geschaffen - noch nicht ohne Koordinationsprobleme, aber spannungsvoll und nuancenreich.
Abenteuerliche Kehrtwendungen
Gerade die musikalischen Qualitäten zeigen aber auch die Schwierigkeiten von Verdis kaum zufällig eher selten gespieltem Werk: Neben eingängigen Arien und starken Ensembles, neben bewährten Tricks wie der Kombination von Bühnen- und Off-Gesang gibt es auch irritierende Momente: Melodien, die für heutige Ohren allzu lüpfig wirken in diesem inhaltlichen Zusammenhang, oder A-cappella-Stellen zu dritt und zu viert, die selbst bei dieser Besetzung schräg klingen.
Vor allem aber gibt es abenteuerliche Kehrtwendungen. So besingen Elena und Arrigo nach dem eben abgewendeten Todesurteil ihr Glück wie verliebte Teenager, und die Idylle ist so komplett, dass sie jeden Regisseur (ausser Lievi, der einfach kurzfristig auf Komödie umstellt) in eine Glaubwürdigkeitskrise stürzen würde. Der einzige Sinn dieser Szene liegt im musikalischen Kontrast und darin, dass sie eine enorme Fallhöhe schafft zur finalen Katastrophe, die dann ebenso abrupt eintritt: Die Glocken läuten, Monforte wird von den Rebellen ermordet, fertig. Was aus Elena und Arrigo wird, was sie Procida zu seinem «Coup» zu sagen haben, das verschweigt die Oper. Dass auch die Regie dazu stumm bleibt, erstaunt in diesem Moment nicht mehr.
|

25. 5. 2004
Sängerfest für ein unterschätztes Stück
Premiere von Verdis Grande Opéra «I vesperi siciliani» im Opernhaus Zürich
Die Italiener und die Franzosen, sie lagen sich als die grossen Opern-Konkurrenten immer wieder in den Haaren. Wer hat die sangbarste Sprache, wer die besten Opernkomponisten? Die Franzosen liebten den Ausstattungspomp, grosse Chöre und Balletteinlagen. Auch Giuseppe Verdi konnte dem nicht widerstehen und nahm vom renommierten Pariser Haus den Auftrag an - selbstverständlich für eine ausladende fünfaktige Grande Opéra französischer Herkunft.
«I vesperi siciliani» (1855) gehört zu Verdis längsten Opern, ist gesangstechnisch extrem fordernd und mit den grossen Chortableaus auch besonders aufwändig. Deshalb ist das Werk auch so selten zu hören. Im Opernhaus Zürich wagte man es nun wieder einmal und feierte am Premierenabend vom Sonntag die vier grandiosen Hauptdarsteller Leo Nucci (Monforte), Ruggero Raimondi (Procida), Marcello Giordani (Arrigo) und Paoletta Marrocu (Elena) mit stürmischem Applaus. Am Dirigentenpult gab Carlo Rizzi seinen beeindruckenden Einstand mit der ersten von ihm dirigierten Neuproduktion an diesem Haus.
Oper des unterdrückten Volkes
Auch «I vesperi siciliani» ist, wie der Nabucco, eine Oper des unterdrückten Volkes, das unter der Besatzungstyrannei leidet und schliesslich aufständisch wird und mordet. Die Geschichte geht auf das historische Ereignis von 1282 zurück, in welchem die Sizilianer im Zorn über die Provokationen französischer Soldaten ein Blutbad anrichteten, dem in einer Nacht um die 2000 Franzosen zum Opfer fielen. Gleichzeitig ist die Geschichte aber auch etwas gar vertrackt, was die Familienbande und Gefühlssphäre der Protagonisten betrifft.
Der aufständische junge Sizilianer Arrigo muss erkennen, dass er der uneheliche Sohn des französischen Tyrannen Monforte ist, den er bekämpft. Zudem ist er verliebt in Elena, deren Bruder ermordet wurde. Arrigo will diesen Mord rächen, verhindert im entscheidenden Moment aber den Mord an seinem Vater Monforte. Den Aufständischen droht der Henkerstod, doch Monforte, der seinen Sohn endlich gefunden hat, wird ganz versöhnlich, bricht die Hinrichtung ab und erlaubt seinem Sohn die Heirat mit Elena. Doch der brennende sizilianische Patriot Procida schürt den Volksaufstand weiter und nutzt die Amüsierstimmung der bevorstehenden Hochzeit, um beim Geläut der Vesper-Hochzeitsglocken loszuschlagen. Die Oper endet im Chaos des Mordens.
Verdi-Fest
Der musikalische Stil Verdis hat auch unter den Kompromissen, die er für die Grande Opéra im Formalen eingehen musste, nicht gelitten. Hinreissende Melodien, harmonische Raffinessen und tief empfundene Ensembles machen diesen Opernabend zu einem wahren Verdi-Fest. Auffällig ist die betont rhythmische Behandlung der Chöre, die eine Dynamik in das Geschehen bringt, die den mordenden Schluss nachvollziehbar macht. Ernst Raffelsberger hat die beiden Chöre - den Chor der Soldaten und den des sizilianischen Volkes - mit stringenter rhythmischer Kraft und subtil ausgeloteten harmonischen Farben zu prägenden Protagonisten gemacht.
Dass dies so brillant und leichtfüssig gelang, ist auch dem eher trocken und rhythmisch federnd aufspielenden Opernorchester zu verdanken. Carlo Rizzi fand die richtige Mischung von zupackender Dramatik und entspannter Melodik, wirkte sehr beredt im differenzierten Gewichten rhythmischer Episoden und fand so immer wieder zu einer luziden Leichtigkeit, die auch etwas vom französischen Esprit durchschimmern liess. Ausgezeichnet disponiert waren am Premierenabend die stark geforderten Bläser, die in dieser komplexen rhythmischen Faktur hoch präsent und intonationssicher wirkten.
Herausragende Sänger
Das waren fast ideale Voraussetzungen für die freie Entfaltung der grossen Stimmen. Die Tenorpartie des aufständischen Arrigo gilt als eine der schwierigsten, mit extremer Höhe und einem ständigen Schwanken zwischen heldischer Pose und glühender Liebe. Marcello Giordani verblüffte mit der Selbstverständlichkeit, mit welcher er diese fordernde Partie stimmlich einfärbte und zu einer ergreifend tiefgründigen Figur gestaltete. Einen Sizilianer aus innerster Überzeugung gab auch Ruggero Raimondi als ständig revoltierender Procida. Die Intensität und Wärme, die er mit seiner gut geführten Bassstimme ausstrahlte, machte ihn nicht einfach zum Bösen mit Dolch, sondern zu einem verinnerlichten tragischen Sieger.
Agil und geschmeidig wirkte daneben die souveräne Baritonstimme von Leo Nucci. Seine Wandlung vom primitiven Tyrannen zum versöhnlichen Vater gelang ihm mit vielschichtigen Nuancen und einer reichen Palette von Farben, über die er problemlos die grosse Kantilene zu spannen vermochte. Und zwischen diesen drei grossartigen Männerstimmen die Duchessa Elena. Paoletta Marrocu wuchs spürbar in die anstrengende Dramatik ihrer Partie hinein, fand dennoch immer wieder zu intimen Momenten und sang im vierten Akt ihr heiteres Brautlied, als wäre sie noch ganz frisch.
Inszenierung enttäuschte
Man war ganz gebannt von diesen Stimmen, von dieser Musik, sodass man das graue Einheitsbühnenbild von Cesare Lievi und Maurizio Balò kaum wahrnahm. Ein gestylter Trümmerhaufen, dieses Sizilien, und auf diesen Trümmern posieren die französischen Soldaten in hoch dekorierten blauen Uniformen und das Volk in ärmlichen grauen Gewändern und mit Krücken. Nur der Prospekt wechselt jeweils die Farbe. Konventionell und ästhetisch gibt sich diese Inszenierung, dazu aber auch ziemlich uninspiriert und brav. Das Publikum, das den Interpreten eben noch Bravostürme beschert hatte, machte seinem Unmut über diese Regie mit Buhrufen Luft.
Sibylle Ehrismann
|
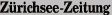
25. 5. 2004
Elf Sänger suchen einen Regisseur
Nach dreissig Jahren wieder am Opernhaus: «I vespri siciliani» von Giuseppe Verdi
Sie hat sich nie als Repertoire-Oper zu etablieren vermocht. «I vespri siciliani», Verdis Problem-Oper, bleibt problematisch auch in dieser Zürcher Neuinszenierung, die gerade im Szenischen masslos enttäuscht: Leerstellen, so weit das Auge reicht.
WERNER PFISTER
Der Anfang, das muss gesagt sein, ist viel versprechend: Unter der Leitung von Carlo Rizzi gewinnt die sehr grossformatige Ouvertüre überzeugend Gestalt und Form; man staunt über den Erfindungsreichtum, der auf «Die Macht des Schicksals» vorausweist, und freut sich über der zupackenden Spannung und Klangfantasie, mit der hier musiziert wird. Denn mag die Oper - respektive das Libretto - auch zum Schwächsten gehören, was Verdi in seinem Leben komponiert hat, die Musik hat durchaus ihre Meriten, insofern sie immer wieder hörbar Schatten vorauswirft auf Zukünftiges.
Allerdings, wenn sich der Vorhang dann hebt, wird es prekär. Ein Bühnenbild (Ausstattung: Maurizio Balò) von schon ausgesuchter Scheusslichkeit; Betonruinen, Quader, Blöcke, die übereinander und durcheinander liegen und stehen, eine Trümmerwüste im Niemandsland. Ein schiefes Reiterstandbild dominiert im ersten Akt, ein schiefer Tisch im vierten. Keine Frage, diese Welt ist aus den Fugen geraten, hier hat offenbar bereits jene Zerstörung vorgewütet, die laut Verdi erst ganz am Schluss der Oper, auf den letzten beiden Partiturseiten, hereinbricht, wenn die Sizilianer die Bühne stürmen und das grosse Morden beginnt. Aber vielleicht soll man es nicht so genau nehmen, sondern im übertragenen Sinn: zeitlos dann, beliebig eben.
Mücken
Sinn macht dieses Bühnenbild keinen; aber es verstellt viel Platz. Und macht alle jene Sängerinnen und Sänger ein bisschen lächerlich, die zu ihren hehren Auftritten über verschiedene Betonblöcke kraxeln müssen. Zudem gibt es zwischen Akt vier und fünf eine längliche Umbaupause, denn es müssen zwei offenbar von derselben allgemeinen Zerstörungswut niedergeknickte Palmen-Attrappen auf dem Bühnenhintergrund drapiert werden, auf dass jedermann merkt: Dieser Akt spielt im Freien. Und siehe da, ein Chorist schlägt sich dann bald einmal mit flacher Hand genervt an den Hals: Mücken stechen!
Rein szenisch ist dieses Bühnenbild vor allem eines: unpraktisch. Denn es verstellt viel Raum. Dieser würde dringend benötigt, um aus den Volksszenen, den brisanten - immerhin treffen Militärs der Besatzungsmacht, also Franzosen, auf die Unterdrückten, die Sizilianer -, dramatisches Feuer zu schlagen. Eine Konstellation schliesslich, wo es nur den sprichwörtlichen Funken bräuchte, und es käme zur Explosion. Doch davon merkt der Zuschauer rein gar nichts, denn Regisseur Cesare Lievi stellt Sizilianer und und Franzosen bereits im ersten Bild etwa so harmlos auf die Bühne, wie in Bachs «Matthäus-Passion» die beiden Chöre nebeneinander stehen. Entsprechend wird das grosse Chor-Tableau zum Schluss des dritten Aktes ein reines Konzertfinale.
Lilien
Für die Solosänger scheint mehr oder weniger dieselbe szenische Devise zu gelten: frontal ins Publikum schauen und vorn an der Rampe singen. Und wenn der Regie mal etwas einfällt - zu ihrem «Bolero» beispielsweise, eh schon schwierig zum Singen, muss Elena immense weisse Lilien, die sie gebündelt im Arm hält, einzeln auf den Boden werfen, auf dass eine entsetzte Dame aus dem Chor hinter ihr hereilt und die Lilien einzeln wieder aufliest -, dann ahnen wir selbstverständlich, wie das zu lesen wäre: dass nämlich Elena intuitiv(?) spürt, dass ihre blütenweisse Hochzeit nicht stattfinden wird. Recht hat sie zwar, aber das Spiel mit den Blumen wirkt dennoch hilflos.
So bleibt es also, wo die szenische Interpretation das problematische Werk derart unbeholfen im Stiche lässt (und zum Schluss entsprechend Buhrufe einstecken muss) - so bleibt es also der musikalischen Interpretation vorbehalten, eine Ehrenrettung dieser problematischen Oper zu versuchen. Der Versuch gelingt - ich würde sagen: gut zur Hälfte. Dort aber besonders überzeugend, nämlich was die drei Protagonisten anbelangt. In Marcello Giordani steht für die ebenso aufwändige wie letztlich etwas undankbare Rolle des Arrigo ein Tenor zur Verfügung, der seine Phrasierungen ganz aus dem Wortlaut und Wortsinn des gesungenen Texts entwickelt. Bei Verdi ist das eminent wichtig, in den Rezitativen wie in den Arien, und es führt hier zu einer rundum bewundernswerten Leistung: lyrischer Tenorglanz, der zuweilen fast an den jungen Domingo zu erinnern scheint.
Zwei Kämpen
Vielleicht noch stärker beeindruckt die vokale Kompetenz, welche Ruggero Raimondi und Leo Nucci, die grossen alten Kämpen des Fachs, beide über sechzig, ins Feld zu führen vermögen. Raimondi hat den Procida bereits 1970 in der legendären Scala-Produktion gesungen; heute überzeugt er vor allem durch seine baritonal gestählte Höhe. Zuweilen irritieren ein paar Vokalverfärbungen, zumal wenn sie die Intonation gefährden. Leo Nucci ist gleichsam die Inkarnation des Monforte: hin und her gerissen zwischen der Liebe zu seinem neu entdeckten Sohn Arrigo und zur Liebe zu seiner Macht, zwischen mächtigem Aufbegehren und gütiger Zärtlichkeit, dem er beidem mit seinem urgesunden, markanten Bariton eine fast furchteinflössende Intensität verleiht.
Wohl die grössten Anforderungen stellte Verdi an die Partie der Elena, die einerseits mit dramatischem Aplomb das ganze Ensemble zu übertönen hat und andrerseits im fünften Akt einen leichtgewichtigen, koloraturgespickten «Bolero» zu singen hat. Gerade dieser gelingt Paoletta Marrocu, die zum ersten Mal die Elena singt, wenig überzeugend. Ihre grosse Stimme will sich nur mit grosser Energie in die Höhe treiben lassen; zudem würde mehr Wortdeutlichkeit zu leichtgewichtigeren Phrasierungen führen. Umgekehrt dominiert Paoletta Marrocu die grossen Ensembleszenen fulminant. Ein spezielles Lob verdienen Chor und Zusatzchor des Opernhauses (Einstudierung: Ernst Raffelsberger), die hier gleichsam eine Protagonistenrolle haben und diese mit klangvoller, oratorienhafter Intensität erfüllen.
|

