Aufführung
|

26. 9. 2004
(Première)
*
Musikalische Leitung: Stefano Ranzani
Inszenierung: Cesare Lievi
Bühnenbild: Csaba Antal
Kostüme: Marina Luxardo
Lichtgestaltung: Jürgen Hoffmann
Einstudierung der Chöre: Ernst Raffelsberger
*
Stiffelio: José Cura
Lina: Emily Magee
Stankar: Leo Nucci
Raffaele: Reinaldo Macias
Jorg: Günther Groissböck
Federico: Martin Zysset
Dorotea: Margaret Chalker
SYNOPSIS - LIBRETTO - HIGHLIGHTS
|
Rezensionen
|
|
|
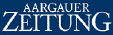
28. 9. 2004
Energisch am Stück vorbeigesungen
Rarität: Giuseppe Verdis «Stiffelio» zum ersten Mal am Opernhaus Zürich
Das Libretto sei schlecht und szenisch nur schwer umsetzbar; die Musik scheint blass und ohne Höhepunkte zu sein. So lauten die Vorurteile über Verdis «Stiffelio». Am Opernhaus Zürich geschieht nichts, um sie zu widerlegen.
CHRISTIAN BERZINS
Schön warm und sehr gemütlich war es am Sonntagabend im Opernhaus Zürich: Es gab viel Champagner, leckere Brötchen, schöne Kleider, die berühmten Sänger sangen laut und folglich wurde zum Schluss heftig «Bravo» geschrien. Auf dem Programm stand nichts weniger als eine kleine Sensation: Eine 1850 in Triest uraufgeführte Oper von Giuseppe Verdi, die noch nie am Opernhaus gezeigt worden war - das will bei der Verdi-Liebe beziehungsweise Verdi-Sucht des österreichischen Intendanten etwas heissen.
Auch wer Verdis «Stiffelio» noch nie gehört hat, dem wird die Musik nicht völlig neue Perspektiven vor Ohren geführt haben. Verdi schien nach «Luisa Miller» (1849) nichts Neues hervorbringen zu wollen oder zu können. Erst mit der dem «Stiffelio» folgenden Trias «Rigoletto», «Trovatore» und «Traviata» stieg er in den Olymp auf.
Protestantische Handlung
Liebevoll wird «Stiffelio» seit zwei Jahrzehnten immer wieder mal aufgeführt. Dann wird jeweils gezeigt, wie ein evangelischer Prediger von seiner Frau betrogen wird. Zur Überraschung aller Beteiligten ruft er in einem Gottesdienst zur Vergebung auf. Trotz Szenen dramatischer Ehr- und Liebesbezeugungen wie Eifer- und Rachsucht zeigt die protestantische Handlung meist nur wenig Wirkung. Es sei denn, ein Regisseur setzt das Ehebruchdrama schlüssig in Szene oder ein Dirigent setzt diese trotzige Musik mit ihren lyrischen Lichtblicken packend um. Beides ist in Zürich nicht der Fall.
Regisseur Cesare Lievi begnügt sich damit, Stimmungen zu zeigen: Düster ist das Licht (Jürgen Hoffmann), mächtig einfach sind die Bühnenbauten (Csaba Antal), lapidar symbolisch die Kostüme (Marina Luxardo).
Schön und gut, nur lässt sich halt eine Opernhandlung an der Rampe vorne nicht erzählen. Dank der Bühnenpräsenz von José Cura und Leo Nucci erhalten wenigstens zwei Protagonisten Charakterzüge. Aber Reinaldo Macias als Verführer und Emily Magee als Verführte stehen hilflos auf der Bühne. Und obwohl die vier Protagonisten Verdis Töne treffen, gerät die Aufführung musikalisch in eine Sackgasse.
Schuld ist der italienische Dirigent Stefano Ranzani, der das zweieinhalbstündige Werk grobschlächtig dirigiert: Wenns süss schwärmerisch klingen könnte, tönts bei ihm dick und aufgesetzt; wenn in Fortepassagen die Farbigkeit des Klangs ausgeschöpft werden könnte, herrscht bei Ranzani tumbe Kraftmeierei. Selbst Holzbläsersoli wirken nur mehr einfältig. Aber eben: Da war auch ein Leo Nucci mit unnachahmlich sprechendem Gesang und Kraftreserven aus dem letzten Jahrhundert zu hören. Und Emily Magee sang zwar mit etwas (zu) scharfer Sopranstimme, aber dafür mit einem beglückenden Detailreichtum und grosser Persönlichkeit.
Verhaltensorigineller Tenor
José Curas Persönlichkeit ist so gross, dass sie auch verhaltensoriginell genannt werden kann. Aber der fotografierende wie dirigierende Tenor hält sich und seine manchmal überschäumenden Kräfte im Zaum und singt durchaus passabel. Seine Stimme hat unterdessen die Eigenschaften einer alten Jeanshose: Manchmal wirkt so etwas cool, bei genauerem Hinsehen merkt man aber, dass an den exponierten Stellen geflickt wurde und dass weite Teile farblos geworden sind.
Trotz allem war zur ersten Zürcher Premiere der Saison die Stimmung allenthalben gut, über die paar Buhs für den Regisseur konnte der Intendant gelassen hinweghören. Die Chance, etwas Sinnvolles für das Werk getan zu haben, wurde verspielt.
|

28. 9. 2004
Skandalstück von einst
Rarität von Verdi: «Stiffelio» am Zürcher Opernhaus
ANDREAS KLAEUI
Ein Jahr vor «Rigoletto» komponiert, ist Verdis «Stiffelio» eine kaum bekannte Grösse in der Opernwelt. Verdi wandte sich damit erstmals einem zeitgenössischen Sujet zu.
So etwas musste ja Kopfschütteln auslösen. Ein verheirateter Priester, der seine Frau ertappt, als sie ihn mit einem jungen Mann betrügt - der Stoff von «Stiffelio» musste einem katholischen Publikum um 1850 derart sonderbar vorkommen, dass die Oper bei den Zeitgenossen durchfiel. Gut möglich, dass Verdi, der selber in einer Beziehung lebte, welche von der Mutter Kirche nicht gesegnet war, ein persönliches Interesse mit dieser Geschichte verband, in welcher der Titelheld und Priester Stiffelio seiner Gattin Lina am Schluss vergibt - mit Verweis auf die Geschichte von Jesus und der Ehebrecherin.
Jedenfalls lag ihm so viel an seinem «Stiffelio», dass er nach dem Misserfolg der Oper beschloss, ein neues Werk auf der Grundlage der «Stiffelio»-Partitur zu komponieren: «Aroldo». «Stiffelio» ist bis heute eine Rarität geblieben. Auch das Zürcher Opernhaus führt das Stück zum ersten Mal auf. Es ist natürlich die Musik, in der die Qualitäten dieses Werks liegen. «Stiffelio» entstand fast gleichzeitig mit «Rigoletto», unmittelbar danach schrieb Verdi «La traviata» und «Il trovatore».
Hinreissende Musik. In «Stiffelio» gibt es hinreissende Musik. Überraschende musikalische Einfälle, zielsichere Effekte, weit ausschwingende Melodiebögen und harmonisch betörende Ensembles, das ist Verdi vom Besten. Hinzu kommt das exotische Ambiente einer protestantischen Sekte - Anlass zu mancherlei romantischen Gebets- und schauerlichen Friedhofsszenen und zum grossen Theatercoup am Schluss, als Stiffelio von der Kanzel herab eine gesungene Predigt hält.
Artige Umsetzung. Das ist eine Entdeckung wert. Nur hätte man sich gewünscht, dass diese Entdeckung einen inspirierteren Sachwalter gefunden hätte als den Dirigenten Stefano Ranzani, der mit dem Opernhaus-Orchester einen zwar soliden Verdi hinlegte, aber nicht mehr. Ein Kapellmeister-Verdi sozusagen: Jeder Ton war da, aber bei jedem Ton konnte man sich vorstellen, wie er noch hätte klingen können, was man aus dieser Partitur auch noch hätte herausholen können.
Regisseur Cesare Lievi zeigt Stiffelio, den Mann, der an seiner Heiligenlegende bastelt, beim Modellbau eines übermenschengrossen Tempels. Darüber hinaus beschränkt sich Lievi darauf, die Sänger schön an die Rampe zu führen und dann auch mal an einen Tisch zu setzen. José Cura legt als Stiffelio dramatische Verve an den Tag, ist aber stimmlich so überanstrengt, dass fast nur noch gepresstes Näseln zu hören ist. Emily Magee als Lina führt ihren lyrischen Sopran makellos, doch mangelt es ihr an «Italianità». Echte italienische Klangkultur gabs einzig bei Leo Nucci: ein solide polierter Bariton. Das war die nur gerade ordentliche Aufführung eines Werks, das mehr verdient hätte.
|

28. 9. 2004
«Stiffelio»-Premiere im Opernhaus
Musik wie an der Chilbi
VON ROGER CAHN
Zwei Weltstars - Tenor José Cura und Bariton Leo Nucci - retten eine schwache Oper von Giuseppe Verdi. Das Publikum bejubelt Parforce-Leistungen der Sänger. Premiere war am Sonntag.
Es ist ein Spiel um Liebe und Ehre vor dem Hintergrund religiöser Heuchelei. Stiffelio, Führer einer protestantischen Sekte, verarbeitet den Treuebruch seiner Gattin, indem er Gefühl und Pflicht in Einklang zu bringen versucht.
Bei diesem Unterfangen kommen ihm alle Beteiligten in die Quere. Jeder versucht, das Problem mit den ihm angemessen scheinenden Mitteln zu lösen. Übersteigertes Ehrgefühl des Schwiegervaters beendet schliesslich das grausame Spiel der Emotionen mit Mord. Die Heuchelei obsiegt.
Schade, dass Verdi für diesen Stoff nicht die passende Musik komponiert hat. Unter Zeitdruck - er musste unbedingt «Rigoletto» für Venedig fertig machen - klingen einige wirkungsvolle Themen an, die Psychologie der Figuren ist oberflächlich. Schon bei der Ouvertüre wird klar: Hier gibts bestenfalls «Chilbimusik mit Niveau». Fehlender Tiefgang und der Mangel an grossen Arien sind mit ein Grund, weshalb «Stiffelio» in Vergessenheit geraten ist.
Stefano Ranzani am Pult tut herzlich wenig, um diesen Eindruck Lüge zu strafen. Er dirigiert laut, schnell, undifferenziert. Die Abstimmung zwischen Graben und Bühne wackelt teils bedenklich; die Sänger brüllen, um das Orchester zu übertönen. Zwischentöne, die echte Gefühle und nicht nur Wut oder Rache ausdrücken, gibts nicht.
Dabei gelingt Regisseur Cesare Lievi eine stimmige Inszenierung. Der massive Kirchenbau betont die Macht der Religion als «Opium des Volkes». Lievi reduziert auch geschickt das für italienische Opern typische Rampensingen und zeichnet die Personen so genau wie möglich - mehr der Handlung folgend als der Musik.
Fazit: Das Beste an «Stiffelio» ist, dass die Oper nach zweieinhalb Stunden zu Ende ist. Pause inbegriffen.
|

28. 9. 2004
Krise einer charismatischen Persönlichkeit
Verdi selber hat «Stiffelio» nicht zu den Werken gezählt, die getrost vergessen werden dürften wie andere aus seiner Feder. Warum er ihm ein besseres Schicksal wünschte, macht das Opernhaus deutlich.
Herbert Büttiker
Verdis zentrale, um 1850 entstandene Trias mit «Rigoletto», «La Traviata» und «Il Trovatore» ist eigentlich eine Tetrade: «Stiffelio», parallel zu «Rigoletto» für Triest komponiert, hatte zwar nur ein kurzes Bühnenleben, und auch die veränderte Form, in der Verdi die Oper sechs Jahre später in Rimini als «Aroldo» präsentierte, brachte dem Werk keinen dauernden Erfolg. Die Wiederaufführung der ursprünglichen Fassung, die Quellenfunde in den sechziger Jahren möglich machten (Erstaufführung 1968 in Parma), gilt seither aber allenthalben als Sensation. Lange hat es gedauert, bis die Oper nun auch nach Zürich gelangt ist, eine Verdi-Sensation ist die Premiere auch hier: Das musikalische Niveau der Aufführung unter der Leitung von Stefano Ranzanz rückt die Qualitäten der lange vernachlässigten Partitur in ein helles Licht, mit Emily Magee, José Cura und Leo Nucci erhalten die Hauptpartien ein starkes Profil, und die Inszenierung (Cesare Lievi, Csaba Antal, Marina Luxardo) besticht durch eine packende Personenführung und eine stimmungsstarke Bühne, die die konzentrierte Dramaturgie des Stücks unterstreicht. Weniger als einige Detailfragen und ein verunglückter Szenenwechsel gibt allerdings die grundsätzliche Deutung der Handlung und vor allem des Charakters der Titelfigur Anlass zur Diskussion.
«Der werfe den ersten Stein»
Die seltsame Karriere des «Stiffelio» hat mit der Provokation eines zeitgenössischen Stoffes zu tun, der sperrig war nicht nur für die damalige Zensur, sondern auch für das Publikum. Erzählt wird (nach einem 1849 uraufgeführten Stück der französischen Autoren Emile Souvestre und Eugène Bourgeois) die Geschichte eines protestantischen Sektenpfarrers im Salzburgischen. Nach langer Abwesenheit zurück, ist er mit dem Ehebruch seiner Frau Lina konfrontiert. Deren Vater, Graf und Oberst Stankar, der die Familienehre beschmutzt sieht und zuletzt den Verführer (Reinaldo Macias) im Duell tötet, möchte, dass die Tochter das Geschehene verschweigt. Entsprechend geht Stiffelio einen langen Weg bis zur vollen Gewissheit.
Es ist ein Weg voller dramatischer Spannung, auf dem Stiffelio im Widerspruch zwischen dem Sturm seiner Gefühle und der Milde seiner christlichen Haltung zu zerbrechen droht. Am Ende des zweiten Aktes sinkt er ohnmächtig am Kreuz nieder. Der dritte Akt bringt eine doppelte Kulmination: In einer grossartig komponierten Duettszene muss Lina in die Scheidung einwilligen. Erst danach hat sie vor ihrem Mann als Priester die Gelegenheit zu gestehen, dass sie auf hinterhältige Art verführt worden ist und dass sie nach wie vor nur ihn liebt. Die Schlussszene spielt in der Kirche. Für seine Predigt schlägt Stiffelio zufällig die Stelle auf, die von Jesus und der Ehebrecherin handelt: In einem kurzen musikalischen Aufschwung wird das Wort der Bibel zu seinem eigenen, und Lina, die sich vor ihm niedergeworfen hat, steht auf und ruft mit erhobenen Händen Gott an – so die letzte Szenenanmerkung.
Versöhnlich oder zynisch?
Nicht so die Zürcher Inszenierung. Sie mündet in eine Pose starrer Hierarchie – Lina ausgestreckt am Boden, Stiffelio auf der hohen Kanzel. Die Szene ist so zu lesen als «Inszenierung», mit der Stiffelio die Kontrolle über die Gemeinde, die er mit seinem allzu menschlichen Verhalten gefährdet hat, wieder übernimmt. Statt Versöhnung – vor allem Stiffelios mit sich selbst! – also Dominanz, statt der Theologie der Gnade (Max Ulrich Balsiger im Programmheft) die grosse Geste zur Wiederherstellung der Glaubwürdigkeit (José Cura in der Opernhauszeitschrift): ein frostiges Finale. Ist es auch Verdi?
Einiges deutet darauf hin, dass die Inszenierung zwar richtige Schlüsse zieht, aber aus falschen Voraussetzungen. Stiffelio ist gerade nicht ein Mann, der Gesetz, Ordnung und Moral rigid vertritt. Das zeigt die erste Szene, wo er statt Gerüchten über einen Skandal nachzugehen die Indizien vernichtet. Nicht unähnlich dem «Maskenball»-Riccardo schlägt er einen leichten Ton an. Konzilianz ist sein Naturell, Versöhnlichkeit auch seine Botschaft als Priester, und wie sein Charisma auf seine Umgebung wirkt, lässt das «Gioia e Pace ...» des Festchores hören. Was folgt, ist die Zerstörung eines integren Charakters durch die Leidenschaft: Otellos Schicksal, ein Zwiespalt nicht zwischen Amt und Person, sondern im Menschlichen selbst mit seinen hellen und dunklen Seiten.
Die Helle bleibt in der Zürcher Aufführung ausgespart. Elemente einer kühlen und monumentalen Sakralarchitektur, die alle Lebensfreundlichkeit ausschliessen, beherrschen die Schauplätze in dunklen Grau- und Brauntönen. Schwarz dominiert auch die hochgeschlossenen Kostüme. Zum Festgesang gruppiert sich die farblose Menge wie im Käfig auf dem Baugerüst: Der Kirchenbau steht auch da ganz im Zentrum. So zielt die ganze Ausstattung ästhetisch raffiniert, expressiv und treffsicher auf das Porträt einer alle Lebendigkeit unterdrückenden religiösen Gemeinschaft.
Eine finstere Figur
Ihren Protagonisten, den Sektenpriester Stiffelio, zeichnet José Cura in diesem Kontext ungemein plastisch: mit grossartiger Körperbeherrschung bis in die Fingerspitzen und im musikalischen Charakter differenziert. Sein baritonal gewichtiger, in den Attacken aber flexibler, in den weiten Gesangsbögen etwas nasaler und in Spitzentönen auch rauer Tenor kommt den darstellerischen Intentionen entgegen: da die steife Kontrolle des Auftretens und der Gefühle, da die durchbrechende Leidenschaft, dazwischen wenig, was im tenoralen Schmelz Güte, idealen Schwung bedeuten könnte – eine finstere Figur im Ganzen, die mehr erschreckt als berührt und zuletzt wenig Anlass dazu gibt, sich über das zynische Finale zu wundern, das Verdi vermutlich anders gemeint hat.
Die Rolle des moralisch-religiösen Eiferers hat im Stück eigentlich ein anderer. Es ist der alte Jorg, Aufpasser und Wächter über Stiffelios Amtspflichten, eine kleine Basspartie, mit der Günther Goissböck in dieser Inszenierung logischerweise ganz im Schatten seines Schützlings bleibt. Stankar, Linas Vater, hingegen ist eine der grossen Vaterfiguren Verdis, die mit Glanz und Gloria im Kampf um die Familienehre Unheil anrichten, aber musikalisch alle Trümpfe in der Hand haben: Leo Nucci hat in allen Bereichen die Möglichkeiten, sie mit sattem Griff auszuspielen: autoritär, sentimental, hochfahrend und draufgängerisch bis zur Erschöpfung. Dass Emily Magee sich gerade in den grossen Duetten mit ihm und Stiffelio als ausdrucksstarke und dramatisch packende Partnerin durchsetzte, zeugte von souveräner sängerischer Präsenz. Eine Frage des Tempos war wohl die Kurzatmigkeit der ersten Preghiera, ihre Arie im zweiten Akt jedenfalls, ein auch von der ätherischen Begleitung der geteilten Streicher her wunderbares Stück Musik, war einer der grossen Momente des Abends.
Brillanz und Innigkeit
Überhaupt: Wie dicht und kontrastreich sind diese zwei Stunden Musik zwischen kammermusikalischer Intimität und hämmernden Cabalettas, vielschichtigen Ensembleszenen und berührenden Kantilenen. Die Sinfonia mag irritieren, weil sie ein Gesangsthema bringt, das nicht in «Stiffelio», sondernerst in «Aroldo» vorkommt («Sotto il sol di Siria ardente»). Ihre Allegro-Brillanz stellte die Inszenierung hingegen mehr in Frage als nötig. Stefan Ranzani allerdings liess sich nicht beirren und stellte ihre Effekte so schmissig heraus, wie es nur eben ging. Mit manchen Tempi mochte er an obere Grenzen stossen, da und dort war das Zusammenspiel von Orchester und Bühne auch gefährdet. Aber immer wieder war schwungvolle Dramatik auf den Punkt gebracht, innige Passagen erhielten Raum, und der Chor des Opernhauses konnte sich (die A-cappella-Preghiera der Finalszene!) hinreissend entfalten: Vieles an diesem Abend war Verdi pur.
|

28. 9. 2004
Innere Zerrissenheit
Das Opernhaus Zürich zeigt erstmals Giuseppe Verdis «Stiffelio». In der Titelrolle überzeugt José Cura als leidenschaftlicher Priester.
«Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie». Dieses Zitat aus dem Johannes-Evangelium steht über dem ganzen Werk. «Stiffelio» (1850 uraufgeführt) erzählt die Geschichte des gleichnamigen protestantischen Priesters, dessen Frau Ehebruch begeht. Am Schluss verzeiht ihr Stiffelio grossmütig. Vorlage für das Libretto war das 1849 erschienene französische Drama «Le Pasteur, ou l'Évangile et le Foyer» von Émile Souvestre und Eugène Bourgeois.
Giuseppe Verdi interessierte an diesem Stoff das Psychogramm der Titelfigur zwischen kirchlichem Amt und privatem Eheschicksal. Verdi schrieb das Werk 1850, als er sich bereits intensiv mit dem «Rigoletto» beschäftigte. Dennoch fand er für «Stiffelio» unkonventionelle und innovative Kompositionsmittel. Das Bühnenbild (Csaba Antal) mit einer im Bau befindlichen Kirche unterstreicht die verhalten-düstere Atmosphäre. Regisseur Cesare Lievi arrangierte konventionell-gefällige Tableaus; die seelischen Konflikte der Figuren werden indes kaum glaubhaft herausgearbeitet.
Im Zentrum der Oper steht Stiffelio, in Zürich herausragend gesungen von José Cura. Der 38-jährige argentinische Tenor verkörpert die innere Zerrissenheit der Figur mit starker Bühnenpräsenz. Seinem dunkel, fast baritonal timbrierten Tenor gewinnt er überraschend samtene Töne ab. In den starken Gefühlsausbrüchen weist Curas Stiffelio auf Otello voraus. Als seine Frau Lina hinterlässt Emily Magee einen zwiespältigen Eindruck. Ihr Sopran klang an der Premiere seltsam matt und scharf in den Höhen, und sie kämpfte mit Intonationsproblemen. Einmal mehr in blendender Verfassung zeigte sich Leo Nucci als Linas Vater Stankar. Der Baritonveteran demonstrierte Verdi-Gesang in Reinkultur. Eine zu Recht umjubelte Leistung. Das Orchester der Oper Zürich unter Stefano Ranzani gefiel durch packenden Drive und schöne Soli.
STEFAN DEGEN
|

28. 9. 2004
Düsterkeit überall
Verdis «Stiffelio» im Opernhaus Zürich
Erneut brachte das Opernhaus Zürich eine italienische Opernrarität auf die Bühne: Giuseppe Verdis «Stiffelio» (1850). Erstmals hatte Verdi hier einen zeitgenössischen, bürgerlichen Stoff gewählt, was das Werk zu einem wichtigen Vorläufer der «Traviata» macht. «Stiffelio» ist ein im Grunde waghalsiges Stück, denn es geht um Ehebruch, Ehre, Vergeltung und göttliche Vergebung, und das alles in den kirchlichen Kreisen einer (frei erfundenen) Sekte. Hauptpersonen sind der Sektengründer Stiffelio, seine Frau Lina, ihr Vater Graf Stankar, Linas Verführer Raffaele und Stiffelios Alter Ego, der Priester Jorg. Am Ende hat Stankar Raffaele umgebracht und Stiffelio die Scheidung von seiner ihn immer noch liebenden Frau vollzogen, doch die von Stiffelio im Gottesdienst zufällig aufgeschlagene Bibelstelle mit Jesus, der der Ehebrecherin verzeiht, bringt die versöhnliche Kehrtwendung. Die Thematik enthielt zu ihrer Entstehungszeit einen solchen Zündstoff, dass die Zensur einschritt.
Die Oper, verstümmelt, blieb erfolglos. Ob sie in der Originalfassung damals mehr Erfolg gehabt hätte? Wir treffen auf ein Stück Musiktheater mit durchaus innovativen Zügen, neuen Inhalten und einer Musik, die streckenweise auf den späteren Verdi vorausweist, aber auch ihre arg routiniert klingenden Stellen hat. Die Dramaturgie ist nicht optimal gelöst; der Verführer etwa bleibt seltsam blass. Man will nicht glauben, dass Lina diesem Gecken ihren Ring geschenkt hat. Da müsste doch musikalisch, inhaltlich spürbar werden, dass einmal zwischen den beiden Funken sprangen.
Die dunkle Atmosphäre des Stücks wird durch die Zürcher Inszenierung von Cesare Lievi im Bühnenbild von Csaba Antal unterstrichen. Gefangen zwischen den Säulen einer im Bau befindlichen abstrahierten Kirche agieren die Personen. Ihre Kostüme (Marina Luxardo) legen das Geschehen in die Entstehungszeit des Werkes; eine Betonmischmaschine im Hintergrund, ein Baggerarm, der ins Bild reicht, sind Versuche, das Geschehen auch etwas auf unsere Gegenwart zu beziehen. Grautöne, Brauntöne, schwarz und das Rot des Blutes herrschen vor. Düsterkeit also überall, ein gekonnter Aufbau, aber keine wirkliche Prägnanz. Das Beste ist die unaufdringliche (und dringend notwendige), raffiniert mit ständigen Farbveränderungen spielende Lichtgestaltung von Jürgen Hoffmann. Kunstgerecht und fachmännisch führt Lievi in diesem Raum die Figuren. Es ergeben sich eindringliche Momente, die dann aber plötzlich wieder in Klischees kippen können. Reizbilder versuchen, uns direkt zu packen - aber ach, auf etwas gar abgestandene Weise. So nimmt Stiffelio die Klinge des Schwertes in die blossen Hände und verletzt sich dabei. Er erhält gleichsam die Wundmale Christi, geht zum Kreuz, wo er sich in entsprechender Pose die Hände abwischt.
Vergeblich versucht Lievi mit solchen und ähnlichen Bildern die Brisanz ins Stück zurückzuholen, die es zur Entstehungszeit gehabt haben muss. Eine eher kunsthandwerkliche Inszenierung also, die wohl kaum in dauerhafter Erinnerung bleiben dürfte. Auch den Figuren gibt Lievi unterschiedliche Aufmerksamkeit. Reinaldo Macias singt Raffaele tadellos, doch die Regie vermittelt einem das Gefühl, er sei einer andern Oper entsprungen. Dem Stiffelio von José Cura ist die Zerrissenheit der Gefühle - zwischen Rachsucht und Versöhnung von Verdi mit Sorgfalt gestaltet - anzumerken. Er findet vor allem im leisen Ausdruck unglaublich schöne Farben und eine starke Eindringlichkeit. Im lauteren Bereich und in höheren Registern wird sein Timbre jedoch schnell etwas nasal, und im dritten Akt litt bei der Premiere gar die Intonation. Einen grossen Abend hatte Emily Magee mit ihrem Rollendébut als Lina. Sie erfüllte die zentrale Frauengestalt des Abends mit Leben, gestaltete sie enorm vielfältig, genau und mit wunderbarem Zeitgefühl; auch vermochte sie innerhalb dieser düsteren, erstarrten Gesellschaft zu zeigen, was erotische Ausstrahlung ist.
Gross war der Auftritt von Leo Nucci als Graf Stankar, der vom Publikum geradezu frenetisch gefeiert wurde. In den Nebenrollen agierten Günther Groisböck, Martin Zysset und Margaret Chalker sicher, und der von Ernst Raffelsberger vorbereitete Chor des Opernhauses Zürich überzeugte vor allem auch bei den heiklen A-cappella- Stellen. Die musikalische Leitung lag in den Händen von Stefano Ranzani, der seinen Verdi genau kennt und das Orchester der Oper Zürich kundig, mit schönen Farben, allerdings im Piano auch etwas undifferenziert durch das Werk führte.
Alfred Zimmerlin
|

28. 9. 2004
Kein Glück mit Verdi
«Stiffelio» langweilt in seiner Erstaufführung am Zürcher Opernhaus
Kein Glück mit Verdi am Zürcher Opernhaus: Ein interessantes Stück wäre zu entdecken, doch «Stiffelio» reiht sich nahtlos in eine Serie szenisch unbedarfter Verdi-Produktionen.
Tobias Gerosa
So brav und belanglos kann Oper sein. Als wäre es die Fortsetzung seiner «Vespri Siciliani» vom Mai, vermisst man in «Stiffelio» (der in Zürich zum ersten Mal überhaupt zu hören ist) nur schon den Versuch einer szenischen Interpretation des Regisseurs Cesare Lievi. Dabei könnte die Handlung um den Sektenführer Stiffelio, um Familienehre und Eifersucht, durchaus spannend sein.
Verweise ins Leere
Während das düstere Bühnenbild Csaba Antals mit seinen groben, schwarzen Pfeilern Archaik oder totalitäre Prunkbauweise suggeriert, verlegen Lievi und seine Kostümbildnerin Marina Luxardo «Stiffelio» in die Entstehungszeit um 1850. Doch alle angedeuteten Zeichen der Inszenierung verweisen ins Leere und die Solisten bewegen sich durchwegs vorne zwischen Tisch und Rampe. Zur Personenführung wie zu den dramaturgisch aussergewöhnlichen Szenen fällt Lievi wenig ein.
So nimmt man Jose Cura als Sektenführer Stiffelio die Wandlung zum vergebenden Pfarrer kaum ab, zu sehr betont er zuvor den Rächer. Auch stimmlich gestaltet er die Rolle als veristischen Vorläufer: Konstant unter Hochdruck, bisweilen skandiert und mit seltsam verfärbten Vokalen. Cura bringt so eine ungeheure Energie auf die Bühne, bleibt der musikalischen Linie aber zu vieles schuldig. Überhaupt steht es um diese und den Gesangsstil nicht besonders gut, denn auch Emily Magee als untreue (oder: verführte) Ehefrau Lina hat in leisen Stellen vor allem vor der Pause ihre Mühe mit ihnen.
Wo Dramatik oder Führungsrolle in Ensemble gefragt ist, überzeugt Magee deutlich mehr. Doch wie Veteran Leo Nucci, der ihren Vater Graf Stankar in bester stilistischer Gesangstradition, aber mit nasalem Timbre und von unten angeschliffenen hohen Tönen singt, bleibt sie auf die szenischen Standardgesten beschränkt.
Verdi im Graben
Dirigent Stefano Ranzani versucht zwar mit Verve und Elan, auch die Brüche des Werks hörbar zu machen, doch wo die Oper in ihren Szenen und Ensembles, welche die Arien der Nummernopern weit gehend verdrängen, die Konvention hinter sich zu lassen beginnt, führt sie die Inszenierung ständig wieder ein.
|

28. 9. 2004
Grosse Oper um eine kIeine Story im Opernhaus
Die Geschichte vom Pastor Stiffelio hört sich an wie eine rührselige Familienstory aus dem romantischen 19. Jahrhundert. Seine Frau Lina wird von einem jungen Edelmann verführt. Die ganze Gemeinde weiss es, ausser Stiffelio selbst. Linas gestrenger Vater Graf Stankar sieht die Ehre seiner Familie so sehr besudelt, dass er sich umbringen will. Doch er besinnt sieh und fordert den Verführer zum Duell. Inzwischen kapiert auch Stiffelio den Ehebruch. Auch ein Gottesmann ist mir ein Mann: Er massregelt brutal die arme Lina, zieht nun selber das Schwert gegen seinen Widersacher. Da erinnert ihn sein Kollege Jorg ans Kreuz, und Stiffelio predigt zur Gemeinde über die Ehebrecherin, der Christus verzeiht. Lina wirft sich vor die Kanzel, Stiffelio verzeiht auch ihr.
Den Zwiespalt zwischen Gesetz und Ehre und persönlicher Schwäche und Leidenschaft haben andere schon besser beschrieben, als es dieses Libretto tut. Doch Verdi gelangen dazu aussergewöhnlich packende Szenen, die die kleine Geschichte zur kurzen, aber grossen Oper machen.
Prächtig leidende Arien und kraftvolle Auftritte
Für die Ensembles hat er schönsten Melodienreichtum erfunden. Prächtig leidende Arien hält er für Lina bereit, kraftvolle Auftritte für ihren Vater. Stiffelio bedachte er zwar mit weniger Schmelz, dennoch ist er die zentrale Figur: Hin und her gerissen zwischen dramatischer Eifersucht, gekränkter Liebe und Ehre und seinem Glauben. Die Produktion wartet mit prominenter Besetzung auf. Tenor José Cura zeigt als Stiffielio alle Nuancen zwischen pastoraler Verinnerlichung und temperamentvoller Männlichkeit nicht nur äusserlich ideal, sondern auch stimmlich. Leo Nucci ist ein eindringlicher Graf Stankar. Ein Ereignis, wie kraftvoll und präsent er für sein Alter die Stimme führt. Zwischen diesen Glanzlichtern hatte es Emily Magee als Lina an der Premiere schwer. Da fehlte es oft am gestalterischen Zurücknehmen, an Tiefe und manchmal an Luft. Auch Dirigent Stefano Ranzani liess beim Orchester einiges an Ungenauigkeiten durch, machte dies dafür mit Spontaneität wett. Cesare Lievis Regie glaubt an die innere Grösse der an sich kleinen Story, inszeniert sie als dunkle, grosse Oper. So ist dieses in Zürich erstmals gezeigte Verdi-Werk mehr als Repertoirepflege, sondern eine entdeckenswerte Rarität.
Hans Uli von Erlach
top
|

28. 9. 2004
Gefühlslagen eines gehörnten italienischen Pastors
Kein überragender, aber ein überraschender Verdi: Das Opernhaus Zürich zeigte am Sonntag erstmals «Stiffelio».
Von Thomas Meyer
Erstaunlich, dass ein Stück wie dieses «Dramma lirico» die Zensur 1850 so sehr beschäftigte und schliesslich zu grundlegenden Änderungen führte: Ein protestantischer Priester (Stiffelio) wird von seiner Frau (Lina) betrogen und findet schliesslich nach einigen Konflikten und der Ermordung des Nebenbuhlers durch den Schwiegervater zur Vergebung. Ein verheirateter und erst noch gehörnter Pfarrer - das ging natürlich nicht im katholischen Italien. Für die Aufführungen in Rom und Neapel wurde daraus sogar ein deutscher Minister namens Guglielmo Wellingrode. Giuseppe Verdi war es verständlicherweise bald einmal leid, das Stück weiter umzuarbeiten, und liess es schliesslich aus dem Verkehr ziehen. Nur dank zwei in Neapel wiederaufgefundenen Partituren konnte die Oper in den späten 1960er-Jahren rekonstruiert und aufgeführt werden.
Unbestrittene Qualitäten
Umso erstaunlicher wirkt des Komponisten Missbehagen, denn sein Werk enthält, wie sich sofort zeigt, unbestrittene Qualitäten: effektvolle Szenen, die schon den ganzen Verdi enthalten, schöne, wenn auch etwas ungewöhnlich geführte Vokallinien, eine zügige, unkomplizierte Erzählweise, die nicht in starren Formen verharrt. Und doch erstaunt es nicht wirklich, denn Verdi holte in den wenig später vollendeten Opern «Rigoletto» oder «La Traviata» etliche der Gefühlslagen und Themen, die im «Stiffelio» aufscheinen, wieder hervor und gestaltete sie noch um einiges zwingender: etwa das Motiv der verführten Tochter, des Konflikts zwischen Vater und Liebhaber, der Entsagung und der Tugendhaftigkeit. Dabei drehte Verdi die Schrauben um ein paar Windungen an, sodass das Drama unausweichlich wird.
Betonte Bildhaftigkeit der Regie
Das fehlt ein wenig in «Stiffelio». Auffallend sind dramaturgische Schwächen: Das Schlussbild etwa in der Kirche, in dem Stiffelio die Szene zwischen Christus und der Ehebrecherin aus dem Johannes-Evangelium vorliest und so selber zur Vergebung gelangt, ist seltsam kurz geraten, es bringt keine Steigerung, allenfalls eine Sakralisierung und vor allem eine Moral in die Geschicht'. Und wenn man unglücklicherweise, wie Regisseur Cesare Lievi das in Zürich zulässt, gerade da eine Umbaupause einfügt (wie schon im 1. Akt), so werden Handlungsfluss und Spannung empfindlich gestört. Doch diese Zerstückelung legt auch die Bildhaftigkeit frei, die Lievi betont.
Wir haben es mit fünf Tableaux zu tun, die statisch wirken. Die hohen Bühnenarchitekturen von Csaba Antal verstärken diesen Eindruck. Sie schaffen einen äusseren Raum, legen aber kaum das innere Drama frei. Dunkel ist dieser Raum ebenso wie die Kostüme von Marina Luxardo. Darin leuchtet einzig das vampirhafte Rot des Verführers Raffaele (Reinaldo Macias, ein echter Playboy) auf; Lina trägt dieses Blutrot im Kragen, als sei sie schon gebissen worden. Lievi spinnt das Motiv weiter: Auf dem Friedhof schmiert Stiffelio niedersinkend seine blutenden Hände am Kreuz ab: Das ist folgerichtig, aber kitschig. Man ist denn auch froh, dass Lievi nicht noch weitere Einfälle hatte.
Das Beste an dieser Regiearbeit ist vielleicht, dass sie nicht zu erklären versucht, was Verdi und sein Librettist Francesco Maria Piave ausliessen, und dass so die Musik in den Vordergrund tritt. Diesen Raum muss sie sich allerdings erst erobern. Jedenfalls wirkt sie im 1. Akt noch etwas unmotiviert, ja unkonzentriert. Dirigent Stefano Ranzani strafft zwar die Zügel, wenn es schnell wird, und schafft schöne Effekte, aber die innere Spannkraft der Klänge lässt er uns vorerst nur stellenweise spüren. Und so fehlt sie auch im Gesang: Das erste Solo von Stiffelio (José Cura) klingt erstarrt, bei Lina (Emily Magee) fallen Unsicherheiten und ein überreiches Vibrato auf, selbst ihr Vater Stankar (Leo Nucci) kommt noch nicht richtig in Fahrt.
Musikalisch überzeugend
Die Leistung des Orchesters (ohnehin die des Chors) gewinnt aber zunehmend an Präzision, und auch alle drei Hauptdarsteller steigern sich im Lauf des Abends. Emily Magee findet schon im 2. Akt auf dem Friedhof zu innigeren Tönen, und ihre Bitte um Verzeihung im 3. Akt wird zu einem Höhepunkt. Leo Nucci als Stankar ist es freilich, der den Abend für Momente herausreisst. Verdi hat für ihn die brillanteste und auch effektvollste Partie geschrieben: einen Gottesmann, der auf Rache sinnt.
Er ist der eigentliche Drahtzieher der Handlung und nicht Stiffelio, der eher zum Handeln gezwungen scheint. Entsprechend undankbar ist die Titelrolle: Stiffelios Gefühle schwanken zwischen Wut, Misstrauen und Verzeihung - er ist ein früher Otello, allerdings ohne die emotionale Intensität des späten Verdi. José Cura, der als Otello in Zürich so sehr überzeugte, versucht nun glücklicherweise in keiner Weise, den Stiffelio aufzumotzen. Diese Rolle, mit der er vor zehn Jahren in Covent Garden debütierte und auffiel, wirkt keineswegs abgespielt oder übertrieben. Cura sucht vielmehr auch die feineren Töne hervorzuheben, ein inneres Drama also - eine intelligente Darstellung, wenn er damit auch kaum oberflächlich begeistern kann. Aber das ist es letztlich eh nicht, was diese insgesamt musikalisch überzeugende Produktion vermöchte.
|

28. 9. 2004
Verdi wie aus dem Geschichtsbuch
Neuinszenierung von «Stiffelio» des Regisseurs Cesare Lievi am Opernhaus Zürich
Kein Glück mit Verdi am Zürcher Opernhaus: Die Neuinszenierung von «Stiffelio» des Regisseurs Cesare Lievi reiht sich nahtlos ein in eine ganze Reihe vor allem szenisch unbedarfter Produktionen ohne Idee und Gestaltungswille. Während Dirigent Stefano Ranzani mit viel Elan durch die Partitur führt, überzeugen die Solisten trotz grossen Namen nur beschränkt. Dabei wäre erstmals in Zürich ein durchaus interessantes Stück zu entdecken.
Erst im letzten Mai inszenierte Cesare Lievi im Opernhaus seine letzte Verdi-oper. Auch damals war es ein selten gespieltes Werk («I Vespri Siciliani»), das mit klingenden Sängernamen lockte. Als wäre es die Fortsetzung, bleibt die Regie auch diesmal belanglos und langweilig, nicht einmal ein Versuch einer szenischen Interpretation des Regisseurs ist zu erkennen. Und so gibt's einmal mehr Oper wie aus dem (italienischen) Bilder- oder Geschichtsbuch. Dabei könnte die Handlung um den Sektenführer Stiffelio, der seine Frau des Ehebruchs überführt, um Familienehre und Eifersucht durchaus spannend sein. Könnte.
Schwarz und abgestumpft
Während das düstere BühnenbildCsaba Antals mit seinen groben, schwarzen Pfeilern Archaik oder totalitäre Prunkbauweise suggeriert, verlegen Lievi und seine Kostümbildnerin Marina Luxardo «Stiffelio» in die Entstehungszeit um 1850. Die Sektenmitglieder in ihren Arbeitermützen sehen aus wie frühe Industriearbeiter, schwarz und abgestumpft.
Doch es könnte irgendeine Zeit sein: Das Ölfass zu Beginn brennt nur zum Verbrennen der kompromittierenden Papiere, und auch die einsame Baggerschaufel im dritten Akt oder der mit ein paar ausgestreckten Kinderarmen plakativ-bemüht gezeigte Guru-Status der Titelfigur verweisen ins Leere.
Überraschend schlichter Schluss
Der Chor darf mehr oder weniger malerisch im Hintergrund stehen und singen (und tut das, einstudiert von Ernst Raffelsberger, mit einigen ungenauen Einsätzen, aber solide), während sich die Solisten durchwegs vorne zwischen klobigem, altdeutschem Tisch und Rampe bewegen.
Dass Stiffelio den offensichtlich noch nicht fertig gebauten Tempel selber entwirft, ist die dominanteste Regie-Idee - auch sie von beschränktem Aussagewert - aber zur Personenführung wie zu den dramaturgisch aussergewöhnlichen Szenen wie dem überraschend schlichten Schluss fällt Lievi wenig ein. Ganz unüblich rasch lässt Verdi hier seine Protagonisten nochmals ihre so unterschiedlichen Gefühlslagen präsentieren, bevor der Blick Stiffelios auf der Kanzel in der aufgeschlagenen Bibel auf die Geschichte von Jesus und der Ehebrecherin fällt und er seiner Frau vergibt. Der Mord am Nebenbuhler Raffaele (von Reinaldo Macias so blasiert gespielt wie unauffällig gesungen), den Linas Vater zur Rettung der Familienehre verübt hat, ist ob der Vergebung für die Frau vergessen.
Beschränkt überzeugt
Dem Stiffelio von José Cura nimmt man diese Wandlung nur beschränkt ab, zu sehr betont er zuvor den Rächer. Auch stimmlich gestaltet er die Rolle als Vorläufer des Verismo: konstant und noch im Leisen unter Hochdruck, oft skandiert und mit seltsam verfärbten Vokalen. Cura bringt so eine ungeheure Energie auf die Bühne, bleibt der musikalischen Linie aber manches schuldig.
Überhaupt steht es um den spezifischen Gesangsstil nicht besonders gut, denn auch Emily Magee als untreue (oder verführte) Ehefrau Lina bekundet in leisen Stellen vor allem vor der Pause Mühe. Wo Dramatik oder Führungsrolle im Ensemble gefragt ist, überzeugt sie deutlich mehr. Doch wie Veteran Leo Nucci, der ihren Vater Graf Stankar in bester stilistischer Tradition, aber mit nasalem Timbre und von unten angeschliffenen hohen Tönen singt, bleibt Magee auf die szenischen Standardgesten beschränkt.
Dirigent Stefano Ranzani versucht mit Verve und Elan, auch die Brüche hörbar zu machen. Doch wo die Oper in ihren Szenen und Ensembles, welche die Arien der Nummernopern weitgehend verdrängen, die Konvention hinter sich zu lassen beginnt, führt sie die Inszenierung ständig wieder ein.
Tobias Gerosa
|
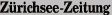
28. 9. 2004
Regie? Kaum der Rede wert
Zürich: Verdis «Stiffelio» am Opernhaus
Gleichzeitig wie «Rigoletto» komponierte Verdi «Stiffelio» - die eine Oper wurde eines seiner populärsten Werke, die andere blieb fast vergessen - trotz einiger bemerkenswerter Details zu Recht, wie eine Aufführung am Zürcher Opernhaus zeigte.
REINMAR WAGNER
Eine Verdi-Oper mit bloss zwei grossen Szenen - eine für den Sopran, eine für den Bariton, und keine für den Tenor und Titelhelden Stiffelio. Gut, Otello hat auch keine eigentliche Arie, und wenn Stiffelio auch nicht mit dem Mohren auf Zypern zu vergleichen ist, so wäre die Figur an sich spannend und in ihrer Doppelgesichtigkeit und in ihrem inneren Konfliktpotenzial vielversprechend. Allein, Verdi hatte keine glückliche Hand mit dem Prediger Stiffelio. Knapp und mit vielen Brüchen vollzieht sich die Handlung, die auf ein französisches Bühnenstück und ein Libretto von Piave zurückgeht: Ein Sektenführer hat einst auf der Flucht bei Stankar Zuflucht gefunden und baute eine Gemeinde und ein Haus mit der Tochter seines Beschützers. Sie betrügt ihn, er - zerrissen zwischen persönlicher Rache durch seine befleckte Ehre und seiner Vorbildfunktion als Pastor, zerrissen durch seinen Konflikt zwischen Körper und Kreuz - schafft es nicht, Ordnung und Vergebung und Geborgenheit herzustellen. Einem herbeigezwungenen Happy End ist kaum zu trauen, umso mehr als es durch einen Mord ermöglicht wurde, allein das allles findet kaum Resonanz in Verdis Partitur. Wie ein Fragment liegt sie vor uns, an allen Ecken und Enden erwartet man Ergänzungen und Erklärungen, Momente des Innehaltens für grosse Arien. Aber die Gelegenheiten streichen ungenutzt vorbei. Einzige Erklärung: Verdi hat sein Interesse an dem Sujet während der Arbeit verloren, hat sich der Pflicht zur Vollendung entledigt - auch die Ouvertüre klingt wie ein schnell gemachtes Patchwork - und danach «Rigoletto» und seine nächsten Werke ins Auge gefasst.
Besonderheiten
Wenn auch dieses Urteil einfach ist - und von der Rezeptionsgeschichte untermauert wird (welche Verdi-Oper ist denn in Zürich bisher noch nie auf der Bühne gestanden?), so ist «Stiffelio» doch interessant als Markstein auf dem Weg Verdis vom Dutzendschreiber zum Opernmeister. Dass er die Titelfigur so unkonventionell arienlos und eingebunden ins dramatische Geschehen entwirft, entspricht keineswegs damaliger Usanz, sondern, zeigt den Willen, von den Schematismen der Oper wegzukommen.
Und aufhorchen lässt seine Orchestrierung: Da überraschen verblüffende Farben und fast exotisch anmutende Pizzicato-Kombinationen, da bezaubern Duette von Soloinstrumenten und Gesang. Und auch etwa die grosse Szene des Baritons eröffnet dramaturgische und musikalische Besonderheiten, die vorausweisen auf kommende Meisterstücke,
Wenn die Erkenntnisse soweit gediehen sind, und das sollten sie so etwa nach einer Woche Probezeit spätestens sein, dann setzt normalerweise die Überlegung ein, wie man denn Interessantes herausarbeiten und Unvollendetes und Unvollkommenes am besten ergänzen könnte. Allein, in dieser Zürcher Produktion hat - bis auf eine Ausnahme - niemand wirklich funktionierende Lösungen für diese Herausforderungen gefunden - und wohl auch nicht gesucht.
Mit Leben gefüllt
Die Ausnahme? Sie heisst José Cura. Der argentinische Tenor war der Einzige, der seine Figur wirklich mit Leben füllte, der es fertigbrachte, Intensität und Glaubwürdigkeit zu schaffen und einen wirklichen Menschen in wirklichen Konflikten zu zeigen. Manche Gesten wirkten plakativ, deswegen aber nicht unglaubwürdig, in manchen Mitteln des sängerischen Gestaltens neigte Cura zum übertreiben - dynamisch zum Beispiel oder mit dem Einsatz seiner nasalen Klangfarben -, aber in der Tat gestaltete er seine Partie im Sinn dieses Wortes und brauchte sich dabei nicht durch sängerische Limiten einzuschränken. Emily Magee - was die sängerische Seite ihrer Aufgabe betraf - stand ihrem Partner nur wenig nach: Dramatik in den Koloraturen, dynamische Schattierungen, Intensität in den exponierten Tönen. Szenisch jedoch blieb sie in stereotypen Operngesten gefangen, vom Regisseur Cesare Lievi wie alle anderen im Stich gelassen. Bei Leo Nucci staunt man immer wieder, wie er in seinem Alter über eine nach wie vor potente und strahlkräftige Stimme verfügt. Dass er nichts Differenzierteres draus macht, hat wohl nichts mit seinem Alter zu tun. Und wenn man ihm weiterhin derart zujubelt wie das Zürcher Premierenpublikum, dann wird er das nächste Mal noch lauter brülIen und sich freuen über das «nördlichste Opernhaus Italiens».
Blindlings
Vielleicht war auch italienisch, was Stefano Ranzani am Pult vollfühhrte: Hauptsache die Melodie fliesst schön. Dass es auch einen Grundpuls geben könnte, dass rhyhthmische Energie möglicherweise ein Element von Dramatik abgeben könnte, dass man auch einem José Cura nicht einfach blindlings in seine agogischen Eskapaden folgen muss, sondern vielleicht solche Unregelmässigkeiten auch als Spannungen betrachten könnte, solches scheint Ranzani fremd zu sein. Umgekehrt schaffte er es ohnehin kaum, Bühne und Orchester zusammenzuhalten in den heiklen Momenten - davon gibt es viele, und Verdi ist offenbar deswegen auch wieder von seinen exponierten Solobläser-Sänger-Paarungen nach dieser Erfahrung etwas weggekommen.
Gnädig im Dunkeln
Cesare Lievis Regiearbeit ist - nicht zum ersten Mal - kaum der Rede wert. Wer nicht, wie Curà, selbst Hand an seine Partie legte, brauchte sich nicht viel mehr als das Links oder Rechts seines Auftritts zu merken. Der Chor blieb gnädigerweise meist im Dunkeln - und klang auch Männer-seitig seltsam dünn. Die Figuren wurden kaum fassbar wie etwa der Liebhaber Raffaele (Reinaldo Macias) oder blieben Stereotypen wie der Vater (Leo Nucci), der sich auch durch grosse Musik nicht von seiner Militärmützen-Logik ablenken lässt. Nicht einmal mit dem durchaus bedauernswerten Sopran leiden wir so richtig mit. Bis auf eine diffuse Atmosphäre von deutsch-nordischer Düsternis wurden weder die innere noch äussere Welt dieses Stücks fassbar. Die Bühn von Csaba Antal verband monumentale Tempelassoziationen mit aufbauerischer Aufbruchsstimmung, neckisch illustriert durch StahIstreben, Betonmischer und Baggerschaufel. Und die Kostümbildnerin Marina Luxardo schneiderte das beste Stück für sich selbst. Zum Schlussapplaus, der nur durch wenige Buhs ausgezeichnet wurde.
|