|
Aufführung
|

12. 7. 2002
(Première)
*
Musikalische Leitung: Nello Santi
Inszenierung: Gilbert Deflo
Ausstattung: William Orlandi
Lichtgestaltung: Jürgen Hoffmann
Chor: Ernst Raffelsberger
*
Il Duca di Mantova: Piotr Beczala
Rigoletto: Leo Nucci
Gilda: Isabel Rey
Sparafucile: László Polgár
Maddalena: Carmen Oprisanu
Giovanna: Melinda Parsons
Il Conte di Monterone: Pavel Daniluk
Marullo: Valeriy Murga
Borsa: Boguslaw Bidzinski
Il Conte di Ceprano: Giuseppe Scorsin
La Contessa: Rosa Maria Hernández
Usciere: Darren Lougée
Paggio della Duchessa: Violetta Radomirska
*
Chor des Opernhauses Zürich
Statistenverein am Opernhaus Zürich
Orchester der Oper Zürich
|
|
Rezensionen
|

15 .7. 2002
Prima la musica
Saisonende mit Verdis "Rigoletto" im Opernhaus Zürich
Als sich der Vorhang öffnete, ging ein leises Aufatmen durch den Zuschauerraum: Nach Peter Mussbachs düsterer "Carmen"-Inszenierung präsentiert sich die "Rigoletto"-Bühne von William Orlandi als eine wahre Augenweide, eine Farbensinfonie in Rot und Gold. Allerdings: Die gründerzeitlich dekorierte Rückwand des Saales im Palast zu Mantua hat Kulissencharakter, der Raum wird in dieser und allen folgenden Szenen umfasst von schwarzem Gemäuer, welches die visuelle Entsprechung zum Fluch Monterones bildet, jenes vom Hofnarren verspotteten Vaters, der den Herzog anklagt, weil er seine Tochter geschändet hat. Dieser Fluch, von Pavel Daniluk eindringlich gesungen, stellt das Leitthema der Oper dar. Er trifft den am sittenlosen Herzogshof zynisch gewordenen Rigoletto dort, wo er am verwundbarsten ist, in der Liebe zu seiner Tochter Gilda, die er als kostbaren Besitz hütet und von der Umwelt abschirmt. Hier der Bezirk der Macht, dort der private Bereich: Auf diesen Gegensatz hin hat Gilbert Deflo seine Inszenierung angelegt. Der Anspruch des Individuums auf Freiheit, Würde und Menschenrechte manifestiert sich dabei in der Bildsprache des 19. Jahrhunderts, in Kostümen, die auf die Entstehungszeit von Verdis Oper anspielen, und in Szenerien, welche aus der Renaissance in die frühe Industriezeit führen. Stimmungs- und Symbolgehalt lässt sich Orlandis Räumen nicht absprechen: nach dem Festsaal das dicht verschlossene Jungmädchenzimmer Gildas mit seiner Pflanzenmuster-Tapete und seinem neugotischen Mobiliar, umrahmt von weissen Lilien, später die von Engelsfiguren eingefasste Fensternische, in der Gilda ihre Arie "Caro nome che il mio cor . . ." singt, der Salon im Herzogspalast: ein düsterer Abstellraum, die Behausung des von Laszlo Polgar fast aristokratisch gezeichneten Mörders Sparafucile: ein Industrieareal mit Ausblick auf eine Fabrik. Doch die Schauplätze bilden lediglich eine Abfolge von Einzelbildern, zwischen denen störende Umbauten erforderlich sind. Und sie bleiben Dekoration, weil Deflos Personenführung konventionellsten Mustern folgt: die Hauptdarsteller immer schön in der Mitte und an der Rampe, der Chor symmetrisch um sie herum gruppiert. Der Zwischenapplaus nach praktisch sämtlichen "Nummern" ist da schon mitinszeniert.
Die Protagonistinnen und Protagonisten der Neuinszenierung hat man in wechselnden Konstellationen alle schon in der früheren Zürcher Produktion sehen können. Im Mittelpunkt steht diesmal Leo Nucci. Für ihn, der den buckligen Hofnarren in seiner langen Karriere schon rund 400 Mal verkörpert hat, hätte es einfach eine "Rigoletto"-Premiere mehr sein können. Doch von Routine ist an diesem Abend nichts zu spüren, wohl aber sprechen aus jeder Phrase, jeder Geste Nuccis enorme Erfahrung und ein unbedingter Einsatz für die Aufgabe, wie sie sich hier stellt. Reich ist seine Farb- und Ausdruckspalette, exemplarisch seine Sprachbehandlung und noch immer phänomenal seine Höhe. Die jungen Sänger aus dem Ensemble präsentieren sich ihrerseits in Bestform. Piotr Beczala stattet den leichtlebigen Herzog mit verführerischem tenoralem Glanz und Schmelz aus und macht mit seinen fulminanten Spitzentönen kleine Schwankungen in der Tongebung vergessen. Isabel Rey ist eine sehr lyrische, innige und zarte Gilda, die die Kantilenen gleichsam mit dem Silberstift zeichnet. Dabei kommt die Liebe zum Vater allerdings glaubhafter zum Ausdruck als die Leidenschaft für den Herzog, dem Gilda ihr Leben opfert. Geradezu luxuriös besetzt ist die kleine Partie der Maddalena: mit der brillanten Carmen Oprianu.
Wie viele "Rigoletto"-Aufführungen mag Nello Santi geleitet haben, seit er 1951 mit dieser Verdi- Oper sein Dirigentendébut gegeben hat? Doch auch für ihn scheint die Partitur immer noch neue Facetten bereitzuhalten, noch mehr Farben, noch mehr dynamische Schattierungen. Sein Impetus ist unvermindert, der höfische Glanz kommt ebenso zur Geltung wie der Überschwang der Liebenden, doch über allem liegt der schreckliche Fluch, der sich an Rigoletto vollzieht. Das Orchester hat am Ende einer langen Saison nochmals mit aller Konzentration und in animierter Musizierlaune gespielt. Denn schliesslich war diese Premiere eine verspätete Hommage zum 70. Geburtstag des beliebten Zürcher Maestro. Zwar keine Premiere mit echtem Festspielcharakter - dazu hat die Inszenierung zu wenig Profil -, wohl aber ein Fest: ein Fest für Nello Santi.
|

15. 7. 2002
Gesellschaftskritik im klassischen Sinn?
Mit einem bejubelten «Rigoletto» hat das Zürcher Opernhaus dem Publikum noch einmal gegeben, was es liebt: Sängerprominenz, Italianità und üppige Bühnenbilder.
Von Michael Eidenbenz
War das nun der Ausgleich, sozusagen die Rache für «Carmen»? Während Peter Mussbach bei der ersten Festspiel-Premiere vor drei Wochen noch minuziös sämtliche Klischees umschifft hatte, durften diese nun in Gilbert Deflos Inszenierung im Übermass zurückprasseln, verschwenderisch wie der Regen aus Styroporkügelchen, der im dritten Akt ein bedrohliches Unwetter über Mantua darstellen sollte.
Nun sind Klischees der Kunstform Oper seit je eingeboren und können, clever eingesetzt, sehr wohl Sinn haben. Und tatsächlich spielt diese Inszenierung in ihren Ansätzen einen Moment lang mit ihnen: Die Renaissance-Party am Hof von Mantua ist demonstrative Show. Figuren des 19. Jahrhunderts haben sich zu ihrem Amüsement verkleidet, die läppischen Tänzchen des Balletts und die grotesken Hofkurtisanen sind ironische Accessoires einer vergnügungssüchtigen Gesellschaft - jener im Publikum, die für eine letzte Galavorstellung der Saison Ticketpreise von bis zu 380 Franken zu zahlen bereit war, wohl gar nicht so unähnlich.
Soll man da die Interpretation noch weiter forcieren? Resultiert da womöglich Gesellschaftskritik im klassischen Sinn? Ist Rigolettos Schicksal, den der Fluch einer in seinem Geschäftsleben als Hofharr verübten Tat unerbittlich im privaten Leben ereilt, womöglich eine Warnung an die Bilanzen fälschenden Geschäftshelden unserer Tage? Ach nein, wir wollen nicht übertreiben, Gilbert Deflo tut es schliesslich auch nicht. In der Folge geht dann nämlich alles seinen erwartbaren Opemgang. Man tritt auf stellt sich in die Bühnenmitte, singt mit Bravour, lässt die Handlung jederzeit zum Ernten von Publikumsovationen unterterbrechen, und so etwas wie, Beklemmung, Gefühlsturbulenzen oder gar Erkenntnis will sich nicht mehr wirklich einstellen, es bleibt beim erwartbaren Genuss von Sängerprominenz, einem pittoresken Geschichtchen und wohliger Italianità.
Kein Nachdenken nötig
Allerdings: Auf einer anderen Ebene können Klischees auch ganz ohne Ironie willkommen sein. - Zum Beispiel ist es längst ein Gemeinplatz, dass Nello Santi ein begnadeter Verdi-Dirigent ist. Doch zu beobachten, wie sehr seine Ausstrahlung, seine ruhige Gestik, seine Augen und seine körperliche Präsenz überhaupt einen ganzen Abend musikalisch in jeder Sekunde steuern, bleibt ein immer gern wiederholter Genuss. Bei Santi konzentrieren sich die emotionalen Energien dieses Abends, er steht für nichts weniger als für unanfechtbare Souveränität und für ein Musizieren, das mit seinem Sinn für Timing und Stil allfällige Einwände augenblicklich hinfällig macht. Da ist kein Nachdenken, Reflexion mehr nötig: So und nicht anders muss dieser Verdi klingen
Auch Leo Nucci weiss, wie Rigoletto zu singen ist, und dass er hier eine Paraderolle gefunden hat, ist, nach seinen über 400 Auftritten und 30 Jahren Rollenerfahrung, ebenfalls keine neue Erkenntnis. Proben hat er also kaum mehr nötig, seine Mimik, die bisweilen an alte Stummfilmzeiten erinnert, sitzt seit je und unveränderbar und liess sich auf Deflos grosszügige Personenführung gewiss leichter applizieren als auf die Vorstellungen eines ursprünglich als Regisseur vorgesehenen Werner Düggelin. An Nuccis Präsenz als buckliger Hofnarr hängt denn auch alles, was an atmosphärischer Verdichtung bisweilen doch aufkommt, in seinen besten Momenten streift seine Darbietung tatsächlich echte Tragik und Verzweiflung, während die Regie im Übrigen von Leitung und Personenführung weitgehend absieht.
Gesungen aber wird wieder einmal fabelhaft. Isabel Rey als Tochter Gilda liefert eine hinreissend ausgefeilte Arie «Caro nome ». Und wenn im düsteren Schlussakt doch noch Rührung aufkommt, so ist das ihrem zarten «Lassù nel ciel» zu verdanken (vorausgesetzt, man schliesst die Augen und muss den unsäglichen Jutesack nicht mitansehen, in dem die versehentlich Ermordete gemäss Regieanweisung über die Bühne geschleift worden ist). Facetten einer von Sehnsüchten zerrissenen Existenz werden von ihr freilich kaum verlangt. Auch von Piotr Beczala nicht, doch verkörpert der sonnige Sänger seine Rolle als Tenor und als verführeri-scher Duca derart freudestrahlend, dass sich davon einiges aufs Publikum überträgt: Ihm zuzuhören, ist schlicht ein Vergnügen! Melinda Parsons überzeugt als auf alt geschminkte Gouvernante Giovanna, Carmen Oprisanu als Lockvogel Maddalena, Pavel Daniluk als Monterone und László Polgár, der auch als Auftragskiller Sparafucile ganz Gentleman bleibt, verströmt einmal mehr schönste samtene Bassfülle.
Geschmähte, geliebte Kischees
Das fleissigste Opernhaus der Welt hat seinem Ruf nochmals Ehre gemacht, hat selbst das Saisonende noch mit einer Premiere gekrönt und seine Werkstätten noch einmal schuften lassen. Kulissen für einen herzoglichen Festsaal, für ein geblümt tapeziertes Zimmer bei Rigolettos zu Hause, für eine Terrasse, auf der Gilda ihren Starauftritt hat, und für eine industriell anmutende Szenerie am Ufer des Mincio hat William Orlandi als Ausstatter in Auftrag gegeben. Und neben den Solisten wollten auch der Statistenverein, das Ballett und der berückend nuanciert singende Chor eingekleidet sein. Für eine kurze Sommerpause kann das Material nun eingelagert werden, dann wird der Betrieb wieder aufgenommen - mit all seinen geschmähten, geliebten Klischees.
|
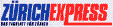
15. 7. 2002
«Rigoletto» als sicherer Wert
Gilbert Deflo inszeniert am Opernhaus Verdis «Rigoletto» - ein Wurf, bei dem fast nichts schief gehen kann
Verdis «Rigoletto» ist ein grossartiger Wurf, voll szenischer Effekte und populärer vokaler und instrumentaler Höhepunkte. «Da kann fast nichts schief gehen», hat sich Regisseur Gilbert Deflo gesagt und liefert eine schöne, in der Personengestaltung ziemlich spannungslose Produktion. Seine beste Idee: Das erste Bild mit Ball im herzoglichen Palast spielt in der fiktiven Originalzeit, im 16. Jahrhundert. Danach prägt die Entstehungszeit der Oper, das 19. Jahrhundert an der Schwelle zwischen Romantik und Industriezeitalter, die meist düstere Bühne. Das schafft durchaus die beklemmende Atmosphäre für die tragische Geschichte. Darin aber ereignen sich szenisch eher konventionelle Allgemeinplätze, manchmal etwas provinzielle Peinlichkeiten.
An der Premiere jedenfalls hielten sich tief empfundene Innigkeit und rollengestalterische Intensität in Grenzen. Selbst Bariton Leo Nucci, seit Sängergenerationen ein singulärer Rigoletto, begeisterte eher durch seine noch immer kraftvolle, präsente Stimme als durch berührende Differenziertheit. Isabel Rey war die vom Publikum gefeierte Gilda, Paraderolle aller Koloratursopranistinnen. Reys Höhensicherheit ist denn auch enorm, vor allem wenn sie sie mit unvergleichlich geführten Piani schmückt. Ihre Fortehöhen geraten dagegen oft etwas scharf. In Piotr Beczala hat das Opernhaus einen jugendlich strahlenden Herzog von Mantua. Er führt seinen klaren Tenor mit verführerisch schönem Timbre und scheinbarer Leichtigkeit in jede Höhe und spart nicht mit schmelzreichen Belcantoschluchzern. László Polgár, mit sonor artikuliertem Bass, und Carmen Oprisanu mit ebensolchem Mezzo, ergänzen das Ensemble verlässlich. Mit Maestro Nello Santi steht ein Verdi-Altmeister und -Routinier am Dirigentenpult. Am Premierenabend führte er das Opernorchester zu rhythmischer Perfektion in farblich plakativer Intonation. Diese letzte Opernpremiere der Spielzeit war vielleicht nicht das Ereignis, das im Werk schlummert. Aber eben: Verdis «Rigoletto» bleibt ein grossartiger Wurf, bei dem fast nichts schief gehen kann.
|

14. 7. 2002
Überflüssige Verlängerung
Das Opernhaus setzt zum Saisonende auf Sicherheit - und landet mit Giuseppe Verdis «Rigoletto» prompt einen künstlerischen Flop. Wo der Mut fehlt, ist die Unentschlossenheit nicht weit.
VON TOBIAS GEROSA
Wenig verständlich, warum nach der Absage von Werner Düggelin - aus «gesundheitlichen Gründen» - für die letzte Festspielpremiere ausgerechnet Gilbert Deflo die Regie übernahm. Dessen letzte Arbeiten sind vor allem durch Ideenlosigkeit aufgefallen. Lediglich Kostüm und uneinheitliches Bühnenbild zeugen nunmehr vom Konzept, die Oper im 19. Jahrhundert spielen zu lassen.
Die Regie hat vor allem überwunden geglaubte Tradition übernommen. Die allzu bekannten Operngesten feiern Urständ. Von Personenführung keine Spur. Dabei böte die Geschichte um den buckligen Hofnarren Rigoletto, dessen Tochter Gilda sich in den vergnügungssüchtigen Herzog verliebt, vielfältige soziale, politische oder psychologische Deutungsmöglichkeiten.
Zur szenischen Leerstelle gesellen sich gesangliche Probleme. Leo Nucci als Rigoletto verlässt sich in erschreckendem Ausmass auf seine langjährige Routine: Ohne inneres Engagement deklamiert und schluchzt er sich durch die Partie. Er weiss genau, wo wirksame Effekte zu heischen sind. Sein Schmerz über den Missbrauch seiner Tochter durch den Herzog wird aber in keinem Moment spürbar.
Im dramatischen zweiten Teil, wo Gilda (Isabel Rey) sich anstelle des Herzogs vom Meuchelmörder Sparafucile (überzeugend: Lászlò Polgár) ermorden lässt, sieht sich die Sopranistin zum Forcieren gezwungen. Resultate sind ein angestrengtes Forte und schrille Spitzentöne. Immerhin gestaltet sie ihre grosse Arie im ersten Akt fein als zurückgenommenen, lyrischen Monolog.
Überzeugend agiert lediglich Piotr Beczala als Duca. Mit viel Schmelz steigt sein lyrischer Tenor nicht nur mühelos bis in höchste Höhen, sondern bezaubert auch mit seinen Piani. Was ihm noch fehlt, ist der grosse Bogen über die vielen schönen Details. Dass er den Hit «La donna è mobile» wenig differenziert hinschmettert, liegt stark am Dirigat. Zweifellos fegt Nello Santi den Staub dutzender Repertoirevorstellungen aus der Partitur und legt viele Details frei. Die Raffinesse des ersten Aktes weicht gegen Schluss aber immer mehr einer zupackenden, zuweilen knallig-lauten Begleitung.
Insgesamt eine langweilige und letztlich überflüssige Saisonverlängerung. «Povero Rigoletto» - Mitleid ist durchaus angemessen.
|

15. 7. 2002
Sterben in unwirtlicher Landschaft
Das Quartett, das Gewitter, Tragik und Ironie von Gildas Tod: was die Opernbühne in der Totalwirkung an Unabsehbarem erfahrbar machen kann, zeigt der dritte «Rigoletto»-Akt in der Neuinszenierung des Opernhauses: Ein Saison-Finale, das viel sonst Gehörtes und Gesehenes wesenlos erscheinen lässt.
HERBERT BÜTTIKER
Der Premiere am Freitag folgte gestern Abend noch eine zweite Aufführung zum Abschluss der Saison am Opernhaus und zugleich der Zürcher Festspiele. Mit «Rigoletto» beginnt aber bereits Anfang September die neue Spielzeit. Dazu ist diese Produktion, die an der Premiere gefeiert wurde, als ob es keine Saisonmüdigkeit gäbe, die wärmste Empfehlung: viel Jubel, am meisten für Nello Santi, grossen für die Protagonisten Leo Nucci (Rigoletto), Isabel Rey (Gilda), Piotr Beczala (Duca), Carmen Oprisanu (Maddalena), Laszlo Polgar (Sparafucile) und etwas beiläufigeren für das Regieteam, das sich in dieser Saison schon mit «Thérèse»/«Cavalleria» hervorragend präsentierte.
Auch «Rigoletto» präsentieren Gilbert Deflo (Inszenierung), William Orlandi (Ausstattung) nun in einer sensiblen Ästhetik, die sich auf Gesang und Spiel der Protagonisten konzentriert, den Handlungsraum klärt und atmosphärisch verdichtet und das Werk interpretiert, ohne es zu verstellen. Traditionelles Opernhandwerk, könnte man sagen, aber im Zugriff durchaus eigenwillig. Klärung bedeutete offenbar auch für diese wie für die meisten neueren Verdi-Inszenierungen, den Bezug zur Entstehungszeit des Werks zu verstärken. Ort und Zeit der Handlung, die auf dem Weg von Victor Hugos Stück «Le rois s’amuse» zur Oper, wie sie nach den bekannten Zensurproblemen schliesslich zur Uraufführung kam, schon einmal neu definiert wurden, ist ins 19. Jahrhundert verlegt. Höfischen Glanz gibt es da nur noch als Ballinszenierung einer Oberschicht. Deren Mittelpunkt, der Duca, trägt sonst im Ausgang die Offiziersuniform, und nicht die aristokratische Elite, sondern der Klüngel unterwürfiger Parvenüs bildet seine Entourage. Dazu gehört ja auch Rigoletto, der nicht der Repräsentant einer Gegenwelt ist, sondern nur der bucklige Einzelgänger in dieser bürgerlichen Aristokratie, bucklig im doppelten Sinn: als einer der vom Schicksal geschlagen wurde und einer, der mehr als alle anderen spürt, wie sehr er sich in der Rolle des Narren zu Bücklingen herab lässt und sein besseres Selbst verleugnet. Wenn er die Höflinge als «vil razza dannata» verflucht, steht er unter seinesgleichen, und es gehört zum Eindrücklichen der Inszenierung, wie sie Rigoletto zugleich als Theaterfigur mit all den Insignien des Narrenkönigs respektiert und sie zugleich in die gesellschaftliche Wirklichkeit einer Epoche zu integrieren vermag, in der der Beruf des Hofnarren kaum mehr in dieser pittoresken Weise vorstellbar ist, wenn er auch unter der Bezeichnung Künstler weiter gepflegt wurde und wird.
Figuren aus Fleisch und Blut
Ohne den Rahmen, den der Stoff vorgibt, über Gebühr zu strapazieren und ohne Fingerzeig macht diese Inszenierung deutlich, wie viel diese Figur mit Verdis Epoche, mit ihm selbst zu tun hat, mit seiner musikalischen Sprache und Dramatik. Aber der hohe Grad an Authentizität, die sie erhält, ist vor allem auch dem Interpreten zu verdanken, und Leo Nucci ist nun wirklich ein Rigoletto aus Fleisch und Blut. Da kommt alles zusammen: eine immense Rollenerfahrung, die in einer bis in alle Fasern prägnanten Gestaltung spürbar wird, eine eruptive, scheinbar unerschöpfliche Energie, die die impulsive, unwiderstehliche Bühnenpräsenz dieser Figur ausmacht. Nucci ist ein Schauspieler durch und durch, ausdrucksstark in Haltung, Gebärde und Mimik, und mit den souveränen Mitteln einer gereiften Stimme rückt er alle Facetten der Partie in ein klares Licht: die liebevollen väterlichen Kantilenen in den Duetten mit Gilda, die zornige Stretta-Melodik im zweiten Akt, die Monologe zwischen dem grüblerischen «Pari siamo» im ersten und dem pathetischen «Ora mi guarda, o mondo» im dritten Akt – alles voller Emotion und Echtheit und wohl auch beispielhaft. Jedenfalls wohnt man einer Aufführung bei, in der alle über sich hinauszuwachsen scheinen. Piotr Beczala etwa steigert sich in eine Gesangslust, die alle tenoralen Klimmzüge (die chromatische Linie zum hohen b im Duett mit Gilda) mühelos erscheinen lässt und die Intervallsprünge des «La donna è mobile» zum Ausdruck puren Übermutes macht. Klar, dass sich dieser Herzog «Possente amor mi chiama» nicht entgehen lässt. Gewicht erhält mit Legato-Fülle in der Arie aber auch die Kehrseite der Figur. Verdeutlicht auch durch die Inszenierung, die ihn im zweiten Akt im tristen Gemäuer des ausgeräumten Festsaal über seine Lage brüten lässt, zeichnet er eine problematische Existenz, die in ihrer Widersprüchlichkeit berührt und auch Gildas Verhalten in ein hintergründigeres Licht taucht: eine junge Frau, die durchaus nicht ahnungslos ihr Schicksal auf sich nimmt, sondern es auch sucht. Dafür hat Isabel Rey die Ausstrahlung der ruhigen Kantilene und einer Koloratur ohne Kokettieren mit naiver Mädchenhaftigkeit.
Prekäre Lebenswelt
Solche Figuren von Charakter, gleich weit entfernt von Klischeehaftigkeit und Extravaganz zeigt die Aufführung dann auch in den weiteren Partien, beim windig-seriöser Sparafucile Laszlo Polgars zum Beispiel, bei Carmen Oprisanu nicht allzu willfähriger Schwester Maddalena oder Pavel Daniluks aufbrausendem Monterone. Im berühmten Quartett des dritten Akklingen dann vier Stimmen in ihrer je eigenen Physiognomie und Psychologie ineinander: vier wirkliche Menschen an einem Ort, der mehr mit Wirklichkeit zu tun hat als die übliche Schenken-Romantik, die hier oft die Staffage bildet: Im Hintergrund die Industriekamine, im Vordergrund Eisenbrücke, Fabrikgemäuer, unheimlich in der Gewitterstimmung, eine prekäre Lebenswelt. Der Kontrast zur kulissenhaften Festlichkeit des ersten Bildes könnte nicht grösser sein, und auch die mittleren beiden Bilder – Rigolettos kapellenartige, von einem Liliengarten umgebene Behausung wohl etwas aufdringlich in der Symbolik – kontrastieren stimmig. Die emotionale Architektur der Inszenierung verweist so auf die musiklische Architektur dieser ja so unglaublich konzentrierten Oper. Dieser dient, und das ist eine weitere Stärke dieses Verdi-Abends, mit alle Souveränität Nello Santi am Dirigentenpult. Da herrscht restloser Überblick, für die Detailkontrolle und für Formzusammenhänge im Grossen, wie sie etwa in knappen Tempomodifikationen hörbar werden. In dieser gestalterischen Freiheit folgt ihm das Orchester auch bei sehr schnellen Tempi mit aller geforderten Flexibilität. Da gibt es nicht nur keine Hektik, sondern im Gegenteil – und das macht die Reife dieses Dirigats aus – eine Ruhe in all dem, was die Partitur an konzertantem Aufblühen bietet. So gehört viel Orchestrales, die Celli der Sparafucile-Szene, das Oboensolo im Duett Gilda-Rigoletto im zweiten Akt etwa, zum Unvegesslichen eines dichten, begeisternden Abends.
|
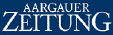
15.. 7. 2002
Preise «Gala», Kritik gallig
Zürcher Festspiele: Giuseppe Verdis «Rigoletto» am Opernhaus
CHRISTIAN BERZINS
Ob der Preis einer Opernkarte wirklich eine Auswirkung auf das Applausverhalten hat, wie am Freitagabend ein Theaterhabitué behauptete? Jedenfalls war das sonst durchaus kritische Zürcher Publikum anlässlich der Festspielpremiere und der Preiskategorie «Gala» (der Parkettplatz kostete 380 Franken) zufrieden und beklatschte die Interpreten heftig.
Die Zeit für eine echte Neuinterpretation von Giuseppe Verdis 1851 uraufgeführter Oper war reif. Am Freitag war aber schon vergessen, dass sich das Opernhaus das wirklich vorgenommen hatte, war doch zu Saisonbeginn Werner Düggelin für die Neuinszenierung von Verdis Hugo-Vertonung vorgesehen. Da es aber scheinbar bereits Anfang Jahr zwischen dem Sänger der Titelrolle, Leo Nucci, und dem Regisseur zu Differenzen gekommen war, wurde Düggelin durch Gilbert Deflo ersetzt. Deflo setzt die Oper in die Zeit ihrer Entstehung, was aber nur teilweise ersichtlich wird, denn die erste Szene zeigt sich wie eh und je im schmucken Ballsaal: prächtig die Farben, elegant die Kostüme, gewitzt die Ballettszene. Erst der Eintritt des Grafen Monterone macht klar, dass man auf einem Maskenball ist. Nur komisch, dass trotzdem Sitten wie im 16. Jahrhundert herrschen und die Verfluchung, wie sie Monterone ausspricht, alles Unheil der Welt über Rigoletto bringen wird. Später befinden wir uns in einer Grossstadt, erst im bürgerlichen, nett tapezierten Wohnzimmer der Familie Rigoletto, bald in der von aufkommender Industrie gezeichneten Vorstadt, wo der Auftragsmörder Sparafucile seiner Tätigkeit nachgeht (Bühnenbild William Orlandi). Durchaus kräftige Bilder, die aber kaum Entsprechung auf der Bühne finden, da Deflo den Sängern zu viel Freiraum gibt. Nello Santi nimmt solcherlei dankend an. Routiniert leitet er das viel gespielte Repertoire-Stück. Ähnlich wie in der «Carmen» vor drei Wochen unter Michel Plasson erfreut das Orchester mit einer grossen Farbpalette, doch sind die Musiker - zum Saisonschluss verständlich? - wie in der «Carmen» vor Ungenauigkeiten nicht gefeit. Aber der dramatische Atem, den Santi vom Orchester fordert und erhält, ist eindrücklich. Santi mag die Sänger noch so tragen, ihnen folgen, ihre Mätzchen auszugleichen: die drei Hauptrollen lassen für eine Festspielgala zu wünschen übrig (wenigstens singen Carmen Oprisanu als Maddalena und Laszlo Polgar als Sparafucile ihre kleinen Rollen prächtig). Piotr Beczala hat sich in den letzten Jahren in leichteren Tenorrollen beachtlich geschlagen, was ausreichte, dass er von Santi höchstes Lob einheimste: Doch ist die Rolle des Duca di Mantua für diesen Tenorino nicht zwei Nummern zu gross? Junge lyrische Tenöre können den Duca, eine typische Spinto-Partie, durchaus bewältigen, sind dann oft wunderbar verschwenderisch mit ihrem Material, strotzen vor Stimmschönheit, singen Piani wie die Engel und ducken sich etwas in den wenigen Forti. Nicht so Piotr Beczala: Sein Material reicht für eine angenehme Linie in der Mittellage aus, wenn er auch kaum fähig ist, sie im Piano zu gestalten (3. Akt «Bella figlia dell´amore»); ein überakzentuiertes Mezzoforte muss hier aushelfen. Die Kunst des Legatos ist bei Beczala wenig ausgeprägt. Sobald dieser Tenor im Forte über die Mittellage hinausgeht, verengt sich die Stimme, das - bescheiden schöne - Timbre verliert sich dabei, und der hohe Ton kann nicht mehr ausgestaltet werden; manchmal hält er ihn, manchmal nicht.
Isabel Rey singt die Gilda in Zürich seit zehn Jahren; 1992 war sie in dieser Rolle umjubelte Nachfolgerin Edita Gruberovas. Von einer Stimme von «vollkommener Reinheit, mädchenhaft zart im Timbre, doch niemals dünn, beseelt auch in den Koloraturen, leicht und entspannt im Ansatz, klar in der Linienführung» sprach die «NZZ» damals. Was ist geblieben von Pereiras «Entdeckung»? Die ersten zwei Attribute treffen auch heute noch zu, allerdings hat sich die Stimme nicht weiterentwickelt. Im Gegenteil: Sie ist zwar nach wie vor mädchenhaft zart im Timbre, allerdings in der Mittellage sehr dünn geworden, und erst bei extremen, vernachlässigbaren Spitzentönen gewinnt sie Halt. Leicht und entspannt ist dieser Sopran längst nicht mehr. Gerade diese positiven Eigenschaften führten früher zu einer beachtlichen Modulationsfähigkeit: heute klingen die meisten Passagen gleichtönig. Rey hält selbst nach der berüchtigten menschlichen und stimmlichen Verwandlung der Gilda im Finale des 2. Akt («O mio padre, qual gioia feroce») ihre Mädchenstimme bei. Nichts ist vorhanden, dass dem Fortissimo ihres Vaters, Rigoletto, entgegengehalten werden könnte.
Über 400-mal hat Leo Nucci den Rigoletto gesungen: man merkt es in jedem Ton. Wie er die ersten Parlando-Stellen - Passagen, in denen vor allem mit Diktion Wirkung erzielt wird - meistert, ist grandios. Äusserst eindrücklich ist auch die völlige Durchdringung der Partitur bis auf die letzte Note und Geste. Doch wenn Nucci mit lyrischen Gesangsmitteln Ausdruck erzielen sollte, versagt ihm die Stimme mittlerweile den Dienst: Das Piano klingt meist nasal, noch dazu wird sein Bariton dabei spröde oder kommt in die Nähe des Brechens. So vermeidet er es denn meist voraussichtig und singt Pianostellen wacker im (Mezzo-)Forte aus: So etwa die grosse Szene des 2. Aktes «Ah voi tutti» bis «tutto al mondo è tal figlia per me». Das verlangte Forte zu Beginn der Szene («Cortigiani») ist extrem kraftvoll, doch das ist Kraft ohne Gestaltung. Sicher kann solcherart Singen mal des Effektes Willen angewendet werden, so etwa im Schlussausruf «Maledizione», doch ist dieser Ausruf für Nucci bereits wieder zu hoch, als dass er ihn im Forte aussingen könnte. Immerhin: Die Personalität triumphiert in Nuccis Interpretation, und das ist in einer Zeit der sängerischen Angleichungen allemal zu bewundern - aber zu bejubeln?
|

15. 7. 2002
Lustvoll zelebriertes Sängerfest
Regisseur Gilbert Deflo zeigt im Opernhaus Zürich Verdis «Rigoletto» in traditionellem Gewand. Leo Nucci in der Titelrolle trägt den Abend.
Im roten Narrengewand samt Glöckchenkappe und aufgeschnalltem Buckel betritt Rigoletto die Szene. Das Fest am Hof von Mantua verläuft gesittet, der Herzog erzählt von einem unbekannten Mädchen, dem er jeden Sonntag in der Kirche nachstellt. Rigoletto verspottet den Grafen Monterone, dessen Tochter der Herzog geschändet hat. Beide trifft der Fluch des Vaters. Das Verhängnis nimmt seinen tödlichen Lauf. Regisseur Gilbert Deflo und sein Ausstatter William Orlandi versetzen das Werk in die Epoche Viktor Hugos, dessen Drama «Le roi s'amuse» (1832) die Vorlage zum Libretto von Francesco Maria Piave (1851) bildete. Giuseppe Verdi reizten an dem Stück die Menschen und ihre Gefühle, besonders aber die Vater-Tochter-Beziehung. Was im ersten Bild sehr konventionell beginnt, wandelt sich bereits mit der zweiten Szene zu einer wohltuenden Verknappung, weg vom Plüsch-Image. Rigolettos Haus ist von weissen Lilien umgeben, die die Reinheit der Tochter symbolisieren. Der zweite Akt im Vorzimmer des Duca wirkt grosszügig, die verlassene Gegend am Ufer des Mincio mit der Schenke recht stimmig (mit einer Gewitterszene samt prasselndem Regen).
Anrührender Vater
Deflos Personenführung lässt den Protagonisten viel Raum für die Charakterisierung der Rollen. Der Herzog ist ganz strahlender, dunkel-gelockter Verführer, Rigoletto hinter der Fassade des Possenreissers ein zutiefst anrührender Vater; seine Gilda (Isabel Rey) indes wirkt zu emanzipiert und rührt in ihrem Spiel nicht wirklich ans Herz. Sie verkörpert nicht die reine, behütete Tochter, die in der Musik so wunderbar vorgegeben ist. Schade. Dabei ist die Sängerkonstellation viel versprechend: Die Titelrolle übernahm der Bariton-Veteran Leo Nucci, der die Partie des Rigoletto schon über 400-mal gesungen hat. Dennoch erstarrt der Italiener nicht in Routine. Dass er mit einem veritablen Buckel ausgestattet wurde, irritiert einerseits, verleiht andererseits der Figur aber die nötige tragische Dimension. Und der kleine Bucklige läuft zu ganz grosser Form auf. Wie Nucci mit den Worten spielt, da eine Betonung setzt, dort auch verknappt (keine gequälten Rufe nach Gilda bei der Entführungsszene), das hat Stil und edle Grösse. Stimmlich muss der vitale 60-Jährige dem Alter keinen Tribut zollen: Leo Nucci singt mit langem Atem wunderschön auf Linie, verfügt über eine noch immer sichere Höhe und reiche Farben in seiner Baritonstimme. Nucci wurde zu Recht mit stürmischem Beifall gefeiert, schon nach der grossen Szene «Cortigiani, vil razza dannato» und dem ergreifend interpretierten «Miei signori, perdono, pietate!». Rollenerprobt auch die Gilda: Die Spanierin Isabel Rey hat die Partie seit fünfzehn Jahren im Gepäck. Sie singt mit zuverlässiger Sopranstimme, verfügt über perlende Koloraturen und lässt im «Caro nome» einen lang gehaltenen Triller vernehmen, dennoch wirkt ihre Rollengestaltung seltsam steril. So vermochte weder das erste Duett mit Rigoletto noch jenes mit dem Herzog richtig zu überzeugen. Der junge Pole Piotr Beczala setzt ganz auf seine strahlende Tenorstimme, die in allen Lagen gut anspricht, wenn auch zu oft mit Druck geführt. So schlich sich in den Tenor-Schlager «La donna è mobile» prompt eine Unsauberkeit ein. Carmen Oprisanu (langjähriges Ensemblemitglied am Luzerner Theater) ergänzte im berühmten Quartett im dritten Akt («Bella figlia dell' amore») die drei Solisten aufs Vorzüglichste mit ihrem wohlklingenden, runden Mezzosopran. Zuverlässig Laszlo Polgár als Sparafucile und Pavel Daniluk als Monterone.
Drive und Musikalität
Musikalischer Sachwalter dieses «Rigoletto» ist Altmeister Nello Santi - wie immer auswendig dirigierend. Mit dem Orchester der Oper Zürich setzte Santi zu einem wahren Höhenflug an. Selten hat man die als «Hum-Tata-Musik» gescholtene Partitur in so vielen Farben und Facetten wahrgenommen: Das Blech akzentuiert und präzise, die Streicher warm und einschmeichelnd - der nötige Drive und die Zurücknahme des Orchesters im richtigen Moment ideal ausbalanciert (nachhaltig etwa das subtile Anziehen beim Duett «Sì vendetta»). Ein lustvoll zelebriertes Sängerfest. In den Jubel um Santi und die Protagonisten wurde auch das Produktionsteam einhellig einbezogen. Mit diesem «Rigoletto» (als zweite Premiere im Rahmen der Zürcher Festspiele) hat das Opernhaus - nach einer nachtschwarzen «Carmen» - nunmehr einen kassenträchtigen Repertoirewert auf sicher.
Von Stefan Degen
|


