Aufführung
|

4. 7. 2004
(Première)
*
Musikalische Leitung: Franz Welser-Möst
Inszenierung: Sven-Eric Bechtolf
Bühnenbild: Rolf Glittenberg
Kostüme: Marianne Glittenberg
Lichtgestaltung: Jürgen Hoffmann
Chor: Jürg Hämmerli
*
Feldmarschallin: Nina Stemme
Octavian: Vesselina Kasarova
Sophie: Malin Hartelius
Leitmetzerin: Liuba Chuchrova
Annina: Brigitte Pinter
Baron Ochs auf Lerchenau: Alfred Muff
Herr von Faninal: Rolf Haunstein
Valzacchi: Rudolf Schasching
Ein Polizeikommissar: Günther Groissböck
Haushofmeister der Marschallin: Peter Keller
Haushofmeister des Faninal: Andreas Winkler
Ein Notar: Guido Götzen
Ein Wirt: Volker Vogel
Ein Sänger: Boiko Zvetanov
SYNOPSIS - LIBRETTO - HIGHLIGHTS
|
Rezensionen
|
|
|
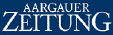
6. 7. 2004
Auf silbernen Rosen gebraten
Zürcher Festspiele Richard Strauss´ «Rosenkavalier» am Opernhaus Zürich
Eine gute Besetzung, ein Dirigent, der die feinen Fäden betont, eine Regie, die deutet und der Musik folgt - und mit einem genialen Detail aufwartet.
Christian Berzins
Wie wenig es manchmal doch braucht, um eine festgefahrene Aufführungspraxis aufzusprengen! Von Regisseur Sven-Eric Bechtolf, der in Zürich «Carmen» auf der Müllhalde und «Otello» im Raumschiff spielen liess, durfte ein Neuansatz von Richard Strauss´ «Rosenkavalier» erwartet werden. Er belässt nun aber fast alles so, wies im Buch von Textdichter Hugo von Hofmannsthal steht, und schafft doch eigenständige Bilder und Charaktere. Bechtolf zeigt, welche Abgründe sich in dieser Komödie auftun und wie nah ein auswegloses Ende ist: Die Feldmarschallin und ihr junger Liebhaber Octavian leiden enorm unter ihrer Trennung; der Baron Ochs kann nicht glauben, dass seine Hochzeit mit der reichen Sophie von ebendiesem Octavian vereitelt wurde.
Ein Häuflein Elend
Im letzten Bild scheinen die vier Protagonisten am lustigen Spiel zerbrochen zu sein: Die Feldmarschallin stürzt sich auf den vermeintlich Schuldigen, den Baron Ochs. Der oft so tölpelhafte, ist als eleganter Baron gezeichnet, der geradezu cool sein kann. Vom 17-jährigen Octavian wurde er dennoch an der Nase rumgeführt. Dar-an freuen kann sich der schnöselhafte Rosenkavalier nicht. Die Präsenz der Feldmarschallin lässt ihn Sophie wieder vergessen - einem Häuflein Elend ist er gleich. Kein Wunder, steht Sophie plötzlich ganz nah beim ihrem verschmähten Bräutigam, dem Baron Ochs, bis sie Octavian doch noch resolut an der Hand ins neue Leben zieht. Stark ist diese Sophie gezeichnet: Im 2. Aufzug, kurz vor der Rosenübergabe, hat sie noch tüchtig in der Küche mitgeholfen: Zum Duft der Silbernen Rose gesellt sich der Duft von Bratensauce. Warum eine Küche anstelle eines «normalen» Entrees gebaut wurde, bleibt offen (Bühne Rolf Glittenberg).
Im 1. Aufzug sind wir in einem schnörkellosen, eisigen Zimmer. Eine Matratze liegt auf dem Boden, anstelle eleganter Säulen stehen knorrige Bäume. Aber bald sehen wir wie eh und je die Feldmarschallin im Nachthemd und Octavian in langen Unterhosen beim Morgenkuscheln. Im 3. Aufzug kehrt man zurück in diesen Raum. Rasch ist ein Zelt, ein Chambre Separée, aufgebaut. Skelette werden Baron Ochs erschrecken: Nahe kommt hier das Geschehen ans letzte Nachtessen Don Giovannis oder Hofmannsthals «Jedermann». Der Tod lauert nicht nur hier. Auch die Feldmarschallin schaut am Leben hinab, wird dreimal am Boden liegen, der Friseur macht aus ihr für einmal tatsächlich ein altes Weib. Ochs wird nach seine Verletzung von Faninal wie ein Toter aufgebahrt: Schwarzer Humor und der rote Faden werden eins.
Olympio - der Musikautomat
Wenn alle Details dieser Inszenierung vergessen sind, wird man sich einer Szene erinnern: Aus dem immer etwas dämlich wirkenden Tenor im 2. Aufzug macht Bechtolf einen Musikautomaten, einen Olympio - das ist unheimlich raffiniert.
Genauso gespannt wie auf die Inszenierung war man auf die musikalische Umsetzung, debütierte doch Vesselina Kasarova als Octavian - Höhepunkt im Werdegang einer Mezzosopranistin. Ihre stimmlichen Gestaltungs- und Ausdrucksmittel sind unbegrenzt, kein Detail ist zu schwierig. Nur halten die Gesangslinien nicht, die Phrasen sind zerrissen: kaum ein Wort ist verständlich. Kasarovas Noblesse kann eben auch eine Grenze sein. Bei Nina Stemme (Feldmarschallin) sitzt jeder Ton, und jede Geste, die Reserven scheinen unendlich. Malin Hartelius Sopran ist glockenhell - perfekt für die Sophie, die «pudeljunge Jungfer». Alfred Muff (Baron Ochs) spielt nicht den Polterbass, sondern vielmehr einen Galan: Helligkeit und Beweglichkeit der Stimme passen perfekt dazu.
Dirigent Franz Welser-Möst führt mit dem Opernhausorchesters den vom Regisseur gezeigten Abgesang weiter: Er zeichnet phasenweise so fein, so melancholisch, voller seelischem Ausdruck, dass man sehr genau hinhören muss. Er lässt nie poltern, dafür öfters mal genüsslich fett die Klänge tropfen: So entsteht in Faninals Küche ein Braten, der nach Rosen riecht.
|

6. 7. 2004
Die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen
Zürcher Festspiel-Premiere: «Der Rosenkavalier» von Richard Strauss im Opernhaus
Ein sonderbares Grüppchen, das am Zürifäscht-Sonntagabend ins Opernhaus ging: Dunkel und festlich gekleidet kämpfte es sich zwischen Raclette-Wogen und Caipirinha-Wellen durch. In all der festfreudigen Gegenwart sah es ausgesprochen unzeitgemäss aus - ähnlich unzeitgemäss, wie Richard Strauss’ in ein Märchen-Rokoko projizierte Wiener Gesellschaft im «Rosenkavalier».
Seit Theodor W. Adorno in der «Philosophie der neuen Musik» darüber herzog, gilt das Werk als Inbegriff für musikalische Saccharinsüsse. Es gibt einen Riss zwischen Strauss’ bühnenwirksamer Musik und Hugo von Hofmannsthals fein austariertem Komödientext. Es war deshalb eine kluge Wahl, dass Regisseur Sven-Eric Bechtolf in Zürich ganz auf Hofmannsthals Wort abstellte. Und da erweist sich das «Gleichzeitige im Ungleichzeitigen» (Hofmannsthal) als zentrales Thema. Die Feldmarschallin spricht es aus: «Wie kann das wirklich sein, dass ich die kleine Resi war und auch einmal die alte Frau sein werd... Wo ich doch immer die gleiche bin. ... Und man ist dazu da, dass man’s ertragt. Und in dem «Wie» - da liegt der ganze Unterschied.»
Sie liebt den jungen Octavian, und das nicht nur mütterlich. In einem ganz in Weisstönen gehaltenen Liebesnest erwachen die beiden im ersten Bild, da liegt die Vergangenheit ihrer Liebe schon in der Luft. Am Ende wird Octavian mit Sophie zusammen sein, der er im Auftrag eines Cousins der Marschallin, des Provinz-Don-Juans Ochs auf Lerchenau, eigentlich nur eine silberne Rose zur Verlobung überreichen sollte.
So knapp lässt sich die Handlung zusammenfassen - in dem «Wie» liegt die Oper. Octavian und die Marschallin sind als Figuren dem Fin de siècle näher, dem das Werk entstammt, als dem Rokoko, in dem es spielt. Die silberne Rose trägt dem Kavalier aber ein aschfahler Rokoko-Lakai nach: Immer wieder überblenden sich in der Zürcher Aufführung die Zeitebenen. Manchmal bleibt die Zeit auch ganz stehen: Wenn sich Sophie und Octavian zum ersten Mal begegnen zum Beispiel. Auch ist die Welt ganz künstlich, in der diese Marschallin lebt. Dekadent, aus dem Lauf der Zeit ausgeklinkt mit ihrem exotischen Pomp, der toten Natur, die in ihre hyperästhetische Kultur eindringt, dürren Bäumen, Porzellan-Papageien, dem Federvieh in Faninals Bilderbuchküche (Ausstattung: Rolf und Marianne Glittenberg).
Die schwedische Sopranistin Nina Stemme ist eine überragende Marschallin, weniger die hoheitsvolle Fürstin als die liebenswerte Frau. Berückend in der Tongebung, beseelt im Ausdruck - das «stimmt» nicht nur stimmlich, sie denkt, was sie singt. Überhaupt hat Regisseur Bechtolf mit den Sängern eine unaufgesetzte Natürlichkeit der Darstellung erreicht, die im Opernbetrieb selten ist und der starren Kunstwelt ein lebendiges Gegengewicht gibt. Bechtolf konzentriert sich auf Hofmannsthals Figuren und ihre komplexe Psychologie und findet unaufgeregte szenische Mittel, diese sichtbar zu machen. Mehr tut er nicht - doch das ist viel.
Wenn der Aufsteiger Faninal (Rolf Haunstein) dem Baron erst unterwürfig die Füsse küsst und ihn dann abklopft wie eine gestopfte Gans, sagt das schon einiges über seine Charaktermischung aus Schmeichelei und klarer ökonomischer Berechnung. Alfred Muff spielt den Baron als köstlichen, allerdings auch etwas humorlosen Biedermann; stimmlich imponierend und - wie Nina Stemme - bis ins letzte textverständlich. Vesselina Kasarova gibt ihren ersten Octavian ungestüm drängend, mit wunderbar herbem Timbre, aber nicht immer einheitlich in der Gesangslinie. Malin Hartelius ist eine Sophie von zarter Sopran-Leuchtkraft. Auch orchestral ist die Aufführung unter Franz Welser-Möst herausragend. Kein süsslicher Melodienbrei, sondern abwechslungsreiche, transparent gespielte Musik, in der die immer wiederkehrenden Motive in immer neuen Farben gezeichnet sind.
Andreas Klaeui
|

6. 7. 2004
Der Küchenkavalier
von Roger Cahn
Musikalisch Spitze, szenisch fragwürdig. Der Wiener Opernklassiker «Der Rosenkavalier» von Richard Strauss lässt am Zürcher Opernhaus viele Wünsche offen. Premiere war am Sonntag.
Der Dichter Hugo von Hofmannsthal und der Komponist Richard Strauss haben 1910 in enger Zusammenarbeit die wohl geistreichste Komödie des europäischen Musiktheaters geschrieben.
Je zwei Menschen, die das Leben zusammengeführt hat - die reife Marschallin und der siebzehnjährige Octavian einerseits, der ungehobelte, arme Baron Ochs auf Lerchenau und das feinfühlige Bürgersmädchen Sophie anderseits -, werden getrennt. Dafür verbinden sich zwei, die ganz natürlich zusammengehören: Sophie und Octavian. Das ist köstlich, charmant und lebt von wienerischem Witz und Charme.
Das Regieteam unter der Leitung von Sven-Eric Bechtolf geht den Klassiker mit deutscher Lustigkeit an und scheitert. Sie machen die feine Komödie zur groben Farce. Nur am Anfang und am Ende vertraut die Inszenierung der Vorlage und schafft Momente, die einen Hauch von Poesie verströmen.
Dass der lange Opernabend (vier Stunden) nicht so richtig zünden will, liegt auch an der Besetzung der Titelrolle: Die Rossini- und Mozart-Spezialistin Vesselina Kasarova wagt sich hier an ihren ersten Strauss. Man spürt, wie ihre Stimme mit den Tücken der Partitur kämpft und sich ihr schauspielerisches Talent nicht voll entfalten kann. Das Erotische dieser Hosenrolle - verführerisch sowohl in Frauen- wie in Männerkleidung - gelingt ihr weder stimmlich noch darstellerisch. Und wenn Octavian in der Schlüsselszene seine wahre Liebe in einer unromantischen Küche erkennen muss, dann wirkt er eher wie ein Küchenkavalier als ein Rosenkavalier.
Musikalisch ist die Produktion Spitzenklasse. Dank Dirigent Franz Welser-Möst. Wie er das Orchester auch am Ende einer anstrengenden Saison zu einer beeindruckenden Interpretation mit viel Engagement für emotionale Details motiviert und zügelt, ist beeindruckend. Und noch eine Spitzenleistung gilt es zu bewundern: Nina Stemme beherrscht all die komplizierten Gefühlswelten der Marschallin - sängerisch brillant, darstellerisch überzeugend.
|

6. 7. 2004
Etwas genauer genügt nicht
Richard Strauss’ Oper «Der Rosenkavalier» als Festspielpremiere am Opernhaus Zürich
Eine ansprechende, aber wenig aufregende Neuinszenierung zum Saisonabschluss. Franz Welser-Möst dirigiert mit viel Schwung und Klangsinn, aber weniger durchsichtig als bei seinem «Ring». Den Abend bestimmen zwei aussergewöhnliche Sängerinnenpersönlichkeiten: Nina Stemme als Marschallin und Vesselina Kasarova als Octavian.
Bei Sven-Eric Bechtolfs letzten Zürcher Inszenierungen gingen seine psychologisch scharfsichtigen Analysen dem konservativen Teil des Publikums zu weit. Jetzt mit dem «Rosenkavalier» erntet er Protest aus anderer Richtung. Denn es dauert bis in den dritten Aufzug, bis sich die schlüssige Personenführung gegen eine enttäuschend traditionelle Lesart durchsetzt. «Vielleicht etwas genauer» wolle er die Geschichte erzählen, wird Bechtolf im Programm zitiert – genügt das?
Mit der buffonesken Handlung um Ochs und die diversen Nebenfiguren kann Bechtolf offensichtlich wenig anfangen. So entspricht Alfred Muffs Rollenporträt (stimmlich ansprechend, peinlich wirkt allerdings sein Pseudo-Österreichisch) dem Gewohnten.
Bechtolfs Interesse gilt einseitig der Marschallin und Octavian, der Entwicklung ihrer Beziehung. Auch Rolf Glittenbergs hochästhetisches Bühnenbild mit seinem kühl-eleganten Schlosszimmer, durch dessen grosse Fenster die Aussenwelt winterlich leuchtet, fokussiert auf diesen Aspekt. Die farbige Pracht der Vögel ist ausgestopft und kahl. Tot sind auch die Bäume, die als einziges Element der Irritation mitten im Schlafzimmer der Marschallin stehen.
Hier hat die Inszenierung am Anfang und am Schluss denn auch ihre intensiven, genauen Momente. Bei Nina Stemme ist die Marschallin keineswegs ein verwelkte ältere Dame, sondern eine junge Frau. Mit ihrem wunderbar warmen, weich flutenden Sopran und ihrer darstellerischen Präsenz ist die Schwedin eine Idealbesetzung, die zu Recht bejubelt wurde.
Mehr Widerhaken erwünscht
Ihr zur Seite Vesselina Kasarova in einem lang erwarteten Rollendebüt als Octavian. Sie macht ihn zum glühenden Nachfolger von Mozarts Cherubino. Noch sichtbar nervös, in den komischen Szenen zu wenig geführt und mit ein paar zu laut geschmetterten Tönen, aber mit breiter Farbpalette und bewegender Zartheit gibt sie ein berührendes Debüt mit weiterem Entwicklungspotenzial. Malin Hartelius als Sophie ergänzt das hochkarätige Frauentrio fein.
Manchmal drehte das Orchester allerdings gerade im Schlussterzett so stark auf, dass die Stimmen untergingen. Die Walzer haben Schmäh, und das Orchester klingt oft durchsichtig und fein. Weniger als in seinem «Ring» gelang es dem zurückgekehrten ehemaligen Chefdirigenten Franz Welser-Möst aber im «Rosenkavalier», die Partitur in neuem Licht erscheinen zu lassen. Auch musikalisch hätte man sich etwas mehr Widerhaken gewünscht, damit das Zuckerwerk «Der Rosenkavalier» nicht ganz so süss durch die Gehörgänge zieht. (tg)
|

6. 7. 2004
Silberrose und Wiener Schnitzel
Am Ende ist manch Irritierendes im neuen «Rosenkavalier» vergessen. Die Premiere mündet in den Festspieljubel, den das glänzende Ensemble des Opernhauses mit seinen Spitzenlichtern ausgelöst hat.
Herbert Büttiker
Warum Octavians Degen im Schlafzimmer der Feldmarschallin ein Feuerhaken sein muss, ist auch im Rückblick auf den viereinhalbstündigen Abend nicht zu beantworten. Aber dieser und einige andere Widerhaken der Inszenierung verstellen den Blick nicht auf die grossartige Leistung des Opernhauses am Ende der langen Saison. Die «Rosenkavalier»- Musik lebt ja nicht nur von den lyrischen Zaubermomenten, die gleichsam aus sich selber leuchten, sondern auch von einem wuchernden Musikbetrieb, der nur dank Grosseinsatz und geschliffener Arbeit zu funkeln beginnt. Orchester und Sänger sind gefordert mit dem dramatischen Gepolter des zweiten und dritten Aktes, mit seinen rhythmischen Überraschungen, mit seiner aufgeregten Konversation. Franz Welser-Möst ist dabei genau so souverän präsent, wie er selbstverständlich zum duftig-leichten Walzerton zurückfindet, und das Orchester geht im leicht zur Hand, bleibt durchsichtig für dekoratives Nebenbei und lässt sich kompakt zu auffahrendem Schwung animieren. Die Tempi sind zügig und straff im Ganzen, um so auffälliger macht sich Dreivierteltakt-Gemütlichkeit Platz und wölben sich die kleinen und grossen lyrischen Fermaten der Komödien-Partitur – Rosenüberreichung im zweiten Akt, das Schlussterzett: Magie des Taktstocks, aber auch der klangschön verschmelzenden Frauenstimmen.
Vielschichtige Frauenfiguren
Drei ganz unterschiedliche Figuren verschlingen sich am Ende und feiern das Laben im Abschied und in der Hoffnung, nachdem der einzige, der es in der deftig-platten Gegenwart verkörpert, der Ochs von Lerchenau, aus dem Spiel ausgeschieden ist. In der einzigen Hauptpartie in der Bastion der Männerstimmen beherrscht Alfred Muff in dieser Rolle die Szene über weite Strecken, in der Eloquenz und stimmlichen Penetranz imponierend. Aber in ihrer vielschichtigeren seelischen und musikalischen Anlage behaupten sich zuletzt die Frauenstimmen: der Mezzosopran, flankiert von zwei Sopranstimmen von unterschiedlichem Gewicht. Malin Hartelius macht mit ihrem schlanken und biegsamen Sopran Sophie zur mädchenhaft strahlenden Figur, lässt im dritten Akt aber auch die wachsende Eigenständigkeit ahnen, zu der sie im Widerstand gegen die väterlichen Pläne reift. Vesselina Kasarova bringt wohldosiert die dunklen Facetten ihres Mezzosoprans ins Spiel und gibt so ihrem Octavian die männlichen Züge. Für die Mariandel- Maskerade übertreibt sie mit komödiantischem Schalk ihre femininen Register, und für das Aufflammen und Aufbrausen des schnell gekränkten jungen Liebhabers trumpft sie mit ihrer expansiven Stimme auf, verschwenderisch, zum Nachteil für Phrasierung und Verständlichkeit wohl auch etwas einseitig auf die hohen und langen Töne fixiert.
Differenzierte Schattierung der Deklamation, Klangfülle und Klangfarben: Die ganze Souveränität sängerischer Gestaltung ist bei Nina Stemmes Marschallin versammelt – und nie in den Vordergrund gespielt, sondern zur Charakterisierung einer Frau eingesetzt, deren Souveränität eben gerade gefährdet ist. Sie spielt diese Marschallin ohne theatralische Vorgabe mit einer Grandezza, die nicht gespielt wirkt und sich auch in der offenbaren Verzweiflung nicht verliert. Und diese ist in ihrer Darstellung allgegenwärtig, nicht nur im berühmten Monolog, in dem sie melancholisch über die Zeit räsoniert. Immer ist unterschwellig da, was plötzlich «spektakulär» hervortritt in Entgleisungen und Zusammenbrüchen: wenn sie die Schokolade, die sie Octavian einschenkt, wie absichtlich auf den Tisch schüttet oder wenn sie vor dem Automaten, als der hier der Sänger (Boiko Zvetanov) vorgeführt wird, ohnmächtig wird. Da ist auch die Handschrift des Regisseurs zu spüren. Sven-Eric Bechtolfs Inszenierung geht sparsam um mit solchen Zeichen, und manchmal sind sie doch zu viel. Ein suggestives Bild prägt er auch für den Ochs von Lerchenau. Mariandel und die Marschallin auf seinen Knien und bekränzt, kann er sich für einen Augenblick wirklich «wie Jupiter selig in tausend Gestalten» wähnen, wobei die beiden, die mit ihren Händen hinter seinem Rücken turteln, eben auch deutlich machen, wie viel Selbsttäuschung bei ihm mit im Spiel ist. Aber für einen Augenblick wird er zur mythischen Figur. Der dritte Akt knüpft hier an. Aber so seltsam sich sonst die realistisch inszenierte Klamaukszene ausnimmt, so ganz überzeugt auch die poetische Umsetzung mit Skelett- und Totenkopf-Choreografie nicht. Und wenn die Kellner als Käfer (grasgrün Volker Vogels Wirt) kostümiert sind, geht die Extravaganz der Szenerie schon sehr weit.
Die Zeremonie in der Küche
Überhaupt. So nah sich die ausnehmend schönen Kostüme der Protagonisten (Marianne Glittenberg) an der Aufführungstradition des «Rosenkavaliers» orientieren, so weit entfernt sich davon das Raumkonzept. Stimmungsdicht und in Widersprüche zum Text noch nicht allzu sehr verstrickt, mag der Wintergarten als Schlafzimmer der Feldmarschallin im ersten Akt hingehen. Aber wenn Octavian das Beisel für das ochsische Tête-à-tête im dritten Akt an diesem Ort karnevalesk inszenieren lässt, sind Auftritte und Abgänge nur noch schwer plausibel zu machen.
Am meisten zugemutet wird dem Werk aber mit dem Mittelakt, der in die Grossküche des Faninalschen Palais verlegt ist. Rolf Glitterberg hat auch dieses Bild optisch bestechend gebaut, aber wozu? Faninal (Rolf Haunstein) erscheint hier wenig plausibel als Küchenchef von kleinbürgerlich-familiärem Zuschnitt, der die Tochter des Hauses in Erwartung des hochadeligen Bräutigams Wiener Schnitzel panieren lässt. Aber die silberne Rose könnte auch zwischen dem Konservenbüchsen abfüllenden Personal ihr Wunder vollbringen – die Musik lässt hier jeden Ort vergessen. Nur wenn sich Sophie vor dem ankommenden Rosenkavalier versteckt, fehlt seinem Auftritt natürlich das Entscheidende: das Gegenüber.
Da läuft die Musik ins Leere. An vielem, was oben erwähnt worden ist und was noch zu erwähnen wäre, kann sie sich aber auch entschieden festmachen. Chor, Statisterie und vor allem zahlreiches Nebenpersonal dienen mit gezieltem und gekonntem Einsatz dieser «Komödie für Musik». Bei aller Extravaganz liest sie sich insgesamt auch nicht neu. Nur kennen wir jetzt auch den scheppernden Ton, den die silberne Rose erzeugt, wenn sie zu Boden fällt.
|

6. 7. 2004
Muff brilliert als Ochs
Schnörkellos ist der «Rosenkavalier» am Zürcher Opernhaus inszeniert. Opulente Kost hingegen bieten Sänger und Orchester.
VON FRITZ SCHAUB
Amouröse Rokoko-Intrigen aus der Sicht der letzten Jahrhundertwende versprach die letzte Saison-Premiere am Samstag im Zürcher Opernhaus. Denn der «Rosenkavalier» von Richard Strauss (Musik) erzählt nicht nur die hoch emotionale Geschichte der altersweisen Feldmarschallin, die zu Gunsten der jungen Sophie auf ihren jüngeren Liebhaber Octavian verzichtet. Mit den Intrigen, die dem lüsternen Baron von Ochs eine Lektion erteilen, bietet sie auch überbordende Operetten-Wirren, die dank der hervorragenden Leistung des Luzerner Sängers Alfred Muff in der Rolle des Barons ein Höhepunkt des Abends sind.
Ambitionen des Hoteliers
Ansonsten hebt sich die Inszenierung von Sven-Eric Bechtolf von einschlägigen Regietraditionen ab. Statt verschnörkelter Luxus-Interieurs herrschen klare Linien und Flächen vor: eine hohe, weite Glaswand im ersten und dritten Akt, eine monumentale Küche im Mittelakt. Sie deutet darauf, dass der neureiche Herr von Faninal, der sich durch die Verheiratung seiner Tochter Sophie mit Baron Ochs Eingang in die höheren Gesellschaftsschichten erhofft, einem riesigen Hotelbetrieb vorsteht.
Prunk der Musik
Im Mittelakt weichen Bechtolf, Rolf Glittenberg (Bühnenbild) und Marianne Glittenberg (Kostüme) am stärksten vom Regiemodell ab, das während Jahrzehnten die Aufführungspraxis dieser Oper bestimmt hat. In diesem Modell erreichte jeweils mit dem musikalischen Prunk der Überreichung der silbernen Rose durch den Rosenkavalier Octavian auch der äussere Prunk mit dem Palais des Herrn von Faninal seinen Höhepunkt. In der Zürcher Neuinszenierung bleibts beim musikalischen Prunk. Das Orchester der Oper Zürich unter Rückkehrer Franz Welser-Möst läuft vom Vorspiel weg mächtig auf Touren und entwickelt einen unwiderstehlichen Sog, der die artifizielle wie bodenständig auftrumpfende Partitur bis in Details belebt und klanglich auf Hochglanz poliert.
Vom Publikum gefeiert
Auch die psychologische Personenführung überzeugt in diesen beiden Akten. Nina Stemme ist eine ausgesprochen jugendliche Feldmarschallin und doch ahnt sie von Anfang an, dass sie einer jüngeren wird Platz machen müssen. Dass sie im dritten Akt, nachdem sie Sophie und Octavian zusammengeführt hat, für einen Moment zusammenbricht, bringt sie uns menschlich näher. Die schwedische Sopranistin singt nicht nur schön, sondern auch mit Empfindung und vorzüglicher Diktion. Letzteres ist auch ein Plus von Alfred Muffs Baron Ochs. Muff macht den Altersunterschied zu Nina Stemmes Feldmarschallin, mit der er vom Publikum begeistert gefeiert wurde, durch das souveräne Spiel und den sonoren Wohllaut seines Bassbaritons wett.
Alles in allem ist dieser «Rosenkavalier» ein musikalischer Leckerbissen mit präzise geführten und herausragend singenden Solisten.
|

6. 7. 2004
Halb imaginär, halb real
Richard Strauss' «Rosenkavalier» im Opernhaus
Die Festspielpremiere des Zürcher Opernhauses lässt sich zwar nicht dem Schwerpunktthema Böhmen zuordnen, doch der «Rosenkavalier» von Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal ist eine Festoper par excellence, und sie erfährt hier eine Wiedergabe, die in jeder Hinsicht Festspielrang hat.
Wie viel Spielraum hat ein Regieteam, das den «Rosenkavalier» traditionell und in historischen Kostümen, aber nicht konventionell aufführen will? Bis ins kleinste Detail von Ausstattung und Personenführung gibt das Textbuch von Hugo von Hofmannsthals «Komödie für Musik» die szenische Realisierung des Werkes vor. Doch der Ort, wo die Handlung spielt, ist «halb imaginär, halb real»: Wien zur Zeit der Kaiserin Maria Theresia. In diesem «halb und halb» scheinen Sven- Eric Bechtolf (Regie), Rolf Glittenberg (Bühne) und Marianne Glittenberg (Kostüme) den Schlüssel gefunden zu haben, der ihnen die Türen öffnet in den Phantasieraum eines neuen und doch vertrauten «Rosenkavaliers».
Vieles darin ist anders als üblich. Im ersten Akt gibt es weder ein Bett noch einen Alkoven. Die Marschallin und ihr junger Liebhaber Octavian befinden sich in einem lichtdurchfluteten Zimmer mit gerundeter Fensterfront. Die rechte Wand ist mit einer Schar bunter Porzellanvögel dekoriert. Wären sie lebendig, könnten sie auf die im Raum verteilten kahlen, schlanken Bäume flattern. Doch es ist eine Kunstwelt, mit artifiziellem Raffinement und subtilster Ästhetik inszeniert. Die Vorliebe des Rokoko-Zeitalters für Exotisches spiegelt sich in den à l'indienne gekleideten Lakaien und - einer von vielen witzigen Einfällen - im Auftritt des Sängers als chinesischer Schachautomat, der allerdings von Boiko Zvetanov auch eine automatenhaft laute Tenorstimme erhält.
Anders, aber wiedererkennbar
Noch ungewöhnlicher die Szenerie des zweiten Aktes (Saal bei Herrn von Faninal): Die Überreichung der silbernen Rose, bei der sich Sophie, die Braut des Barons Ochs auf Lerchenau, und der Rosenkavalier Octavian begegnen, findet in der im Soussol des Palais gelegenen Küche statt. Das Zeremoniell erhält dadurch fast alltäglichen Charakter, aber die Atmosphäre erregter Erwartung wird durch das geschäftige Hantieren des Personals - mit aktiver Assistenz Sophies - noch gesteigert, und der Reichtum des Faninal lässt sich an der Ausstattung seiner blitzblanken Küche sehr wohl ablesen. Farbgebung und Lichtführung sind hier ebenso stimmig und stimmungshaft wie im ersten Akt. Dass der dritte in einem schäbigen Vorstadt-Beisl spielt, wirft auf die meisten «Rosenkavalier»-Aufführungen einen Schatten. Auch dies ist bei Bechtolf und den Glittenbergs anders. Sie führen uns zurück in das mit einem Zelt ergänzte Zimmer der Marschallin, womit nicht nur der Glanz der vorangegangenen Akte erhalten bleibt, sondern auch - was mehr zählt - der innere Bezug zwischen Anfang und Ende verdeutlicht wird. Denn zum einen ist ja das Rendez- vous von Ochs und «Mariandel» nichts anderes als eine ordinäre, von Octavian als turbulente Maskerade veranstaltete «Paraphrase» der Liebesnacht Octavians und der Marschallin. Und zum anderen erfüllt sich hier, was die Marschallin damals schmerzlich erahnt hat: dass sie Octavian bald an eine andere, Jüngere verlieren wird. Aber nicht nur der erste «Rosenkavalier»-Akt lebt in diesem intensivsten Teil der Aufführung wieder auf, sondern auch der alte Falstaff in der Geisternacht und der «Sommernachtstraum».
So gehen in dieser Aufführung Wiedererkennen und Neuentdecken Hand in Hand. Innovation resultiert dabei nicht aus radikalen Brüchen mit der Tradition, sondern aus einer Vielzahl kleiner, geistreicher Variationen und Verschiebungen, bis hin zum zauberhaft elegischen Ausklang mit dem kleinen Mohren. Die Phantasie und die Detailfreude der szenischen Umsetzung sind jedenfalls der Vorlage ebenbürtig. Und drohen die Einfälle des Regisseurs - vor allem im ersten Akt - manchmal auszuufern, so kann man sich an der delikaten Opulenz der Kostüme gar nicht satt sehen.
Frisch und natürlich
Bestimmend für den neuen Zürcher «Rosenkavalier» aber ist der Eindruck von Frische und Unmittelbarkeit, und dies verdankt sich ebenso sehr der musikalischen wie der szenischen Wiedergabe. Franz Welser-Möst lässt den Klang in den leuchtendsten, sattesten Farben aufblühen, aber da er eine ausgesprochen zügige, zielstrebige Gangart pflegt - mit wohldosierten Ruhepunkten - und nicht nur das Farb-, sondern auch das dynamische Spektrum in seiner ganzen Breite ausschöpft, entsteht nie Schwere oder Massigkeit. Das Orchester seinerseits erweist dem früheren Chef mit ebenso musikantischem wie diszipliniertem, reaktionsschnellem Spiel die Reverenz.
Dass mit Nina Stemme eine sehr jugendliche, natürliche Marschallin verpflichtet wurde, drückt der gesamten Besetzung den Stempel auf. Sie hat zwar noch nicht die persönliche Autorität und Ausstrahlung der ganz grossen Rolleninterpretinnen, und ihr Sopran entfaltet erst nach und nach seine Wärme und Geschmeidigkeit - um dann dem Schlussakt das Glanzlicht aufzusetzen -, aber sie passt genau in Bechtolfs Konzept, das die Gattungsbezeichnung wörtlich nimmt: Komödie für Musik. Daran hält sich auch Vesselina Kasarova bei ihrem mit Spannung erwarteten Rollendébut als Octavian. Mit unbändiger Spiellust holt sie alle Facetten dieser Bühnengestalt ans Licht. Nicht nur darstellerisch, auch stimmlich weiss sie dem ständigen Changieren zwischen Bub, Mann und Kammerjungfer Ausdruck zu geben. Das Rollenbild mag noch nicht ganz gefestigt und in sich geschlossen sein, doch schon jetzt lässt sich erkennen, dass Vesselina Kasarova einen ganz eigenen Rosenkavalier kreiert hat.
Alfred Muff als Ochs dürfte im Protagonistenkreis der Sänger mit der längsten Rollenerfahrung sein. Er macht sie fruchtbar in einem Charakterbild von urwüchsig temperamentvoller, aber nie ordinärer Art, das Momente stimmlicher Sprödigkeit leichthin integriert. Die Dritte im Bund der Frauenstimmen ist Malin Hartelius, keine puppenhaft gezierte, auf den strahlenden Silberton fixierte Sophie, sondern eine, die auch der Kränkung und dem Schmerz - als sie im dritten Akt Octavian zu verlieren meint - Ausdruck zu geben vermag. Zahlreiche weitere Figuren wären noch anzuführen, von Rolf Haunsteins Faninal, Liuba Chuchrovas Leitmetzerin, Rudolf Schaschings Valzacchi und Brigitte Pinters Annina bis zu dem für einmal wirklich als Knabe dargestellten Sohn und Kammerdiener des Ochs. Es genüge hier die Feststellung, dass sie alle zur Vielgestaltigkeit und Farbigkeit dieser Aufführung beitragen. - Nach der im Dezember letzten Jahres präsentierten Neuinszenierung von «Elektra», dem so völlig anders gearteten Vorgängerwerk des «Rosenkavaliers», hat das Opernhaus mit dieser Festspielproduktion einen weiteren markanten Akzent in seinem Strauss-Repertoire gesetzt.
Marianne Zelger-Vogt
|

6. 7. 2004
Die Basis legte der Dirigent
Im Rahmen der Zürcher Festspiele wird im Opernhaus Richard Strauss' «Rosenkavalier» aufgeführt
Die Neuproduktion von Richard Strauss' «Rosenkavalier» am Opernhaus Zürich glänzte nicht nur mit einer intelligenten Regie, sondern vor allem mit einer grandiosen Besetzung.
Von Reinmar Wagner
Ausgerechnet eine Küche, die eher an eine Konservenfabrik erinnert, repräsentiert die Faninals. Und hier wird - quel affront! - auch die silberne Rose als traditionelles Symbol der Brautwerbung überreicht. Für die Lebensumgebung der Marschallin dagegen wählten Regisseur Sven-Eric Bechtolf und der Bühnenbildner Rolf Glittenberg einen hohen, kalten Raum und den winterlichen Tod der Natur in Form von blattlosen Bäumen und ausgestopften Vögeln. Unerklärlicherweise spielt auch der letzte Akt - mit einer turbulenten, schrägen Geisterbahn - in den Gemächern der Marschallin.
Der Komödie Raum gelassen
Nicht alles versteht man wirklich an dieser Inszenierung und an diesem Bühnenbild. Manches wirkt zwar originell und amüsant oder auch atmosphärisch oder einfach schlicht schön und nimmt bei allen neuen Ideen durchaus viele Elemente einer traditionellen Inszenierung dieses anspruchsvollen Stücks auf und lässt der Komödie ihren Raum. Aber so richtig wichtig wird das alles nicht für die Inszenierung, sprich für das Verständnis der Hauptfiguren.
Was die Protagonisten bewegt, wie sie zueinander stehen, wie sich Octavians Gefühle entwickeln, das erfahren wir durch einfache, rein schauspielerische Mittel - und durch die Musik. Zentrale Momente, etwa die Begegnung Sophies mit Octavian oder das Terzett am Ende, überlässt Bechtolf sogar einfach sich selbst, hält quasi die Zeit an (wenn doch die Marschallin das könnte!) und erzählt in diesen Augenblicken des angehaltenen Atems ganze Liebesgeschichten.
Oder besser: Er gibt Raum, damit sie erzählt werden können. Denn was uns anrührt und bewegt, ist schon da - von Hugo von Hofmansthal gedichtet, von Richard Strauss kongenial in Musik gesetzt - und wird von Musikern zum Leben erweckt, die nicht nur diese Freiräume zu nutzen wissen, sondern all ihre reichen Fähigkeiten einzusetzen wissen, um bis zum Boden einzudringen in die Innenwelten dieser Figuren. Nur so ist es möglich, in diesem überaus schwierigen Stück eine Intensität zu erreichen, die nicht auf oberflächlichen Reizen basiert.
Wach und agil gespielt
Die Basis zu dieser durchdringend-tiefen musikalischen Auseinandersetzung legt Dirigent Franz Welser-Möst mit seiner überaus wachen, kammermusikalisch-detaillierten Interpretation. Man kennt seine Ästhetik von seinen Wagner-Dirigaten her - und doch überrascht es immer wieder, wie er aus vermeintlich bestbekannten Partituren Motive, Farben, Nuancen der Instrumentierung herausholt, die sonst immer überspielt werden. Wir wissen ja, dass Strauss ein genialer Instrumentierer war, aber bei Welser-Möst - und dem wach und agil spielenden Zürcher Opernorchester - erfahren und erleben wir das auch. Und was für den Detailreichtum insgesamt gilt, hat hier in besonderem Mass Wichtigkeit für die dynamischen Feinheiten.
Und dies trotz einem Protagonistenquartett, bei dem sich der Dirigent keineswegs hätte zurückzuhalten brauchen, denn Malin Hartelius, Alfred Muff, Nina Stemme und Vesselina Kasarova sind nun keineswegs Sänger, denen es gleich angst und bange wird, wenn das Strauss-Orchester einmal so richtig seine Krallen zeigt. Aber Welser-Mösts konsequentes Zurückfahren der Dynamik nach diesen Ausbrüchen hatte nicht nur den dramatisierenden Effekt, dass diese Momente intensiver und mitreissender wurden, sondern gab den Sängern dazwischen auch allen Raum, sich auszudrücken und die Zwischentöne ihrer Partien auszuloten. So konnte zum Beispiel Nina Stemme - eine der heute mächtigsten Sopranstimmen weltweit - eine Marschalllin geben, die ungwohnt schattiert und nachdenklich klingen konnte und dennoch stets präsent - und meistens sogar textverständlich war. Bei Malin Hartelius überzeugte vor allem ihre glockenreine Höhe, mit der sie berückend schön über den Ensembles und dem Orchester schwebte.
Alfred Muff war - nicht zum ersten Mal - als Strauss'scher Erzkomödiant der Extraklasse zu bewundern, der bei allem bärbeissigen Klamauk nicht den Charme der schönen Töne vergass. Und Vesselina Kasarova, die zum ersten Mal die Partie des Octavian sang, bezauberte mit ihrer Vielseitigkeit und mit ihrem intelligenten Gestalten, das jeder Phrase - ob absichtlich übertriebenem Chargieren als Mariandel oder echte Gefühlstiefe eines liebesverwirrten 17-Jährigen - gerecht wurde.
Eine kleine Ohnmacht
Die vielen - teils horrend schwierigen - Nebenrollen wurden aus dem Ensemble und dem Opernstudio besetzt und dies durchwegs mit hervorragendem Resultat, wie vor allem Brigitte Pinter als Annina und Boiko Zvetanov als italienischer Sänger bewiesen, der bulgarische Tenor zudem in einem der besten Regie-Einfälle als chinoiserien-seliger Schach- und Sing-Automat, der sogar der Marschallin eine kleine Ohnmacht entlockte.
|

6. 7. 2004
Schönheit, unaufhörlich und schon vorbei
Das Zürcher Opernhaus hat einen klugen und hochmusikalischen «Rosenkavalier»: Die Festspiel-Premiere am Sonntag wurde zum Triumph.
Von Michael Eidenbenz
Leicht macht es dieses Stück einem Regisseur nicht. Denn «Der Rosenkavalier» ist eine perfekte Oper. Was je an idealem Zusammenwirken von Text und Musik versucht wurde, ist hier erreicht. Wort und Ton sagen alles, die kompositorische Illustration eines federleichten, von der Zeit verwehten, wundersam bedeutungslos poetischen Geschehens ist bis in die einzelne Note vollkommen. Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal bringen die Sache sozusagen unter sich zu Ende und lassen keine Lücke offen, in der ein ehrgeiziges Regieteam seinen konzeptuellen Hebel ansetzen könnte.
Selbst die zart-ironische Distanzierung vom eigenen nostalgischen Tun wird bereits geliefert. «Die schöne Musi», plärrt im dritten Akt das betrunkene Mariandel: «Da möchte man weinen.» Und man lacht, während man doch längst schon feuchte Augen hat - «weils gar so schön ist». Was bleibt, sind die Figuren, die in ihrer historischen Wirklichkeit längst tot sind und doch im Kunstraum der Oper so lebendig und liebenswert wie keine anderen. Ihnen tatsächlich mit Liebe und ernsthaftestem Respekt begegnet zu sein, ist die erste und schönste Qualität dieser Inszenierung. Doch von vorne.
Erstarrte Zeit, zeitlose Handlung
Franz Welser-Möst startet mit furiosem Tempo zum Vorspiel. Zu sehr Hals über Kopf vielleicht, bald aber wird er das Verhältnis von dramatischem Zug, Detailausformung und transparenter Präzision finden und daraus einen wahrhaft grossen Abend machen. - Vorhang auf, wir finden die Marschallin mit ihrem Lover Oktavian am Boden im Bett. In einem weissen Raum, der von kahlen Bäumen durchwachsen ist, an der Seitenwand ausgestopfte Vögel über einem grossen Kamin, die hohen Fenster im Hintergrund sind beschlagen - es ist Winter, eine ästhetisch erstarrte Zeit für die zeitlose Handlung hat Bühnenbildner Rolf Glittenberg entworfen, Marianne Glittenbergs Kostüme deuten ein vages 18. Jahrhundert an.
Das Bühnentemperament wird vorerst von Vesselina Kasarova als Oktavian bestimmt. Ein aufbrausender junger Liebhaber ist sie, mit blitzenden Augen, mit Feuer und kernig strahlendem Glanz in der Stimme. Auch Nina Stemme ist eine noch junge Marschallin, zu verliebten Spässen aufgelegt; die verwunderte Melancholie und die ergebene Gelassenheit ihrer eigenen Vergänglichkeit und der ihrer Affäre gegenüber wird sie erst im berühmten Monolog über die Zeit erlangen. Dieser gerät im Zusammenwirken mit Franz Welser-Möst und dem sensationell disponierten Orchester der Oper zum innigen Kern des Akts. Da ist alles hörbar und musikalisch evident, von den zerrieselnden Bläserfiguren bis zu einem Timing, das von Anfang bis Ende «stimmt».
Regisseur Sven-Eric Bechtolf lässt den Figuren Raum, verzichtet auf Spielchen, wo es ernst wird, spart die Originalitäten auf für die turbulente Antichambre, die dazwischen das fürstliche Schlafzimmer überfällt: Hundeverkäufer, die bettelnden adeligen Waisen, ein barock bizarr kostümierter Friseur und der Tenor haben ihren Auftritt. Letzterer - Boiko Zvetanov schmettert kraftvoll seine italienische Arie - erscheint als singender Schachautomat, ein fröhlich einleuchtender Einfall.
Anderes gibt grössere Rätsel auf. Etwa wieso der zweite Akt in der Küche des bürgerlichen Brautvater-Palais spielt. Und was werkeln die Köche da mit blauer Masse und Fleischwölfen? Ist es symbolisch adeliges Blut, das hier in blaue Blutwürste abgefüllt wird? Egal, dem Zauber der Übergabe der silbernen Rose tut es keinen Abbruch, ja für diesen magischen Moment wird die Zeit gar in dornröschenartigem Bewegungsstillstand für einen Augenblick angehalten.
Kinder-Lakaien, greiser Sekundant
Malin Hartelius ist eine so süss-naive Sophie, dass sie nicht nur ihren Rosenkavalier, sondern spürbar auch das Publikum augenblicklich verzaubert. Und ihr Bräutigam? Schon im ersten Akt hatte Alfred Muff dem Baron Ochs von Lerchenau noch einen Rest Noblesse gelassen, den aufgeblasenen schlechten Kerl nicht zum Buffo-Trampel verkommen lassen. Jetzt aber, wo ihm seine junge Braut und ihr neuer Verehrer so widerspenstig mitspielen, wo er schliesslich mit blutender Blessur ächzend auf dem Küchentisch liegt, gibt ihm Muff geradezu Falstaff-würdige Dimensionen. Wie prächtig er lamentiert, wie er sich dennoch wundernd amüsiert über die groteske Geschichte, die ihm da widerfährt, wie er gar zum Verzeihen bereit wäre, wie er sich auf sein Federbett freut.
Dem alten Ochs hat die Regie einen Kinder-Lakaien beigegeben, sein eigen Fleisch und Blut, «ein Kind seiner Laune». Im Zimmer der reifen Marschallin spielte ein Kind (der «kleine Neger» bei Hofmannsthal). Und auch der 17-jährige Oktavian hat sein altersmässiges Vis-à-vis, einen zitternden, fast scheintoten silbernen Greis als Sekundanten: Vergangenheit und Zukunft sind in jedem Lebensaugenblick vorhanden, Hofmannsthals «Gleichzeitiges im Ungleichzeitigen» erlangt hier leise schaudernde Bühnenwirklichkeit.
Im dritten Akt lässt Bechtolf daraus wirkliche Skelett-Gespenster werden, die des Barons Tête-à-tête im Beisl grotesk aufmischen. Dieses ist ein Zelt im Raum des ersten Akts, die Kellner sind, weil der Ochs sie eben einmal so bezeichnet, tatsächlich als Maikäfer kostümiert. Doch die Groteske wird nicht überdreht, ordnet sich dem Spektakel unter, das die Handlung nun entfacht.
Herausgehoben aus dem übrigen, durchweg ausgezeichneten Ensemble seien Brigitte Pinter und Rudolf Schaschnig als virtuoses Intrigantenpaar - und Rolf Haunstein, der als Brautvater Faninal einen zu fassungslosem Entsetzen angesichts des Scherbenhaufens seines erhofften sozialen Aufstiegs gesteigerten grossen Auftritt hat.
Im Übrigen aber gilt es, noch einmal zu bewundern, wie sorgfältig Bechtolf die Figuren führt. Wie durch blosses Positionieren, durch angedeutete Gesten und Blicke zuletzt die subtilen Beziehungen im Trio von Sophie, Oktavian und Marschallin allmählich unwiderruflich geklärt werden. Und wie die drei fantastischen Frauenstimmen verschmelzen in einer Schönheit, die unaufhörlich und doch immer schon vorbei ist. Geführt von einem Franz Welser-Möst, der in den grossen Schlussovationen mit allem Grund als Star des Abends gefeiert wurde.
|

6. 7. 2004
«Rosenkavalier» mit Augenzwinkern
Premiere der Oper «Der Rosenkavalier» von Richard Strauss am Opernhaus Zürich
Mit Richard Strauss' beliebtem «Rosenkavalier» als Beitrag zu den Zürcher Festspielen schliesst das Opernhaus Zürich seine diesjährige Spielzeit ab. Die Premiere am Sonntagabend in der Inszenierung von Sven-Eric Bechtolf wurde zum Erfolg für alle Beteiligten.
Eine unkonventionelle und neuartige Inszenierung von Richard Strauss' Meisteroper «Rosenkavalier» - geht das überhaupt bei dieser in einer geradezu zementierten Aufführungstradition erstarrten Oper?
Sophie im Schrank
In Zürich gelingt Sven-Eric Bechtolf das Kunststück, eine augenzwinkernde, witzige Regie herbeizuzaubern, obwohl er die berühmte Rosenübergabe im Mittelakt geradezu zerpflückt. Anstatt gebannt und majestätisch sich gegenüberzustehen und nur die Musik sprechen zu lassen, muss Graf Octavian seine zukünftige Liebe Sophie zuerst in einem Schrank suchen, wo sie sich in ihrer Nervosität versteckt hat.
Doch damit nicht genug. Sophie empfängt den Rosenkavalier und nachher ihren Bräutigam, den ungehobelten Ochs auf Lerchenau, nicht etwa im mondänen, neureichen Salon ihres Vaters Faninal, nein, sie steht in der Küche. Hier verarbeitet das Personal an zwei langen Tischen eine giftig-türkisfarbene Masse - ein Verweis auf die unlauteren Machenschaften, dank denen Faninal zu Reichtum und (Pseudo-)Ehre gekommen ist.
Sophie, von ihrem despotischen Vater gegeisselt und zur Fronarbeit in der Küche verbannt, ist bei Bechtolf alles andere als ein naives Mädchen, das auf ihren Erlöser wartet. Mit subtiler Personenführung gelingt es dem Regisseur, eine moderne Lesart zu schaffen, ohne die Substanz des Werkes anzutasten.
Dramaturgische Einheit von Bühne, Kostümen und Gestik
Diese Feinfühligkeit den Charakteren der Figuren gegenüber zieht sich durch das ganze Stück und wird durch die dramaturgische Einheit von Bühne, Kostümen und Gestik unterstrichen. Zu dieser wunderbar stimmigen Lesart passt auch, dass es das Ausstattungsteam nicht nötig hat, das Ambiente in die Moderne zu verlegen. Rolf und Marianne Glittenberg (Bühnenbild und Kostüme) halten an der von Hofmannsthal vorgegebenen Zeit des Rokoko fest, allerdings in einer schnörkellosen, stimmigen und in Details witzigen Umsetzung.
Dies gilt nicht nur für die Küche, die sich, wie in Herrschaftshäusern üblich, im Souterrain befindet und über ein grosses Rundbogenfenster in der Höhe mit Tageslicht versorgt wird. Hinter diesem Fenster versteckt und doch gut sichtbar, spielen sich dann die Intrigen und Gelage im Hause Faninal ab.
Auch der erste Akt bringt Neues und öffnet den Blick für die Freuden und Nöte der Figuren. Er spielt in einem Wintergarten: Die Bäume sind entblättert und öde, das Bett von Marschallin und Octavian ist ein mit Laken und Kissen improvisiertes Nachtlager, das in jugendlichem Übermut gebastelt worden ist. Das die Marschallin beherrschende Thema des Vergehens der Zeit wird durch die Wahl der Jahreszeit Winter ebenso vermittelt wie die sich wiederholenden Komplikationen der dekadenten Gesellschaft des Fin de siècle.
«Ochs» für einmal überzeugend
Die Ambivalenz der jugendlichen Marschallin, die, in reicher Langeweile erstarrt, durch einen 17-jährigen Buben für kurze Zeit zur Lebendigkeit zurückfindet, wird von Nina Stemme einfühlsam gezeichnet. Ihre volle, prägnante Stimme und ihre stolze Erscheinung voll Schönheit und Melancholie geben der Figur eine verinnerlichte Vitalität. Auch die «Problemfigur» des Ochs wird in Zürich zum Augen- und Ohrenschmaus. Richard Strauss hatte einst moniert, dass die meisten Bassisten daraus «ein scheussliches, ordinäres Ungeheuer mit gräulicher Maske und Proletariermanieren auf die Bühne gestellt» haben.
Nicht so Alfred Muff, der bei aller Derbheit zuletzt doch immer die Grenzen wahrt. Köstlich sein Duell mit Octavian, das nicht mit dem Degen, sondern mit einem Küchenmesser ausgetragen wird. «Schwer getroffen» durch die Stiefel auf dem Fussrist, legt er sich auf den Küchentisch und bejammert mit wuchtigem, tiefem Bass sein Schicksal - ein Bravosturm war ihm nach dieser Glanzleistung sicher.
Kasarovas Rollendebüt
Wandlungsfähig und facettenreich präsentierte sich Vesselina Kasarova bei ihrem Debüt als Octavian. Ihre Stimme teilt sich in merkwürdiger Weise in zwei Register, ein etwas «hohles», sehr eigen gefärbtes tiefes, und ein für einen Mezzo bemerkenswert strahlendes bei den hohen Tönen. Damit gewann sie dem Mariandel im 3. Akt komödiantisch spitze Facetten ab.
Klangfülle ohne Leichtigkeit
Und doch tat sie sich mit ihrer an Rossini und Mozart geschulten, klar und technisch perfekt geführten Stimme an diesem Abend auffallend schwer, konnte sie sich doch in der Klangfülle nicht immer behaupten. Dies lag allerdings auch an der Sichtweise von Franz Welser-Möst am Pult des Opernhausorchesters.
Der typische strausssche Konversationston liegt ihm weniger als die grosse, üppige Geste. Die sinfonische Selbstständigkeit des riesig besetzten Orchesters steht im Zentrum, allerdings etwas auf Kosten der an Mozart gemahnenden Leichtigkeit - nicht umsonst bezeichnet man ja den «Rosenkavalier» als Strauss' «Mozart-Oper». Die stark an Rhythmus, straffer Kontur und Tempo orientierte Interpretation ebnete manche Nuance einfach ein, und entsprechend litt in den Parlando-Passagen die Diktion der Sängerinnen und Sänger.
Dafür gerieten die grossen Szenen wie die Rosenübergabe, der Walzerrausch von Ochs oder das Terzett zu wahren Klangorgien, wobei sich das Opernhausorchester zu prächtiger Fülle aufschwang. Kasarova ist eine wahre Künstlerin der Farben und Feinheiten, die sie in den Duetten mit der leichtfüssigen, quirligen Stimme von Malin Hartelius als Sophie zur wunderbaren Einheit verschmelzen liess oder in hell tönenden Gegensatz zum dunklen Bass von Muff stellte. Mit permanentem Furioso zog Rolf Haunstein den Faninal durch, den er als komische Herrschaftsgestalt zeigte. Überhaupt brachten die zahlreichen, szenisch präzis geführten Nebenrollen viele zusätzliche Facetten.
Da war etwa der als japanische Spielfigur präsentierte «Sänger», von Boiko Zvetanov mit stählerner, leicht larmojanter Stimme als mechanische Puppe dargestellt. Oder Valsacchi und Annina, von Rudolf Schasching und Brigitte Pinter als doppelbödiges Intrigantenpaar schön gespielt, in den schnatternden Passagen aber von Welser-Möst verhetzt.
Und schliesslich setzten auch die zahlreichen «Traumvisionen» im dritten Akt Glanzlichter, sei es der listig-helle Spieltenor Volker Vogel als giftig-grüner Wirt, seien es die als Käfer verkleideten Kellner oder die als Bienchen herbeieilenden Kinder, die immerfort «Papa» schreien. Ein Abend voller Überraschungen und liebevoll-witziger Details.
Sibylle Ehrismann
|
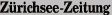
6. 7. 2004
«Halb Mal lustig, halb Mal traurig»
Zürcher Festspiele: «Der Rosenkavalier» von Richard Strauss als Neuinszenierung am Opernhaus
Neu ist hier fast alles - so neu, dass es den Operhhabitué, der auf seinen «RosenkavaIier» eingeschworen ist, verwirren mag. Doch die Neuinszenierung von Sven-Eric Bechtolf, wenn ihr auch nicht alles restlos überzeugend gelingt, zeigt doch eines: Es geht auch ohne Rokoko-Patina aus zweiter Hand.
WERNER PFISTER
Nein, wenn der Vorhang sich erstmals hebt, liegen sie nicht im Bett. Knutschen die Feldmarschallin (nach Hofmannsthals, des Librettisten, Vorstellung 35 Jahre alt) und ihr junger Liebhaber Octavian (17), der von einem Mezzosopran gesungen wird, nicht einigermassen verlegen in zerwühlter Bettwäsche herum. Oh nein, die sind nämlich bereits getrennt, waren es wohl von Anfang an. Denn während er, auf dem Bett kniend, in spätpubertären Aufschwüngen seine Liebe beschwört, sich ekstatisch in «selbstischen» Worten ergeht, ohne damit ein Du zu erreichen, steht sie, die ihn in die Liebe eingeführt hat, weit weg draussen im Garten und schaut hinter der immensen Fensterfront ins Schlafzimmer: Was hat sie da angerichtet?
Pekingoper
Solche Bilder sind es, die uns an der (visuellen) Oberfläche die Abgrundtiefe der psychologischen Vorgänge subtil versteckend - auf einen einzigen Blick alles erahnen lassen. Für den ersten Akt hat Rolf Glittenberg einen immensen, lichten Innenraum gebaut, die ganze Hinterfront durch wahrhaft übermenschlich grosse Fenster abgeschlossen. Frei wird der Durchblick nach aussen allerdings nie, die Fenster sind schon halb blind geworden. Wer von aussen hinein schaut, ahnt mehr als er erkennen kann - ausgeschlossen vom Lebenszusammenhang.
Immer wieder gelingt es dem Regisseur, szenische Aperçus - etwa der Auftritt der «Bagagi» mit einem Sänger im Zentrum - mit leichter Hand unaufdringlich, manchmal fast unmerklich ins gesamte Handlungsgewebe einzuflechten. Der Sänger also tritt als «Geschenk» auf, eingepackt in eine riesige Box; alles ist in chinesischer Manier fein adrett drapiert, und wie sich die Verpackung endlich öffnet, steht der Sänger wie ein Direktimport aus der Pekingoper da, starr ein Visitenkärtchen in der Hand, auf dem wohl der Name jenes Liebhabers steht, welcher der Marschallin hiermit ein Geschenk machen will.
Evanouissement
Nun beginnt der Tenor seine gefürchtete Arie zu singen - dies allerdings auf jene typisch italienisch-tenorale Macho-Art, als ging es um die eisumgürtete Turandot und ihren Kalaf bei Puccini (China grüsst). Prompt wird die Marschallin ob so viel tenoralen Schmelzes oder auch nur der puren Lautstärke wegen von einem plötzlichen évanouissement ereilt und gleitet sanft zu Boden. Es darf in diesem «Rosenkavalier» nämlìch gelacht werden - «ein halb Mal lustig, ein halb Mal traurig», ganz nach der Marschallin Devise.
Der zweite Akt spielt zwar im Palais von Faninal, aber nicht im Empfangsaal, sondern in der Küche im Souterrain - dort, wo alle kulinarischen Vorbereitungen zur festlichen Überreichung der silbernen Rose zusammenlaufen. Auch Sophie steht an einem der sechs Küchentische, führt - mit der Zubereitung von zarten Schnitzeln beschäftigt, - das nach einem respektablen Dutzend zählende Küchenpersonal an. Die Rosenübergabe fíndet seitwärts neben dem Treppchen zur Vorratskammer statt (wo der später so dringend gebrauchte Tokaier Iagert), «festlich» bestenfalls in Anführungszeichen, jedenfalls fremd in dieser umtriebigen Welt. Und die Zeit, wenn sich Octavian und Sophie duettierend in eine präexistente Kinderwelt zurückzuträumen beginnen («Wo war ich schon einmal, und war so selig») - die Zeit, die steht dann wirklich still.
Sommernachts-AIbtraum
Der drítte Akt mit seinen diversen Maskenspielen und Verwechslungskomödien spielt nicht im Extrazimmer eines Gasthauses, sondern wieder in der Marschallin Schlafzimmer, welches - mit einem Mini-Bier-Zeltchen in der Mitte - auf Beisl-Atmosphäre getrimmt wird. Überzeugend wirkt das allerdings bis zum Schluss nicht so recht, zumal es den wahrhaft beklemmenden Eindruck, den man vom ersten Akt noch in sich spürt, irgendwie schal werden lässt.
Getreu nach dem Wortlaut des Librettos («Was woll'n die Maikäfer da?», fragt Ochs) treten Wirt und Kellner mit Insektengesicht samt überdimensionierten Fühlern auf und die (vermeintlichen?) Kinder des Baron Ochs mit Insektenflügeln: ein einziger Sommernachts-Albtraum. Entsprechend schwierig wird es nach all diesem Kunterbunt, beim Auftrift der Marschallin zu gehörigem Ernst zurückzufinden. Und als er sich schliesslich einstellt, wirkt er bleich und blutarm: Dieser Gesellschaftsschicht, der herrschenden, wir ahnen es, scheint die Zukunft nicht wirklich mehr zu gehören.
Spielstück
Was solcherart szenisch mit leichter Hand angedeutet wird - ohne den Zwang, es immer fassen zu müssen -, findet in der musikalischen Realisation ein glückhaft kongeniales Pendant. Statt die Musik, da und dort eh lustvoll vorlaut, protzig aufzubauschen, dirigiert sie Franz Welser-Möst mit leichter Hand als unbeschwertes Spielstück («Komödie für Musik» nannten es die beiden Autoren), reizvoll in der aparten Klanglichkeit der kammermusikalischen Details.
Er legt die musikalischen Reize der Partitur aus wie eine edle Sammlung von glitzernden Edelsteinen, die er überdies mit dem Orchester der Oper Zürich aufs Sorgfältigste zugeschliffen und poliert hat. Das instrumentale Parlando klingt wunderbar geschmeidig und beredt und hat - gerade dort, wo Tiefsinn an der spielerischen Oberfläche aufblinkt - eine gleichsam lässige Grazie, hat Schwung,, Lockerheit und gewinnt eine zuweilen fast narkotisierende Leuchtkraft.
Noblesse
Hochkarätige Sängerstimmen tragen zum Glück der Aufführung bei. Nina Stemme kann als Marschallin mit fülligem Sopran aus dem Vollen schöpfen, beherrscht gleichzeitig das leicht fliessende Parlando famos, ohne je das Larmoyante zu streifen, und ist eine fein differenzierende, sehr anrührende Darstellerin von beeinruckender Erlebnisfähigkeit. Vesselina Kasarova singt ihren ersten Octavian (und damit ihre erste Strauss-Partie überhaupt), beneidenswert strahlkräfig in den jünglingshaft überschwänglichen Aufschwüngen. Das ganze «qui-pro-quo», die Frau in einer Jungmännerrolle, die sich zudem bei Bedarf in ein Dienstmädchen verkleidet, wirkt keinesfalls übertrieben, könnte im Gegenteil sogar noch klarer voneinander abgesetzte Konturen vertragen.
Alfred Muff singt und spielt den Baron Ochs ohne aufgesetzte Dickwanstigkeit; das Komödiantische (auch in seiner Stimme wird nie derb, sondern bleibt stets Spiel. Malin Hartelius verströmt in der Rosenübergabe wunderbar lyrische (und wunderbare höhensichere) Innigkeit, der Liebreiz in Person sozusagen, weiss aber auch mit entschiedener Energie zu parlieren. Rolf Haunstein steIlt als Faninal den perfekten Neuadligen dar - nämlich noch nicht in allen Belangen stilsicher dem Adel zugehörig. Und Boiko Zvetanov als Sänger, wie gesagt: Da scheint sich ein stimmstrotzender Kalaf in den «Rosenkavalier» verirrt zu haben. Wie auch immer: Die übrigen zahlreichen Mitwirkenden fügen sich nahtlos ins szenische und musikalische Konzept dieser Aufführung,ein, und diese überzeugt - wenn nicht in allen Belangen - vor allem durch das, was am schwierigsten zu erreichen ist: durch Noblesse.
|

8. 7. 2004
Milchschaum statt Schlagobers
Ein wunderbar entfetteter "Rosenkavalier" in Zürich hängt die Latte für Salzburg ziemlich hoch
von Manuel Brug
Manchmal gibt es seltsame Kopf-an-Kopf-Rennen in der Opernwelt. Zehn Tage nach dem irgendwie wohl stattfindenden Schlingensief-"Parsifal" in Bayreuth kontert Baden-Baden mit einer extrem kulinarisch besetzten Wagner-Variante. Und nur ein paar Wochen vor dem neuen Salzburger "Rosenkavalier" schultert Zürich die nicht gerade leichte Strauss-Sacharinbombe als Saison-Rausschmeißer.
Von wegen schwer: Selten gelang diese "Komödie für Musik" so kammermusikalisch konversationshaft, so wortverständlich. So fein aufgefächert in filigranem Weiß, ohne Spuren von Rosarot. Das Zürcher Opernorchester brillierte unter seinem alten Chef, dem eher walzersezierenden statt -seligen Franz Welser-Möst. Der doch ausgerechnet in Salzburg jenen als - zudem österreichischer - Ruzicka-Nachfolger gilt, die selige Karajan-Zeiten wiederhaben wollen. Welser-Mösts modern unsentimentaler, geschwinder, dabei durchaus weichzeichnender Richard-Strauss-Zugriff macht deutlich, dass er nicht nur in dieser Hinsicht andere Dirigenten-Wege geht. Zudem ist er als Orchesterchef in Cleveland und mit Wiener Verpflichtungen bis 2012 ziemlich verplant. Aber vielleicht langt es wenigstens endlich zu einem Dreivierteltakt-delikaten Neujahrskonzert...
Milchschaum statt Schlagobers auch auf der Bühne, wo Sven-Eric Bechtolf einmal mehr seine Regiebefähigung für die sensualistisch-sexualpathologische Oper des frühen 20. Jahrhunderts unter Beweis stellte. Wobei er bei dem so schwer an seiner perückenpuderigen Rezeptionsgeschichte tragenden Stück, das seit einigen Jahren auch in Regietheater-Hände geraten ist, einen Mittelweg findet: er lässt der "wienerischen Maskerad"" Geschmack und Wehmut, überdreht aber die gefälscht theresianischen Walzer und Hofmannsthals weltweise, sentimental-brutale Kunstsprache; legt dezent auf die freudianische Couch, was laut Librettist sowieso "ein halb imaginäres, halb reales Ganzes" ist.
Die domestizierte Natur-Anschauung des Rokoko spiegelt sich in den Porzellanpapageien im Marschallinnen-Schlafzimmer wieder. Draußen, vor Rolf Glittenbergs Halbrund in Taubengraugrün, herrscht Winter; auch drinnen stehen kahle Bäume. Tote Vögel, diesmal Fasane, hängen in der Souterrain-Küche des mit Armeelieferungen reich gewordenen, jetzt seine Tochter an den klammen, aber reputierlichen Ochs von Lerchenau verschachernden Herrn von Faninal (Rolf Haunstein), wo eine Köcheschar stets denselben blauen Strudelteig durch den Wolf dreht. Hier ereignet sich die Rosenüberreichung Octavians als mindestens ebenso unpassendes Ritual, vor dem sich die naseweise, aber nicht naive Sophie der silberzarten Malin Hartelius im Schrank versteckt. Wie vorher der italienische Sänger (laut: Boiko Zwetanov) einen Auftritt als Schachautomat hatte, so deliriert sich jetzt ein lemurenhafter Greis in den Walzerexitus.
Verkleidung als Memento Mori. Marianne Glittenberg gleitet dabei virtuos durch die Jahrhunderte. Bei der Marschallin frönt man der Exotismus-Mode, der dritte Beisl-Akt, wo der Ochs dem als falsche Zofe Mariandl verkleideten Octavian nachstellt, spielt konsequenterweise wieder im mit einem Zelt verfremdeten Werdenbergschen Boudoir. Skelette laden zum Totentanz, der gleichzeitig ein Sommernachtstraum mit allegorischem Getier ist. Um schließlich zur intimen Marivaudage zu werden, wo für das Protagonistenquartett die Maske fällt: alle sind sie Betrogene, besonders die Marschallin.
Ein Besetzungsglücksfall hilft Bechtolf bei diesem so melancholietrüb eindeutigen Befund: dank ihrer vokal dramatischeren Vergangenheit laden Nina Stemme und die als Octavian debütierende Vesselina Kasarova schon den ersten Akt mit ungekanntem Verlust und Abschied auf, der im dritten ein endgültiger wird. Die Kasarova ist schmerzlich und komödiantisch mit einem Hauch Bitterschokolade im samtigen Mezzo, nur ihr Deutsch klingt noch ein wenig zu sehr nach Bukovina statt nach der Hofburg.
Die Stemme steigert sich unaufdringlich zur Tragödin des leuchtenden Entsagungstons, bis sie ihren Liebhaber der jüngeren Sophie übereignet. Am Schluss bleibt ihr nur der Mohrenknabe, so wie dem diszipliniert komödiantischen Ochs des klug artikulierenden Alfred Muff sein Leiblakai Leopold. Aufgepasst, Salzburg: damit hängt die "Rosenkavalier"-Latte augenblicklich ziemlich weit oben.
|

14. 07. 2004
Rosen in der glänzenden Küche
VON WALTER DOBNER
Franz Welser-Möst und Sven-Eric Bechtolf nehmen Strauss und Hofmannsthal beim Wort. Ergebnis: Ein "Rosenkavalier" als durchdachte "Komödie für Musik".
Als Beitrag zu den Zürcher Festwo chen hat man sich an der dortigen Oper für eine Neuinszenierung des "Rosenkavalier" entschieden. Mit einem Leading-Team, das schon zuvor mit Erfolg zusammen gearbeitet hat: dem früheren Musikdirektor Franz Welser-Möst und Sven-Eric Bechtolf. Nicht Aktualisierung wird angestrebt, sondern genaue Realisierung des Sujets, was Originalität und Aufreißen neuer Perspektiven nicht ausschließt - wie diese Produktion beweist.
Schon die Einstiegsszenerie frappiert: kein prunkvolles Zimmer mit Bett. Statt dessen führt das stilvolle Bühnenbild (Rolf Glittenberg) in eine Orangerie. Einige Bäume ragen hoch empor, an der rechten Szene finden sich Vögel, davor eine einfache Matratze. Bald bevölkern exotisch gekleidete Diener das Bild. Der Auftritt des in einer Schachtel vorgeführten Sängers - schließlich handelt es sich um ein Präsent - erinnert an den aus Maria Theresias Zeit stammenden "Schachtürken" von Kempelen.
Betont automatisiert und bewusst nicht auf Schönklang konzentriert absolviert Boiko Zvetanov seinen Part. Weil Baron Ochs wenigstens nicht ausschließt, dass Leopold Produkt eines Seitensprungs sein könnte, erscheinen beide im gleichen Kostüm (Marianne Glittenberg).
Dem von dezentem Weiß und einer hoch aufragenden Fensterfront dominierten Orangerie-Bild begegnet man auch im Schlussakt. Bechtolf spannt damit den Bogen zum Beginn, kann auf das übliche, die Atmosphäre nicht selten störende Gasthof-Ambiente verzichten. So macht er auch den Intermezzo-Charakter des mittleren Aktes deutlich. Hier beweist Glittenberg die größte Originalität: Er lässt ihn in der blank geputzten Küche des reichen Faninal spielen. Damit kommt das Komödiantische der Auftritte besonders zum Tragen. Die zuweilen zum sterilen Zeremoniell erstarrte Rosenüberreichung erhält eine persönliche Note, auch Baron Ochs kann seine ungeschlachte Art ungekünstelter als sonst ausleben.
Nicht nur subtile Zeichnung der Orte und detailreiche Führung der Personen, die im Schlussterzett ihren emotionalen Höhepunkt findet, kennzeichnen diesen im Herbst wieder zu sehenden "Rosenkavalier", sondern vor allem eine hervorragende Umsetzung. So kammermusikalisch und doch schwungvoll, transparent und doch mit gewaltigen Aufschwüngen wurde die Oper lange nicht mehr gespielt. Franz Welser-Möst ist zudem den Sängern ein idealer Partner und versteht sich bestens auf den wienerischen Strauss-Stil.
Ninna Stemmes Marschallin vereint Jugendlichkeit mit Zügen früher wehmütiger Altersweisheit. Vesselina Kasarovas Oktavian versucht zwischen burschikosen Zügen und zögerlicher Verliebtheit zu vermitteln. Alfred Muff ist ein saftig-temperamentvoller Ochs. Rudolf Schasching als Valzacchi und Brigitte Pinter als Annina verstehen sich köstlich auf die Intrige. Überstrahlt werden sie alle von der stimmlich perfekten Malin Hartelius, einer idealen Sophie, die Freude wie Schmerz unmittelbar miterleben lässt.
Ob Salzburg hier mithalten wird können? In wenigen Wochen wird man es wissen.
|
Ins Lächeln verliebt
"Der Rosenkavalier" in Zürich, inszeniert von Sven-Eric Bechtolf

15. 07. 2004
Im Programmbuch zum Zürcher "Rosenkavalier" findet sich eine höchst interessante Analyse der Musikwissenschaftlerin Ruth E. Müller, welche die von Hofmannsthal ausgeheckte Figurenkonstellation untersucht. Nach der Lektüre ahnt man, dass der Dichter statt eines personellen Großaufgebots eigentlich nur eine einzige Figur für sein Libretto entworfen hat, zumindest was die Namensgebung betrifft.
Nicht nur, dass Octavian und Ochs die gleichen Anfangsbuchstaben haben, als Mariandel trägt Octavian denselben Namen wie Sophies Zofe Marianne, in dem wiederum Maria und Anna stecken und somit die Marschallin selbst, aber auch die Intrigantin Annina. Und die Vokale des Namens Maria erscheinen auch bei Octavian. Alles also, schließt die Autorin, scheint aus einem Kern heraus gebildet und variiert.
Behält man diesen Gedanken auch in Zürich im Blick, so entdeckt man weitere aufschlussreiche Verknüpfungen. Dass die Anfangsbuchstaben, diesmal des Nachnamens, der Marschallin Fürstin Werdenberg mit der des Dirigenten Franz Welser-Möst übereinstimmen, mag dabei noch dem Zufall geschuldet sein. Doch hatte der Dirigent in Zürich nicht schon mit Richard Strauss" "Rosenkavalier" debütiert? Darüber hinaus stammt er aus Linz und damit aus Österreich, wie das gesamte Personal des "Rosenkavaliers".
Und liegt in Österreich nicht auch jenes Salzburg der Festspiele, für deren Leitung sich Welser-Möst bereits durch einen Vorschlag zur Verknappung empfohlen hat? Jene Festspiele übrigens, die einst - und damit schließt sich der Kreis - von Strauss und Hofmannsthal mitbegründet worden sind. Ob sich damit in Salzburg ebenfalls alles aus einem Kern heraus bildet und variiert, wird sich zeigen. Was die einstweilen beurteilbaren Fakten betrifft, lässt sich immerhin festhalten, dass Welser-Möst den Zürcher ¸¸Rosenkavalier" ebenfalls aus einem Salzburger Geist entwickelt hat, nämlich dem Mozarts - keineswegs zum Nachteil der Musik.
Hübsche Pointen
Richard Strauss selbst hatte ja den Mozart"schen Geist beschworen, der ihm bereits bei der Lektüre von Hofmannsthals Text in die Nase gestiegen war. Franz Welser-Möst hat nun daran erinnert - ebenso wie an Strauss" Wort, er sei sich trotz all des Mozarts dennoch treu geblieben. Die Tempi sind frisch, die Dynamik ist kontrastreich gestaltet. In der intimen Szene, in der die Marschallin über das Altern nachgrübelt, hat er das Kammermusikalische so konsequent herausgearbeitet, dass sie tatsächlich nach Mozart gleichsam zu duften beginnt.
Allerdings birgt die Frischzellenkur auch einige Gefahren in sich, denen das Orchester der Oper Zürich nicht immer entkommt. Schon der eröffnende Aufschwung der Hörner ist so zügig genommen, dass selbst der stürmische Liebhaber ins Straucheln gerät. Und auch in den kammermusikalisch zurückgenommenen Passagen ist leider zu oft zu hören, dass im Orchester nicht alles rund läuft.
Die Regiearbeit von Sven-Eric Bechtolf zeichnet sich vor allem durch Detailgenauigkeit aus. Den Text ernst zu nehmen - sowohl Hofmannsthals als auch den von Richard Strauss - und mit dem Bühnengeschehen in schlüssige Übereinstimmung zu bringen, war offenbar sein erstes Anliegen. Immer wieder entdeckt er dabei wirklich hübsche Pointen. Und man spürt, dass Regisseur, Dirigent und die Ausstatter Rolf und Marianne Glittenberg dafür eng zusammengearbeitet haben.
Kein spektakulärer ¸¸Rosenkavalier" ist daraus geworden, keiner, der die Liebhaber vor den Kopf stößt, aber auch keiner, der sich der eingefahrenen Aufführungstradition sklavisch unterwerfen würde. Bühne und Kostüme nehmen zwar Rokoko-Elemente auf, aber eher als Versatzstücke, die im Sinne der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen mit detailverliebt Pittoreskem ebenso wie mit einer heute bevorzugten hellen und kühl temperierten Ästhetik kombiniert werden.
Auf psychologische Schlüssigkeit hin sind auch die Figuren angelegt. Nina Stemme bietet eine großherzig menschliche Marschallin, die ihr Profil besonders aus den nachdenklichen Passagen bezieht. Vesselina Kasarova als Octavian wusste ihr maskulines Timbre in der Tiefe gewinnbringend auszuspielen und fand sicht- und hörbaren Gefallen an der Rolle als ungebildete Kammerzofe. Und doch meinte man den Erwartungsdruck zu spüren, der auf ihrem Rollendebüt lag und ihm ein wenig an Natürlichkeit nahm. Malin Hartelius als Sophie muss - auch stimmlich - nicht das naive Dummchen spielen, sondern darf aus ihrer anfänglichen Unbefangenheit heraus reifen.
Alfred Muff mit einer enormen, dynamisch aber etwas undifferenzierten Basspräsenz überzeugt als Baron Ochs insbesondere dadurch, dass er ihn statt überzogen derb lieber in einer Selbstgefälligkeit zeigt, die ihre Tücke gerade darin offenbart, dass sie sich in einem gesellschaftlich akzeptierten Rahmen bewegt. In einem Brief an Richard Strauss hatte Hugo von Hofmannsthal umrissen, wie er sich das Komödiantische im "Rosenkavalier" dachte, nämlich weniger im Sinne des drastischen Operettengenres als im Hinblick auf die "Meistersinger" oder den "Figaro".
Dort nämlich gebe es nicht unbedingt etwas zu Lachen, aber viel zum Lächeln. Genau das ist in Zürich gelungen.
ELISABETH SCHWIND
|