|
Aufführung
|

13. 12. 2003
(Première)
*
Musikalische Leitung: Christoph von Dohnányi
Inszenierung: Martin Kusej
Bühnenbild: Rolf Glittenberg
Kostüme: Heidi Hackl
Lichtgestaltung: Jürgen Hoffmann
Chöre: Ernst Raffelsberger
*
Elektra: Janice Baird
Klytämnestra: Marjana Lipovsek
Chrysothemis: Melanie Diener
1. Magd: Julia Oesch
2. Magd: Katharina Peetz
3. Magd: Irène Friedli
4. Magd: Liuba Chuchrova
5. Magd: Sen Guo
Die Aufseherin: Margaret Chalker
Orest: Jukka Rasilainen
Aegisth: Rudolf Schasching
Der Pfleger des Orest: Guido Götzen
Ein junger Diener: Andreas Winkler
*
Orchester der Oper Zürich
Chor des Opernhauses Zürich
Statistenverein am Opernhaus Zürich
SYNOPSIS - HIGHLIGHTS - LIBRETTO
|
|
Rezensionen
|
|
|
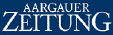
15. 12. 2003
Die wahre Nacht der langen Messer
Packend: Martin Kusej inszeniert am Opernhaus Zürich «Elektra» von Richard Strauss
Endlich die erste hausgemachte Zürcher Regie des «Provokateurs» Martin Kusej: Er zwingt dem Stoff nichts auf, macht doch faszinierend schaudern und lässt die Musik blühend dem Tod, einem Ende - dem Glück - entgegenrasen.
Christian Berzins
Wer glücklich ist wie wir, dem ziemt nur eins, schweigen und tanzen» - Elektras letzte Worte, wie würden wir sie gerne umsetzen, hätten wir die Mittel des Tanzes erlernt, wäre es nicht unser Beruf, nicht zu schweigen. Mit stillen Worten soll unser lautes Opernglück nun erklärt werden.
Der Wirkung von Richard Strauss´ 1909 uraufgeführter Tragödie «Elektra» waren wir uns bewusst: In Zürich hatte 1991 Ruth Berghaus´ klinisch scharfe Regie fasziniert, später, bei Giuseppe Sinopoli in Mailand, lernten wir die Musik lieben. In der neuen Zürcher Produktion verbinden sich nun Regie und Dirigat perfekt: Christoph von Dohnányis kompromissloser musikalischer Sturm und Martin Kusejs Bilderrausch.
Das Bild des blutüberströmten John Travolta aus dem Kultfilm «Pulp Fiction» auf dem Programmheft gibt ein Signal: So wird es nicht. Denn Martin Kusej will nicht mit Blut nach Effekt haschen - ein kleines Zitat genügt ihm. Seine Regie ist weit davon entfernt, billig zu schockieren oder zu provozieren. Dem Stoff von Hugo von Hofmannsthal wird nichts hinzufügt, Richard Strauss ohne Widerrede gefolgt: Kusej setzt Wort und Musik in stimmungsvolle Bilder um. Im Hintergrund geht zwar noch eine Geschichte ab, da die Titelheldin musikalisch aber so unwahrscheinlich stark gezeichnet ist (und das umsetzen kann), nimmt man diese «Handlung» nur mehr als eine Zuspitzung der aufgeladenen Stimmung wahr.
Peitschen im Rollkoffer
Da kommen denn also adrette Damen (beziehungsweise die fünf Mägde) im Deuxpièce und Rollkoffern angereist, packen Peitschen wie Handschellen aus, ziehen sich Strapse unter die kurzen Röcke an und hüllen sich in eine plump aufreizende Kellnerinnen-kluft - auch Männer mischen sich, im selben Outfit, unter sie. In den Zimmern rund um die hügelige, mit Erde belegte Spielfläche - eine Art Kellergewölbe - verschwinden sie (Bühne Rolf Glittenberg): mal nackt, mal geordnet, mal in Panik irren sie bald über die Bühne. Irrenanstalt, Hotel oder Swingerclub? In diesem Ort der Angst, der sexuellen Perversion haben sich jedenfalls Elektras Mutter Klytämnestra und ihr Liebhaber Aegisth (der Mörder von Elektras Vater) eingenistet. An ihnen will/muss sich Elektra rächen. Und ob ihr in der Nacht der langen Messer Orest helfen wird, der genauso als Traumgestalt auf der Bühne erscheint wie kurz zuvor ein unschuldiges Elektra-Mädchen, oder ob sie doch allein zur Bluttat schreitet, will Kusej nicht ganz ausdeuten. Zum Schluss wird offen bleiben, ob Elektra stirbt - sie hat ihre Aufgabe, ihren Traum, zwar erfüllt, aber die Welt bleibt dieselbe. Eine Transvestiten-Showgruppe zieht vor-über - Elektra taumelt im Nebel davon.
Packende Bilder also als Grundlage für eine musikalische Wundernacht: nachdem die erste Elektra-Darstellerin nach der Hauptprobe krankheitshalber absagen musste, der Ersatz angeblich nichts taugte, sprang kurzfristig Janice Baird ein.
Gewiss: Kusejs Inszenierung geht nicht von den Details in der Personenführung aus - Elektra ist also mehr ein statischer Zustand als eine Person, die sich durch Handlungen erklärt. Aber trotzdem sind die Personen genau geführt. Baird setzt vieles um, aber vor allem singt sie famos. Hinter ihren anfänglich dunklen Klängen ist so viel Trauer, dass sie von Beginn weg fasziniert. Bald gehen die Schleusen auf: jugendliche Zärtlichkeit und ein phänomenaler dramatischer, scharfer, aber voller Sopran schwebt über das Orchester hinweg. Melanie Diener als weiss gekleidete, unschuldige Schwester Chrysothemis ist optisch wie stimmlich Gegenpol zu Elektra, aber auch sie kann sich gegen Orchesterwogen behaupten. Marjana Lipovsek legt die Klytämnestra expressiv aus: vehement, grell und auch klagend. Das Wort kommt hier vor der gesungenen Linie, verfehlt die Wirkung aber nie: durch und durch eine nervige, abgeliebte Schlampe. Jukka Rasilainen (Orest) und Rudolf Schasching (Aegisth) singen die beiden Männerrollen solid.
An der Grenze zur Überforderung
Rauschhaft durchlebt das von Christoph von Dohnányi an (und über) die Grenze zur Überforderung getriebene Orchester den Abend: Jeder Takt wird hier zum Drama. Manchmal geht der Sog, die Kraftentfaltung bis zum schmerzvollen Dröhnen. Dann wieder-um ist es hinreissend, wie Dohnányi die Orchesterpalette so zum Leuchten bringt und wie sinnlich der Klang werden kann. - Auch hier also: Bilder anstelle der analytischen Konstruktion - ein Weg zu einem Glückszustand.
|
15. 12. 2003
Krankheit und Kühnheit: «Elektra» am Zürcher Opernhaus
Die Antike als Zeitalter der Bluträusche: Es sind nicht erst die neuesten Erkenntnisse über das ausgeklügelte Bühnenliftsystem im Kolosseum, über die dort fleissig geübte Systematik des Massakrierens, die diese Vorstellung nähren. Die cinematografische Darstellung römischen und hellenischen Meuchelns und Mordens wirkt sich aufs Filmgeschäft meistens konjunkturfördernd aus. Warum sollte das in der Oper gross anders sein?
Wenn sich Hugo von Hoffmannsthal und Richard Strauss mit dem Grauen des Altertums in ihrer Kunst ausführlich auseinandersetzten, taten sie dies nicht zuletzt aus wacher Zeitgenossenschaft. In Erforschung der entsetzlichsten Abgründe der Mythologien unterminierten sie die humanistische Antike-Auffassung ihrer Zeit gehörig. Die Existenz der Elektra geht vollkommen auf in einem einzigen Wort: Blutrache. Die Ermordung ihres Vaters Agamemnon durch ihre Mutter Klytämnestra und deren Buhler Aegisth schreit danach.
Vor fast hundert Jahren bot Strauss dieser Stoff die schöne Gelegenheit, eines der grössten Operngemetzel der Musikgeschichte anzuzetteln. Zwar werden nur die Bösewichte Klytämnestra und Aegisth wirklich eindeutig getötet. Die Partitur aber ist ein gieriger, Opernseelen verschlingender Klangwolf. Nur in Kontakt mit Salome, jener anderen mythischen Blutfrau, ersann Strauss sonst derart kühne Musik. In «Elektra» glückte dem Wagnerianer nichts Geringeres, als die Leitmotivtechnik in einem monothematischen Stück ad absurdum zu führen: Leitmotive fungieren hier nicht als musikalische Visitenkarten, sondern sind emotionale Klangpartikel, die in «psychischer Polyphonie» (Strauss) durcheinander wirbeln.
Das musikalische Spektakel wäre also garantiert. Auf den Spielplänen ist «Elektra» deshalb ein Dauerbrenner. Ist es auch möglich, sie intelligent zu inszenieren? Nach dem Besuch der Zürcher Premiere lässt sich diese Frage eindeutig bejahen. Regisseur Martin Kusej und Bühnenbildner Rolf Glitternberg sinnen weder auf einfaches Rachespiel noch auf ein Lehrstück mit greifbarer Moral. Schon der Bühnenraum ist der Vieldeutigkeit preisgegeben: Der finstere, sich nach hinten verengende Raum ist Grab, Hotelflur und Irrenhaus zugleich. Hinter den Türen verbergen sich Seelenkammern. Diese Bühne ist nicht einfach Spielstätte, sondern auch Vorstellungsraum, worin sich Albträume materialisieren können, wenn er blitzartig von Statisten- und Chorscharen überschwemmt wird.
Mykene ist überall. «Elektra» ist nicht von gestern. Die Protagonistin geriert sich als eine Art Lara Croft, Aegisth ist ein fetter schmieriger Mafioso (Rudolf Schasching), die Mägde sind halb Zimmermädchen, halb Dominas. Gerne entblösst man sich züchtig. Wenn Elektra liebt, dann ist das nicht ganz ohne: Ihre Duette mit Klytämnestra, Chrysothemis (Melanie Diener) und Orest (Jukka Rasilainen) werden als Liebesspiele gezeigt, deren inzestuöse Erotik sich stets vollkommen aus dem mörderischen Ansinnen speist. Selbstverständlich interpretiert Kusej die Möglichkeit einer Katharsis auf ganz eigene Weise. - Das Zürcher Premierenpublikum hätte offenbar lieber antike Tempelchen, Ziehbrunnen und Olivenhaine gesehen und quittierte diese ausserordentliche Regieleistung entsprechend. Es ist ein ziemliches Wunder, dass die Premiere überhaupt stattfinden konnte: Eva Johansson, die eigentliche Elektra, wurde sehr plötzlich krank. Sehr spontan sprang die junge amerikanische hochdramatische Sopranistin Janice Baird für sie ein, sang und spielte weit mehr als bloss behelfsmässig. Was sie unter den gegebenen prekären Umständen zu leisten vermochte, ist absolut sensationell. Frau Johansson wird es nach ihrer Genesung nicht leicht haben. Aus dem gesunden regulären Ensemble ragte Marjana Lipovsek als eine alle Deklamationsweisen des Irrsinns perfekt beherrschende Klytämnestra deutlich heraus. Trefflich verband sich dies mit einem unter Christoph von Dohnányi ausgesprochen klangintensiv musizierenden Zürcher Opernorchester.
Michael Kunkel
|
15. 12. 2003
Wahnsinn ohne Ende
Von Roger Cahn
Nach der Generalprobe meldet sich Eva Johannsson als Elektra krank. Janice Baird, eine junge Amerikanerin, springt ein, ohne Proben. Einfach wahnsinnig. Das Premierenpublikum dankte mit Begeisterung.
Mit ihrer Oper schaffen Hugo von Hofmannsthal und Richard Strauss das Bühnenmonster Elektra, eine junge, nach Rache dürstende Frau. Ihre Mutter erkennt die Gefahr und sperrt sie ein. Jetzt hat Elektra nur noch ein Ziel vor Augen: ihre Mutter zu töten, um den Mord am Vater zu sühnen. Als Instrument für die Bluttat setzt sie auf Bruder Orest. Der taucht, obwohl als tot gemeldet, auf. Am Ende herrscht das nackte Grauen.
Die Leistung der einspringenden Sopranistin Janice Baird als Elektra ist nicht hoch genug zu bewerten. Ihre Elektra ist eine provozierende und pubertierende Göre, bereit, das Spiel zum Äussersten zu treiben, Opfer und Täterin in einer Person. Gegenspielerin ist ihre Mutter Klytämnestra - Mariana Lipovseks Interpretation der Täterin, die in ständiger Angst lebt, selbst zum Opfer zu werden, ist der künstlerische Höhepunkt des Abends.
Regisseur Martin Kusej konzentriert sich auf die Innenwelt der Figuren und zeigt eine Mischung aus Tollhaus und Gefangenenlager. Eine Flut von Bildern und gespenstischen Visionen, unterbrochen von Momenten absoluter Leere prasseln zwei Stunden pausenlos aufs Publikum nieder. Die Personenführung kann durch die kurzfristige Umbesetzung nicht schlüssig beurteilt werden.
Wahnsinnig ist auch die Musik: Vom ersten Ton an herrschen Spannung und Entsetzen. Dirigent Christoph von Dohnányi setzt die Akzente, Orchester und Sänger geben alles.
Fazit: So wahnsinnig faszinierend kann Oper sein.
|
15. 12. 2003
Ausweglose Aussenseiterin
14 Minuten Applaus: Die «Elektra» am Zürcher Opernhaus verstört und begeistert
Dank Christoph von Dohnanyi, Martin Kusej und einer starken Besetzung ist Strauss «Elektra» am Opernhaus Zürich ein Ereignis.
TOBIAS GEROSA
Regisseur Martin Kusej, einer der spannendsten Opern- und Schauspielregisseure unserer Zeit, inszeniert Richard Strauss frühen Schocker «Elektra» als Blick in menschliche Abgründe ohne Ausweg, bildermächtig und schlüssig. Im Graben sorgt Christoph von Dohnanyi mit dem glänzenden Zürcher Opernorchester auch für eine musikalische Umsetzung von Weltklasse.
14 Minuten applaudierte das Premierenpublikum am Samstag der Neuproduktion von Richard Strauss «Elektra» eine mittlere Sensation nach einer gleichermassen begeisternden wie verstörenden Aufführung. Begeisternd, weil am Opernhaus eine Vorstellung zu erleben ist, in der alles zusammenkommt und zusammenstimmt. Verstörend, weil sie Hugo von Hofmannsthals Libretto in seiner ganzen Monstrosität aufnimmt und durch die von Strauss aus dem ursprünglichen Einakter eliminierte Sexualität ergänzt ins Jetzt holt. Dem bloss kulinarischen und wohligen Schauer an der blutigen Geschichte verweigere er sich, schreibt Regisseur Kusej in seinem im Programmheft abgedruckten Regiekonzept. Für nicht ganz zwei Stunden öffnet er den Deckel der Kiste, in welchem das Ungeheuer Mensch versteckt und verwahrt ist. Zum Vorschein kommen lauter elementare Tabuverletzungen: Ehebruch, Mord, Inzest.
Gegenstück zu Don Giovanni
Elektra in ihrem Lara-Croft-Outfit mit Kapuzenpulli und Turnschuhen ist eine Aussenseiterin in existenziellem Sinne. In einer sexualisierten Umgebung verkörpert sie in ihrer alles bestimmenden Racheobsession die erschreckende Alternative. Sie wird so zu einem weiblichen Gegenstück zu Don Giovanni, wie ihn Kusej 2002 in Salzburg inszeniert hatte. Am Anfang verwandeln sich die Mägde von Elektras Mutter Klytämnestra bei Arbeitsantritt von modernen jungen Mädchen in peitschenbewehrte Dominas (Kostüme: Heidi Hackl). Dass die jüngste Magd Elektra verteidigt, bezahlt sie mit ihrem Leben. Klytämnestras neuer Mann Ägisth (Rudolf Schasching), im seidenen Morgenmantel, klunkerbehängt und mit Sonnenbrille, ist ein Ekel erster Güte, der sich seine jungen Gespielinnen mit vorgehaltener Pistole verschafft. Doch unter all den gesichtslosen Menschen (ein Bewegungschor, dessen häufige Auf- und Abtritte manchmal etwas aufgesetzt wirken) ketten fatale Umstände und Familienbande die Atriden untrennbar aneinander. Kusej inszeniert lauter Liebesbeziehungen und verweigert Elektra am Schluss auch die Erlösung: Nicht einmal dieser Ausweg bleibt. In der von Marjana Lipovsek grandios gestalteten Szene Klytämnestras hält sie sie im Arm, schmiegt sich an sie lieber als sie umbringen würde sie sich wohl mit ihr versöhnen. Auf Orest (stimmlich wie darstellerisch blass: Jukka Rasilainen) wartet sie wie auf einen Traumliebhaber. Als er endlich auftaucht, muss die aufgebaute Erwartung scheitern. Auch mit Chrysothemis, der strahlend weissen, sich nur nach erfüllter Liebe sehnenden Schwester, verbindet sie tiefe Liebe. Umso massloser die Enttäuschung, als sich diese nicht am Rachemord beteiligen will. Melanie Diener findet bei ihrem Rollendebüt eine hervorragende Balance von zarter Lyrik und Verzweiflung und singt bestechend schön.
Wenige Stunden Vorbereitung
Fast wäre die Premiere noch geplatzt. Eva Johansson, welche die Titelpartie geprobt hatte, erkrankte, und erst am Samstagmorgen konnte Janice Baird als Einspringerin organisiert werden. Baird, die äusserlich so gar nicht dem Bild eines hochdramatischen Soprans entspricht, sang nicht nur eine sensationelle Elektra, sondern fand mit wenigen Stunden Vorbereitung auch ins vielschichtige Regiekonzept. Ein Glücksgriff. Fünfundzwanzig Jahre hatte Christoph von Dohnanyi «Elektra» nicht mehr dirigiert (und auch noch keine auf Tonträger eingespielt). Wie überlegen durchgestaltet er die Partitur mit dem wiederum hervorragenden Opernhausorchester erbeben und erblühen lässt, ist ein Ereignis für sich. Schneidend das Blech mit dem Agamemnon-Motiv, wahrhaft ohrenbetäubend dröhnt der Fortissimo-Schluss. Doch auch diese Entladung ist in den Gesamtaufbau mit erstaunlich vielen lyrischen Stellen einbezogen. Darin, wie klar überlegt von Dohnanyi die bisweilen fast gewalttätige und rauschhafte Musik spielt, trifft er sich mit Kusejs szenischer Interpretation und dieses Zusammentreffen ist es wohl, welches aus diesem überaus gelungenen einen grossen Opernabend macht. Intendant Alexander Pereira hatte in letzter Zeit einen guten Draht zur Musikindustrie, hoffentlich sassen die DVD-Produzenten am Samstag auch im Opernhaus. Mindestens bis dann gilt: Die Anreise nach Zürich für eine der verbleibenden sechs Aufführungen lohnt sich.
|

15. 12. 2003
Von der blutigen Tat zum Samba-Fest
Nicht nur der Kalauer lässt zu «Elektra» Hochspannung assoziieren. In Zürich sorgen dafür weniger Martin Kusejs Inszenierung als das von Christoph von Dohnanyi geleitete Orchester und Sängerensemble.
Herbert Büttiker
Rache ist süss. Wie süss, macht Strauss deutlich, der dieses Gefühl im Klangrausch und im aufpeitschenden Rhythmus seiner Musik in die Extreme treibt. In der Ekstase der tanzenden Elektra wird es ausgekostet – und zur verstörenden oder auch fragwürdigen Lusterfahrung eines zivilisierten Publikums. Wie vollständig der Tabubruch dieser Enthemmung ist, zeigt die Tatsache, dass im Taumel für den Wahnsinn des Orest, der eben seine Mutter erschlagen hat, musikalisch kein Platz ist: Zu Schweigen und Tanzen ruft Elektra auf.
In der neuen Zürcher Inszenierung ist in diesem Tanzfinale Samba angesagt (engagiert wurde die Baila Brasil Show), Orest erscheint in gekrümmter Haltung und mit entgeistertem Blick, und auch Elektra erstarrt zu trotziger Haltung, die an ihren Auftritt in der ersten Szene erinnert. Damit ist einiges zurückgenommen: was Orest betrifft, die Herrlichkeit der Tat; was Elektra betrifft, der Gipfel der befreiten Lebenslust im «verzückten» Tod; und was das Ganze betrifft, mit dem Tanz als blosser Showeinlage die Devise, die Elektras Schwester Chrysosthemis ausgibt: «Es fängt ein Leben für dich und mich und alle Menschen» an. Die Zurücknahme bedeutet freilich auch Unschärfe. Der Fatalität dieses Versprechens wäre in der Epoche der Uraufführung (1909), wenige Jahre vor dem Ausbruch des Weltkriegs, historisch genau zu verorten und in der Euphorie, die politische Umstürze begleitet (oder ermöglicht), auch aktuell zu begreifen – vielleicht direkter zu begreifen, wenn der Schauplatz – zeitgenössisch oder mykenisch oder beides – nicht nur expressiv, sondern auch realistisch, nicht nur psychologisch, sondern auch politisch wäre.
Das ist hier weniger eine Frage des Bühnenbildes – Rolf Glittenbergs weit in die Tiefe führender Korridor mit den seitlichen Türen , halb Innen-, halb Aussenraum, ist architektonisch klar und von suggestiver Wirkung – als der Erzählung. Martin Kusejs Regie gestaltet sie im zentralen Figuren-Fünfeck greifbarer als im weiteren, eben politischen Umfeld desGeschehens. Was die Statisterie in verschiedenen traumartig verrätselten Auftritten pantomimisch aufführt, in einer Choreografie sexueller Obsessionen und neurotischer Zwänge, in die auch die Nebenpartien der Mägde und Diener einbezogen sind, wirkt bei aller Entblössung allzu diffus und wohl auch allzu ästhetisierend, als dass es auch unter die Haut ginge.
Ein mutiger Blitzbesuch
Überträgt sich die Glätte auch auf die eigentlich doch alles Mass sprengenden Figuren im Zentrum des Stücks, Elektra und ihre Mutter, Klytämnestra? Die Antwort ist schwierig, denn zunächst sind ganz andere Faktoren zu berücksichtigen. Die Hauptdarstellerin Eva Johansson ist kurz vor der Aufführung erkrankt. Der Name einer Einspringerin konnte zwar im Programmheft noch gedruckt werden, aber am Premierentag reiste erst die Sängerin an, die dann am Abend tatsächlich auf der Bühne stand: die junge Amerikanerin Janice Baird, die seit einigen Jahren in grossen dramatischen Partien zwischen Isolde und Turandot Erfolg feiert und gegenwärtig gleich in allen drei Brünnhilde-Partien des «Rings» in Düsseldorf auf der Bühne steht: welch ein mutiger Blitzbesuch!
Um sich in die Inszenierung einzuarbeiten, blieb für Janice Baird natürlich kaum Zeit, aber Kusejs Konzept (das sportlich-trendige «Kostüm» mit dunkler Hose und farbiger Kapuzenjacke weist in diese Richtung) will wohl auch keine entfesselt agierende Elektra, sondern bloss eine junge Frau von heute. Von einer Erscheinung, die Orest von den furchtbaren Augen und den hohlen Wangen sprechen lässt, war die Einspringerin, als ob die Zeit für die Maske nicht gereicht hätte, aber doch zu weit entfernt, und die masslose Energie der Figur war eher die Sache einer im weiten Umfang wohl nicht grossen, aber ausdrucksstarken und stabilen Stimme als des Spiels. «Von der aller hochdramatischsten Sängerin» wollte Strauss die Elektra dargestellt haben. Diese ist Janice Baird gewiss (noch) nicht, aber abgesehen von der unglaublichen Leistung, die der Ad-hoc-Einsatz in dieser monströsen Partie an und für sich schon bedeutete, war ihre Elektra auch in den Momenten stimmlicher Parforce sehr präsent und zumal in den grossen Duett-Szenen musikalisch wie darstellerisch reich schattiert und eindringlich gezeichnet.
Ein starkes Ensemble
Die Aufladung der grossen Duett-Szenen durch profilierte Partner kam der Titelheldin entscheidend entgegen: Melanie Dieners im Stimmcharakter ihr ähnliche, im Lyrischen intensive Chrysosthemis, Eva Lipovseks deklamatorisch und darstellerisch wuchtige, musikalisch gefasste Klytämnestra, Jukka Rasilainens herb-dunkler Orest und Rudolf Schaschings pointierter Aegisth – ein starkes Ensemble, in dem Melanie Dieners überzeugendes Rollendebüt hervorzuheben ist und das mit der Nennung einer Vielzahl kleinerer Partien (Irene Friedlis 3. Magd und Andreas Winklers junger Diener seien erwähnt) zu ergänzen wäre.
Und schliesslich waren da als ihnen allen gemeinsamer Partner der Dirigent Christoph von Dohnanyi und das Orchester, dessen präzise Klarheit bei diesen Umständen für die Sänger besonders zählte. Vor allem aber bot sich in der überlegenen Dosierung, die von der Hochspannung des Sottovoce (die Mordszene) bis zur straffen Fortissimo-Entladung reichte, dem Hörer ein Bild der Partitur von packender Zwangsläufigkeit in jedem Moment. Die Schärfe der Dissonanzen liess ebenso aufhorchen wie die gleitende Weichheit der typischen Strauss-Kantilenen, die grossen Effekte des Blechs waren so dezidiert wie die vielen blitzenden Einsprengsel der Holzbläser.
Psychische Polyphonie
Wie Dohnanyi den Riesenapparat des «Elektra»-Orchesters sowohl zu seinem Recht kommen liess als auch mit Blick auf die Bühne zähmte, bewährte sich in grossartigen Momenten musikalischer Dramaturgie. So, um nur einen der Höhepunkte des Abends überhaupt zu erwähnen, in der Wiedererkennungsszene: die ruhig angelegte Steigerung auf den Moment, in dem Orest sich zu erkennen gibt, dann die sich mit dem Fortissimo-Einsatz ausbrechende Orchestergewalt, die als Höhepunkt dessen zu bezeichnen ist, was Strauss selber «psychische Polyphonie» nannte, schliesslich die weitatmige Moderato-Ruhe voller innerer Bewegung, in der sich Janice Bairds Sopran mit Wärme verströmt bis zum As des «Dann sterb' ich seliger als ich gelebt».
|

15. 12. 2003
Elektra verzweifelt im Tollhaus
Kein Blut und kein Dreck, aber menschliche Zärtlichkeit und nackte Haut. Die neue Zürcher «Elektra» versucht eine neue Sicht auf die alte Tragödie. Das Premierenpublikum war begeistert. Mit dem Österreicher Martin Kusej hat Opernhaus-Direktor Alexander Pereira einen der zurzeit meistgefragten Regisseure engagiert, der zudem als Provokateur bekannt ist. Aber der Skandal blieb aus. Nur wenige Buhs mischten sich in den lang anhaltenden Schlussapplaus.
Kusejs «Elektra» wirft mehr Fragen auf, als sie beantwortet. In einem meist dunklen, sich nach hinten verengenden Einheitsraum, der Gefängnis, Irrenhaus oder auch Bordell sein könnte, spielt sich das bei Kusej ganz unblutige Geschehen ab.
Überzeugende Janice Baird
Die glaubwürdigste und eindrücklichste Figur der Aufführung ist ausgerechnet Janice Baird in der Titelrolle, die am Premierentag für die erkrankte Eva Johansson eingesprungen ist. Die junge Sopranistin weiss sich intensiv und berührend in Szene zu setzen. Aber auch Melanie Diener als ihre Schwester Chrysothemis, Jukka Rasilainen als ihr Bruder Orest und Marjana Lipovsek als Mutter Klytämnestra bleiben ihren Partien nichts schuldig. Und sie werden von Kusej nicht wie so oft als hässliche Scheusale und blutige Racheengel gezeigt, sondern als lebensbejahende, wenn auch zweifelnde Menschen.
Entscheidenden Anteil am Gelingen der Aufführung hat der Dirigent Christoph von Dohnanyi. Äussert präzise und sehr ruhig führt er durch die stürmische Partitur, zeigt die Solos im riesigen Orchesterapparat deutlich an und ist zugleich in ständigem Kontakt mit der Bühne. Die neue Zürcher «Elektra» ist eine musikalische Höchstleistung mit einigen inszenatorischen Fragezeichen.
Beat Glur, sda
|

15. 12. 2003
Das Unfassbare fassbar machen
Richard Strauss' «Elektra» im Zürcher Opernhaus
Es hätte ein Debakel werden können: Nach der Hauptprobe zu Richard Strauss' «Elektra» erkrankte die Sängerin der Titelpartie, Ersatz traf erst am Tag der Premiere ein. Nur wenige Stunden blieben Janice Baird, um sich anzueignen, was während sechs Probewochen erarbeitet worden war: eine sehr besondere, heutige Sicht auf eine Opernfigur aus mythisch-archaischer Zeit. Die junge Amerikanerin hat es geschafft, sie ist zum Zentrum einer Aufführung geworden, die mit Jubel für sie und das ganze Ensemble, den Dirigenten und - wer hätte es nach Martin Kusejs heftig umstrittener «Salome» von 2001 gedacht? - auch für das Regieteam endete.
Ist Kusej konventioneller geworden oder das Zürcher Premierenpublikum fortschrittlicher? Hat vielleicht auch die Erinnerung an die letzte Zürcher «Elektra» (1990/91) mitgespielt, die epochale erste Berghaus-Inszenierung in diesem Haus? Im Vergleich mit jener ist Kusejs Lesart tatsächlich zugänglicher, denn sie teilt sich sehr direkt, mehr emotional als intellektuell mit und setzt auf genuin theatrale Mittel, wobei sie ihren Brennpunkt klar in der Titelfigur hat. Rolf Glittenbergs Bühne schafft für Kusejs Regiekonzept optimale Voraussetzungen: ein flurartiger, sich in die Tiefe perspektivisch verengender schwarzer Raum über gewelltem Boden, in der Decke drei Betonschächte, in den Seitenwänden lange Reihen gepolsterter Türen, durch die, wenn sie geöffnet werden, grelles weisses Licht einfällt - Gefängnis, Irrenanstalt, Bordell (mit Scharen von Nackten), ein Tunnel, durch den die Figuren wie von Windböen gepeitscht werden.
Einzig Elektra verharrt an ihrem Ort, wartend auf den Bruder Orest, der den Meuchelmord an ihrem Vater rächen soll. Bei Kusej ist sie kein dämonischer Racheengel, sondern ein Mädchen, wie man sie heute in der Randständigen-Szene sieht, in weiten Hosen und Kapuzenjäckchen wie geschlechtslos, abweisend, aufsässig, verstockt, eine Süchtige, die sich mit den Drogen Rache und Hass berauscht. Phänomenal, wie sich Janice Baird mit diesem Rollenbild identifiziert, und ein Glücksfall, dass sie ihm nicht nur äusserlich, sondern auch mit ihrem schlanken, dank exzellenter Fokussierung dennoch tragenden und expansionsfähigen Sopran entspricht. Das (Königs-)Kind, das Elektra einst war und das wie eine Traumgestalt auftritt, während sie nach dem Beil gräbt, lebt in dieser mädchenhaften Darstellerin fort.
Dafür muss man in Kauf nehmen, dass sich die drei Frauenstimmen im Timbre zu wenig unterscheiden. Hell und schlank sind auch der Sopran von Melanie Diener (Chrysothemis) und der Mezzosopran von Marjana Lipovsek (Klytämnestra), die beide zudem zu Verhärtung tendieren. Einen umso stärkeren Kontrast bildet Jukka Rasilainens Orest mit seinem warmen, sonoren Bariton, und das Ensemble der Diener und Mägde, angeführt von Margaret Chalker und mit Sen Guo als vokalem Glanzlicht, präsentiert sich erst recht vielstimmig und vielfarbig. - Nicht alles ist ausgereift in Kusejs Inszenierung. Die Gestik der Protagonisten wirkt oft beliebig bis theatralisch, das Wogen der Massen unstrukturiert, und die Textverständlichkeit ist minimal. Doch Letzterem wird abgeholfen. Endlich hat sich das Opernhaus dazu durchgerungen, eine Übertitelungsanlage einzusetzen, so dass Hugo von Hofmannsthals gewaltiger Text (fast) Wort für Wort mitgelesen werden kann.
Versöhnung, Befreiung gibt es nicht in diesem Kreislauf von Verbrechen und Sühne. Nachdem Orest die Mutter und Ägisth (Rudolf Schasching) erschlagen hat, stehen die Überlebenden wie erstarrte Irre unter den Türen, Orests Körper zuckt in Krämpfen, nach dem Tanz, der sich wie eine groteske Folie-Bergère-Einlage präsentiert - Heidi Hackl hat die Show-Kostüme und die mehrschichtigen Alltagskleider entworfen -, sinkt Elektra in sich zusammen, die Musik bricht ab, nach fast zwei Stunden Hochspannung tritt der Stillstand ein. Wie Christoph von Dohnányi diesen Zeitverlauf gestaltet, wie er mit dem hochkonzentriert spielenden Orchester die ursprüngliche, überwältigende Wirkung der bald hundert Jahre alten Partitur nacherlebbar macht, indem er den Klang bis zu metallischer Härte schärft, wie sich der betörende Wohllaut der lyrischen Ruhepunkte dabei steigert, wie die grossformale Architektur der dramatischen Spannungsbögen korrespondiert mit subtilen rhythmischen und dynamischen Akzentsetzungen, das alles bringt uns zum Bewusstsein, dass es jenseits aller inszenatorischen Diskurse Richard Strauss' grandiose Musik ist, die die Aufführung zum Ereignis macht.
Marianne Zelger-Vogt
top
|

15. 12. 2003
Ausweglose Aussenseiterin
Strauss’ «Elektra» am Opernhaus Zürich - Blick in den menschlichen Abgrund
Am Opernhaus Zürich begeistert Strauss’ «Elektra» dank Christoph von Dohnanyi, Martin Kusej und einer starken Besetzung: Musiktheater vom Feinsten!
Tobias Gerosa
Regisseur Martin Kusej, einer der spannendsten Opern- und Schauspielregisseure unserer Zeit, inszeniert Richard Strauss’ frühen Schocker «Elektra» als Blick in menschliche Abgründe ohne Ausweg, bildermächtig und schlüssig. Im Graben sorgt Christoph von Dohnanyi mit dem glänzenden Zürcher Opernorchester auch für eine musikalische Umsetzung von Weltklasse.
Das Ungeheuer Mensch
Am Opernhaus ist eine begeisternde Vorstellung zu erleben, weil alles zusammenkommt und zusammenstimmt. Zugleich ist sie verstörend, weil sie Hugo von Hofmannsthals Libretto in seiner ganzen Monstrosität aufnimmt und durch die von Strauss eliminierte Sexualität ergänzt ins Jetzt holt. Kusej öffnet für knapp zwei Stunden den Deckel einer Kiste, in welcher das Ungeheuer Mensch versteckt und verwahrt sitzt, und zum Vorschein kommen elementare Tabuverletzungen.
Lauter Liebesbeziehungen
Elektra in ihrem Lara Croft-Outfit, mit Kapuzenpulli und Turnschuhen ist eine existenzielle Aussenseiterin. In einer sexualisierten Umgebung verkörpert sie in ihrer alles bestimmenden Racheobsession die erschreckende Alternative. Unter all den gesichtslosen Menschen des Bewegungschores ketten Umstände und Familienbande die Atriden untrennbar aneinander.
Kusej inszeniert lauter Liebesbeziehungen und verweigert Elektra am Schluss auch den Ausweg der finalen Erlösung. In der von Marjana Lipovsek grandios gestalteten Szene Klytämnestras, hält sie sie im Arm, schmiegt sich an sie - lieber als sie umbringen, würde sie sich wohl mit ihr versöhnen. Auf Orest (stimmlich wie darstellerisch blass: Jukka Rasilainen) wartet sie wie auf einen Traumliebhaber. Als er endlich auftaucht, muss die aufgebaute Erwartung scheitern. Auch mit Chrysothemis, der strahlend weissen Schwester, verbindet sie tiefe Liebe. Umso massloser die Enttäuschung, als sich diese nicht am Rachemord beteiligen will. Melanie Diener findet bei ihrem Rollendebut eine hervorragende Balance von zarter Lyrik und Verzweiflung.
Fast wäre die Premiere noch geplatzt. Noch am Samstagmorgen musste eine neue Titelheldin gefunden werden. Janice Baird, die äusserlich so gar nicht dem Bild eines hochdramatischen Soprans entspricht, sang nicht nur eine sensationelle Elektra, sondern fand mit wenigen Stunden Vorbereitung auch ins vielschichtige Regiekonzept. Ein Glücksgriff.
Erbeben und Erblühen
Zum Szenischen kommt das Orchestrale: Wie überlegen durchgestaltet Christoph von Dohnanyi die Partitur mit dem wiederum hervorragenden Opernhausorchester erbeben und erblühen lässt, ist ein Erlebnis für sich. Schneidend bohrt sich das Blech mit dem Agamemnon-Motiv in die Ohren, wahrhaft erschlagend dröhnt der Fortissimo-Schluss. Doch auch diese Entladung ist in den Gesamtaufbau mit erstaunlich vielen lyrischen Stellen einbezogen.
Darin, wie klar überlegt von Dohnanyi dirigiert, trifft er sich mit Kusejs szenischer Interpretation - und dieses Zusammentreffen ist es wohl, das aus diesem überaus gelungenen einen grossen Opernabend macht. Die Anreise von St. Gallen nach Zürich lohnt sich.
|

16. 12. 2003
Strauss' atemberaubender Spannungs-Strudel
Martin Kusej gehört heute zu den gefragtesten Regisseuren, was in seiner Zürcher «Elektra» ansatzweise nachvollziehbar wurde
von reinmar wagner
Ich habe mir für einmal den Spass gemacht, nichts von dem zu lesen, was in den Programmheften und Opernhaus-Zeitungen über die Regie zu erfahren wäre, und gewagt, einfach hinzuschauen. Das Ergebnis ist ziemlich aufschlussreich: Zu verstehen war nicht gerade viel von dem, was uns diese Inszenierung von Martin Kusej allenfalls mitzuteilen gehabt hätte.
Die Frage nach dem Warum
Warum all diese Leute mal in Weiss, mal in Grau und mal in fast nichts über die Bühne hasten, war ebenso wenig nachzuvollziehen, wie das kleine Kind im weissen Kleidchen, das sich einmal in die Arme Elektras flüchtet. Warum Samba getanzt wurde war genauso kryptisch wie die Tatsache, dass Elektra am Ende mit dem Revolver auf Aegysth zielt, aber doch nicht abdrückt, und warum - ein recht grosser Eingriff in das Stück - warum am Ende Elektra auf dem Höhpunkt ihres Racherausches nicht stirbt wie das Sophokles, Hoffmannsthal und die Götter doch so vorgesehen haben.
Irrenhaus und Traumwelt
Zwischen Irrenhaus und Traumwelt schillert diese Inszenierung, und dass sie nicht so ganz nachvollziehbar war, heisst nicht, dass sie nicht spannend gewesen wäre. Schliesslich stellt das Rätsel, und die Ungewissheit und die Frage nach dem Sinn schon ein Element von Spannung dar, und wenn Kusej Elektras tanzenden Triumph in die märchenhafte Pracht einer veritablen Sambaschule einmünden lässt, dann spricht die pure Schönheit dieses Reigens für sich selbst. Auch sonst fand der österreichische Regisseur viele atmosphärisch dichte Bilder und nutzte den klaustrophobischen, lichtlosen Bühnenraum von Rolf Glittenberg zu kräftigen Szenerien. Und darüber hinaus: «Elektra» wäre auch auf einer rabenschwarzen Bühne, ohne Licht und Kostüme ein atemberaubender Spannungs-Strudel, und wenn dann ein Dirigent wie Christoph von Dohnányi den Taktstock führt, dann wird die vielleicht aufgewühlteste Partitur der gesamten Operngeschichte zu einer veritablen Kaskade an Emotionen und Leidenschaften.
«Elektras» Schwester, die «Salome», dirigierte Valery Gergiev vor ein paar Jahren in Zürich, und es war interessant, die beiden Dirigenten zu beobachten. Gergiev war irrlichterndes Chaos, funkensprühende Intensität ohne den Hauch eines Pulses oder einer klaren Ordnung. Dohnányi schlug selbst im grössten Orchestergetümmel die Einsätze ohne grosse Geste und mit exemplarischer Deutlichkeit. Seine Botschaft an die Orchestermusiker hiess: «Ich weiss genau, was du spielst, also reiss dich zusammen.» Eine Herausforderung, vor der sich dieses Orchester auf seinem heutigen Niveau in keiner Weise fürchten muss, aber alle sassen sie auf den Stuhlkanten und ermöglichten so die unwiderstehliche Kombination von höchster Präzision und glühendster Leidenschaft. Dohnányi kennt das Stück nicht nur, er durchleuchtet es bis in die letzten Winkel und holt das Letzte heraus, was Strauss in seiner wohl genialsten Partitur an Raffinessen eingestreut hat.
Dank Dohnányi sind die Fallhöhen zwischen schneidend scharfen, erbarmungslos exekutierten Akzenten und den zuckersüssen Harmonien (ja, auch die gibts in «Elektra», Strauss ist sich doch nicht untreu geworden!) so hoch, wie man sich das nur wünschen kann.
Trotz der kurzen Dauer der Oper ist die Titelpartie eine der anspruchsvollsten für einen dramatischen Sopran überhaupt. Deshalb kam es einer Katastrophe gleich, als Eva Johansson nach der Hauptprobe wegen Krankheit ausfiel. In einer Feuerwehrübung fand das Opernhaus schliesslich eine Sängerin, die es wagte, von einem Tag auf den anderen mit dieser horrenden Partie in diese schwierige Inszenierung hineinzuspringen: Die Amerikanerin Janice Baird. Ihr Mut wurde belohnt, sie war eine hinreissende und bei aller Monströsität anrührende Elektra.
Die Klippen gemeistert
Bairds Timbre ist nicht ganz nach meinem Geschmack, zu dunkel sind ihre Farben, zu gleichförmig klingen ihre Linien. Zudem ist ihr Volumen deutlich begrenzt, sie hat keine Chance über Dohnányis Orchester hinwegzukommen, wenn er - nicht sehr oft, aber dann mit elektrisierender Vehemenz - das Fortissimo auslotet. Aber Janice Baird machte diese Nachteile wett mit ihrer Klarheit der Linienführung, ihrer makellosen Intonation und der Vielfalt ihrer dynamischen Schattierungen. Die Erkennungsszene war von berührender Intensität.
Dass Janice Baird darstellerisch praktisch dieselbe Bühnenpräsenz wie ihre Kolleginnen aufbauen konnte, spricht nicht gerade für deren schauspielerisches Talent. Tatsächlich waren sowohl Marjana Lipovsek als Klytämnestra und Melanie Diener als Chrysothemis eher blass gezeichnete Figuren. Lipovsek immerhin konnte dieses Manko wettmachen durch ihren wirklich packenden Gesang, ihre stimmliche Ausdruckskraft und technische Beherrschung der Partie. Diener dagegen blieb auch sängerisch eher blass, trotz einiger schön gestalteter Linien.
|

15. 12. 2003
Eine beklemmend konsequente Inszenierung
Viel Jubel gab es für Richard Strauss’ «Elektra» am Zürcher Opernhaus: Für eine starke Inszenierung von Martin Kusej - und für eine phänomenale Ersatz-Elektra.
Von Susanne Kübler
Am Anfang war ein Notfall. Eva Johansson, die sich als Elektra erstmals im Zürcher Opernhaus hätte vorstellen sollen, erkrankte zwei Tage vor der Premiere. Einen Tag vor der Premiere erwies sich die kurzfristig aufgebotene Ersatz-Sängerin als ungeeignet. Am Tag der Premiere schliesslich reiste die Amerikanerin Janice Baird an, die derzeit in Düsseldorf die Brünnhilde singt: Der Notfall wurde zum Glücksfall.
Denn Baird ist nicht nur wegen ihres dunklen, sensiblen Soprans eine grossartige Elektra; sie agierte am Samstag auch, als sei Martin Kusejs Inszenierung für sie gemacht. Zierlich und trotzig stand sie da, mit Rossschwanz und Cargohose und Kapuzenjacke. Fremd in einer Welt der geschmacklosen Eleganz, isoliert in ihrem Hass auf die Mutter, die den Vater ermordet hat, gefangen in einem schwarzen Gang und ihren Racheplänen.
Ein Raum wie ein Alptraum
Als «ein Gemenge aus Nacht und Licht, schwarz und hell» hatte der Dichter und Librettist Hugo von Hofmannsthal die «Elektra» in einem Brief an den Komponisten Richard Strauss beschrieben. Nacht und Licht bestimmen auch Kusejs beklemmend konsequente Inszenierung. Bühnenbildner Rolf Glittenberg lässt den Gang in perspektivischer Überzeichnung in die Enge führen. Wenn die seitlichen Türen aufgehen, werden die weissen Polsterungen sichtbar - auf dass die Töne der Gewalt, die in diesem Bunker-Palast alltäglich ist, unhörbar bleiben. Kaltes Licht strömt manchmal aus den Luken über diesen Türen, grelle Spots beleuchten die Figuren, die dann wieder in den Halbschatten abtauchen.
Der Raum ist ein Alptraum, Elektras Alptraum. Ruth Berghaus hatte die letzte Zürcher «Elektra» in einer psychiatrischen Klinik spielen lassen; Martin Kusej, der nach der «Salome» bereits zum zweiten Mal ein «strausssches Monster» auf diese Bühne bringt, zeigt das Geschehen nun ganz aus der kranken Perspektive der Protagonistin: einer Frau, die nichts als Gewalt erlebt hat, nichts als Gewalt sieht und nichts als Gewalt will. Vielleicht ist der dunkelgrau gewellte Filzboden nicht real, sondern Ausdruck dafür, wie sehr diese Elektra aus dem Gleichgewicht geraten ist. Vielleicht existieren auch jene Menschenmassen nur in ihrem Kopf, die sich gelegentlich in hektischem Hin und Her die von Heidi Hackl entworfenen Anzüge und Deuxpièces vom Leib reissen (wobei die Nacktheit operngerecht keusch durch hautfarbene Unterwäsche gemildert bleibt). Und ganz bestimmt ist jenes kleine Mädchen, das Elektra im Boden versenkt, rein symbolisch gemeint.
Die Klänge sind in Elektras Kopf
Es ist der Moment, in dem der Tod des Orest gemeldet wird: In der Gewissheit, dass der Bruder nicht mehr zurückkommt, dass sie deshalb den Mord an ihrer Mutter Klytämnestra und deren Geliebten Aegisth selber ausführen muss, tötet Elektra endgültig alles Mädchenhafte in sich ab. Da streift die Inszenierung für einmal jene allzu konkrete Psychologie, die sie sonst so geschickt vermeidet. Aber Orest lebt dann ja doch, und Elektra kann sich wieder in ihren abstrakten, ohnmächtigen, fanatischen Hass zurückziehen.
Die Konzentration der Regie auf Elektras Innenwelt ist nicht nur stimmig, sondern auch unerhört musikalisch gedacht. Schliesslich lässt auch Strauss’ Musik die Innensicht der Geschichte hören: Quälend sirren die Klänge des Hasses in Elektras Kopf, harte Schläge treiben ihre mörderische Obsession an, und wenn sie sich in Erinnerungen verliert, verliert sich auch die Musik. Am Ende bestätigt Elektras Antwort auf eine Frage ihrer Schwester Chrysothemis nur das, was man die ganze Oper hindurch spürt: «Ob ich die Musik nicht höre? Sie kommt doch aus mir.»
Christoph von Dohnányi, kein Leisetreter unter den Dirigenten, inszeniert den düsteren Rausch dieser Musik unerbittlich, mit mächtigem Dröhnen im tiefen Blech, mit sich aufbäumenden Streichern, viel Gefühl für Spannung und einer generellen Tendenz zur exzessiven Lautstärke. Das Orchester der Oper scheint die letzten Reserven zu mobilisieren, und das Ergebnis ist schlechterdings aufwühlend. Die Klangmassen überspülen den ganzen Raum, und es stört nicht einmal, wenn sie Elektras Stimme zuweilen keine Chance lassen: Sie sind ja die innere Stimme, gegen die sie nicht ankommt.
Häufig sind diese Momente allerdings nicht, auch wenn Janice Baird für eine dramatische Sopranistin keine besonders laute Stimme hat. Ihre Stärke ist die durchsetzungsfähige, nie plakative und deshalb eher menschliche als monströse Intensität. Damit bewältigt sie ihre Hochleistungspartie ohne Kraftprotzerei, damit zwingt sie auch die übrigen Protagonisten in ihren Bann. Das wirkt umso unheimlicher, als diese grössere Klangvolumen aufbieten: Melanie Diener verkörpert die sanftere Schwester Chrysothemis mit hellem, starkem Sopran und den Gesten verzweifelter Liebesbedürftigkeit; die Mezzosopranistin Marjana Lipovek verleiht ihrer eindrücklich terrorisierten und terrorisierenden Klytämnestra eine metallische, immer wieder fast ins Sprechen kippende Stimme. Jukka Rasilainen gibt einen markanten, unüberhörbar Wagner-geschulten Orest, und Rudolf Schasching verbindet als zuhälterartig aufgeputzter Aegisth tenorale Härte mit Schmierigkeit.
Sterben darf Elektra nicht
So kommt zur Kompromisslosigkeit von Inszenierung und Orchester jene der Sängerinnen und Sänger, und alles treibt auf ein Ende zu, das keines sein darf. Wenn Chrysothemis und Elektra die Erlösung und den Jubel am Hof über die endlich vollbrachten Morde besingen, ist von Erleichterung nichts zu spüren. Steif und verkrümmt steht das Personal an den Wänden, Orest versteinert im Erschrecken über seine Tat. Nur Elektra deutet mit ein paar Schritten jenen Freudentanz an, den sie ihrem toten Vater versprochen hatte; hinter ihr (und wieder: in ihr) schwingen Variété-Tänzer in einer eher gehetzten als sinnlichen Choreografie ihre Federn. Schliesslich erstarrt auch sie, allein in ihrem schwarzen Gang. Sterben darf sie nicht in dieser Aufführung.
|

15. 12. 2003
Eine Elektra, die um ihr Leben sang
Für die Premiere der Oper «Elektra» im Zürcher Opernhaus musste ein Ersatz für die Hauptrolle gesucht werden
Die Premiere der Richard-Strauss-Oper «Elektra» im Opernhaus Zürich musste nach der Generalprobe mit einer Ersatzhauptdarstellerin durchgeführt werden. Die eingesprungene Janice Baird als Elektra sang, als ginge es um ihr Leben. Das Publikum war begeistert.
Der Schock im Zürcher Opernhaus war gross: nach der Generalprobe zur «Elektra» von Richard Strauss musste die schwedische Sängerin Eva Johansson wegen plötzlicher schwerer Erkältung die Hauptrolle absagen. Alexander Pereira war nicht zu beneiden. Er musste über Nacht einen Ersatz suchen und fand ihn in der jungen aufstrebenden Amerikanerin Janice Baird, die gerade an einer deutschen Bühne war. Sie sagte mutig zu, reiste am Morgen des Premierentages an und sang diese Zürcher Elektra, als ginge es um ihr Leben. Das Publikum geriet ob dieser grandiosen Leistung ausser Rand und Band.
Dramatische «Elektra»-Partien
Die «Elektra», das ist Familienschuld, Generationenkonflikt und Geschlechterkampf. Und das alles wird mit Morden erledigt, mit Blutrache der lebendig begrabenen Kinder. Für diesen grausig monströsen Stoff, der bereits in der «Salome» zum Ausdruck kam, fand der 45-jährige Richard Strauss zu seiner modernsten Tonsprache überhaupt. Das Libretto von Hugo von Hofmannsthal ist sprachlich brutal direkt und so knapp und präzise im Ausdruck, dass darin die gewaltige Musik ungehindert regieren kann. Das riesige Orchester von zirka 120 Musikern wird in Zürich von Christoph von Dohnányi zugleich gebändigt und zelebriert.
Die Frauenpartien in der «Elektra» gehören allesamt zu den grossen Partien des dramatischen Fachs. Neben der Elektra ist da noch die jüngere Schwester, Chrysothemis, ebenfalls Sopran, und natürlich die Mutter Klytämnestra, die ihren Mann, König Agamemnon, gemeinsam mit ihrem Geliebten Aegisth ermordet hat. Klytämnestra träumt schlecht, ist getrieben von den bösen Geistern. sie holt sich ausgerechnet bei der störrischen, aber klugen Tochter Elektra Rat, die den Mord am Vater rächen will. Marjana Lipovsek singt diese Matriarchin mit grosser und nuancenreicher Stimme, mit Intensität und gebrochener Macht.
Regisseur Martin Kusej zeichnet sie zwar als sehr alte, grauhaarige Dame, der man das geteilte Bett mit Aegisth nicht mehr abnimmt. Aber Lipovsek hat die dunkle Erotik in der Stimme, ihre Bühnenpräsenz ist umwerfend, der Ausdruck ihrer Verzweiflung erdrückend. Kusej hat bereits die letzte Zürcher «Salome» raffiniert in die Moderne übertragen. Nun schafft er auch mit der «Elektra» die heikle Gratwanderung zwischen moderner Zeiterscheinung und archaischem Gehalt. Das Bühnenbild von Rolf Glittenberg zeigt eine Art dunklen Kerker mit unebenem Boden, der sich nach hinten verengt. Dieser Zwischenraum, der sich gleichzeitig vor und im Palast befindet, wird mit Fensterluken über den insgesamt neun Türen zuweilen neongrell erhellt oder finster verdunkelt. Dieser gewellte Boden macht jeden Gang zum unsicheren Tritt; er lässt die Protagonisten straucheln und fallen.
Eine natürliche Rotznase
Man traute am Premierenabend seinen Augen nicht, als Elektra unter dem keifenden Dienstpersonal auftauchte: in modernen schwarzen Schlapphosen mit groben Taschenaufnähern, dazu ein rotes, weit ausgeschnittenes Top und ein gelbes Jäckchen. Sie ist, was die Kleider betrifft, ein halber Punk. Hass hat sie auf dieses Haus, Rache ist ihr einziger Gedanke, das Warten auf den Bruder Orest, der die Tat endlich vollbringen soll, zermürbt sie. Dieses ewige Warten wird in diesem kerkerhaften Haus und in dieser harmonisch stark erweiterten Musik unerträglich. Janice Baird spielte diese Rotznase mit ganz natürlicher Gestik. Und sie sang sie mit voller Hingabe und verinnerlichtem Ausdruck. Das Leiden, der Hass, die sie erschütternde Begegnung mit dem tot geglaubten Bruder. Und dann der Triumph über die ermordete Mutter, unter dem sie schliesslich zusammenbricht - Janice Baird verkörpert diese zerstörerischen Extreme mit jugendlicher Kraft und hinreissendem dramatischem Stimmpotenzial.
Blecherne Klangwucht aus dem Orchestergraben
Chrysothemis, Elektras jüngere Schwester, die endlich das Haus verlassen und einen Mann heiraten möchte, sie ist in jungfräuliches und sehr traditionelles Weiss gekleidet. Melanie Diener verlieh dieser stereotyp «fraulichen» Figur eine weich timbrierte und doch üppige Stimme, die ihre Ohnmacht und ihre Sehnsucht glaubhaft und bewegend mitzuteilen vermochte. Ein grandioses Rollendebüt, das auch von der differenzierten Schauspielregie Kusejs getragen wurde. Die Musik, die aus dem Orchestergraben kam, forderte zwar das Stimmvolumen aller, achtete aber die Grenzen des Möglichen ganz genau. Christoph von Dohnányi beherrschte den riesigen Apparat mit unerhörter Vielschichtigkeit, die der blechernen Klangwucht ebenso zu ihrem Recht verhalf wie der kammermusikalischen Intimität. Das in den tiefsten Blasinstrumenten dräuende Dunkel war von erschütternder Macht.
Alle Sängerinnen und Sänger konnten sich auf diesen wuchtigen, aber doch transparenten Orchesterklang verlassen und wirkten wie eingebettet in ihn, ohne darin unter zu gehen. Auch der eindrückliche Bewegungschor, den Kusej zur Veranschaulichung des Triebhaften gezielt, aber nie zu aufdringlich einsetzte, wirkte ganz aus der Musik heraus geführt. So kamen auch die beiden Männerpartien gut zur Geltung. Rudolf Schasching überzeugte mit seiner Körperfülle und dem heldisch strahlenden Tenor in der Rolle des Aegisth. Dies vor allem in der brillant differenzierten Begegnung mit der scheinheiligen Elektra kurz vor seiner Ermordung. Daneben gestaltete der junge Finne Jukka Rasilainen das unverhoffte Wiedersehen mit Elektra mit rührender Intimität und grosser Stimme. Die Suggestivkraft dieser Aufführung entlud sich nach knapp zwei Stunden ohne Pause in einen grossen Bravo-Sturm, aus dem sich einzig für die Regie ein paar wenige Buhs heraushören liessen.
Sibylle Ehrismann
|
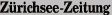
15. 12. 2003
Den Revolver muss Elektra tragen
Viel Applaus im Publikum, kaum Unmutsäusserungen zum Schluss: Trotz Umbesetzung der Titelpartie in allerletzter Minute konnte die Aufführung unbeschadet über die Bühne gehen. Szenisch nicht stets einleuchtend - musikalisch nervenaufreibend intensiv.
WERNER PFISTER
Offenbar wird auf der Attriden-Burg in Mykene, in Elektras Elternhaus also, ein grosses Fest gefeiert. Jedenfalls muss Bedienpersonal eingestellt werden; die fünf Mägde (und einige stumme Männer) kommen entsprechend mit Koffern und Gepäckrollis auf die Bühne, ziehen sich zur Serviertochter um (mit Schürzchen und Strümpfen und Röckchen), und zwar auch die Männer: ein bisschen Transvestismus also, als könnte der in unserer Zeit auch eine nur halbwegs noch griffige Chiffre für eine «verkehrte» Welt sein.
Barfuss und Punkerschuhe
Elektra, die Königstochter - nein, Richard Strauss' Forderung, dass die Hauptrolle «nun auf jeden Fall von der allerhochdramatischsten Sängerin gegeben werden» müsse, sie wird hier nicht erfüllt; allerdings nicht zum Nachteil der Aufführung - Elektra also tritt als junge Punkerin auf, mit schwarzklobigem Schuhwerk, Fliegerhose und Kapuzensweater. Gänzlich in festliches Weiss gewandet ist dagegen ihre Schwester Chrysothemis, die «Lichtgestalt». Und die geht, wie schwebend, ausnahmslos barfuss.
Viel geheimnislose und dann halt auch etwas plakative Symbolik also - in den Kostümen von Heidi Hackl ebenso wie im Bühnenbild von Rudolf Glittenberg: eine bis in den Bühnenhintergrund geometrisch streng gezogene, lange Korridorflucht, seitlich und hinten ledergepolsterte Türen für Aufiritte und Abgänge, der Boden allerdings wüst aufgeworfen wie ein Wellengebirge.
Wiederholt wird das Bedienpersonal über diese Bühne gejagt, von der einen Seite auf die andere, mal sauber in Weiss gekleidet, dann auch in verschiedenen Stadien nackt, zuletzt jeder Einzelne mit einem Beil in der Hand, was uns vielleicht sagen soll, dass jeder die beiden Morde (an Klytämnestra und Aegisth) hätte verüben können, es aber - aus welchen Gründen auch immer - bislang nicht getan hat. Viel Betriebsamkeit also, wobei die Abgänge so vieler Statisten manchmal fast ans Peinliche grenzten.
Brasil Show
Der junge Diener, der den Tod Orests melden soll, tritt in Unterhosen auf (ein leiser Schielblick zum Theater imSchiffbau?). Orest selber, damit er unerkannt bleibt, tritt mit Blumenbukett in der Hand und einer überlangen, blond gelockten Perücke auf - Jüngling oder Mädchen? Und wenn Elektra ihr Beil auszugraben versucht, vergräbt sie, im selben Erdloch und bei lebendigem Leibe, ein kleines Mädchen. Endlich kann sie ihr Kindheitstrauma, ihre hysterische Psychose, definitiv abreagieren respektive begraben.
Kein Zweifel, Regisseur Martin Kusej versucht, der Attriden-Geschichte - und mehr noch: dem ganzen Mythos - auf den Grund zu kommen. Doch wird, wenn es um die szenische Realisation geht, von solcher psychologischer Tiefenforschung wiederholt nur Oberflächliches sichtbar.
Eine Personenführung - bei Chrysothemis, Orest - ist zuweilen kaum auszumachen; und dass am Schluss die ganze Gesellschaft psychisch krank auf die Bühne kommt, mit tonlosen Schreien aus offenem Mund, und gleichzeitig, die Baila Brasil Show mit karnevaleskem Federputz eine heisse Tanzeinlage gibt - ich weiss nicht, was das zur finalen Quintessenz der «Elektra» Erhellendes beitragen soll.
Bombensicher
Keinerlei solche Fragen indes lässt die musikalische Seite dieser Neuinszenierung offen. Das ist packend vom ersten bis zum letzten Ton. Erstmals übertitelt das Opernhaus eine Aufführung in deutscher Sprache mit dem vollständigen Libretto-Text - vielleicht eine Verbeugung vor Hugo von Hofmannsthal, dem kongenialen Librettisten, aber doch insgesamt störend, weil das Lesen des vollständigenTextes den Blick des Publikums fas zwangsläufig ununterbrochen auf diese Übertitelung lenkt. Was sollen sich die Sänger dabei denken?
Denn sie gaben sich alle sehr redliche Mühe, sangen sich fast das Herz aus dem Leib und beeindruckten gerade durch solche restlose`Hingabe an die Musik. Allen voran Janice Baird in der mörderischenTitelpartie: sie war erst am Premierentag einge sprungen, konnte also nichts von der insgesamt sechswöchigen Probenarbeit mitmachen und wartete dennoch und zur schönen Überraschung mit einer auch schauspielerisch packenden Leist ung auf. Stimmlich bewältigte sie Partie souverän, ohne Ermüdungserscheinungen bis zum Schluss, mit bombensicherer Höhe, aber auch da und dort mit jenem lyrischen Schmelz in der Stimme, welcher die Verletzlichkeit Elektras zeigte.
Wozu der Revolver?
Als Chrysothemis gab Melanie Diener ein beachtliches Rollendebüt mit jugendlich dramatischem Sopran, der auch das pathetischste Orchestertutti mit silbernem Strahlglanz zu übertönen vermochte. Im Schauspielerischen indes schien sie den Zugang zum Facettenreichtum ihrer Rolle noch nicht wirklich gefunden zu haben. Genau das Gegenteill giIt für Marjana Lipovsek: in jedem Zoll, in Schritt und Gestik, Mimik und Stimme eine unvergleichlich suggestive Klytärhnestra. Sie sang, ohne zum Chargieren Zuflucht zu nehmen, weil ihre Stimme - respektive die souverän gehandhabte Stimmfarbendramaturgie - alle Bereiche des Expressiven unmittelbar zu verlebendigen im Stande war.
Relativ blass, in stimmlichem Einheitsgrau befangen, blieb Jukka Rasilainen als, Orest, vor allem in der Erkennungsszene mit ihren so farbglühenden musikalischen Emotionen. Rudolf Schasching nutzte seinen kurzen Auftritt als Aegisth zu einer pointierten Charakterstudie. Warum er zum Schluss von Elektra mit einem Revolver in Schach gehalten wird, das wissen wir allerdings nicht.
Dekadenz und Überhitzung
Unter der souveränen Leitung Christoph von Dohnányis hatte das Orchester der Oper Zürich eine Strauss-Sternstunde. Er liess die klanglichen Apotheosen zwar wuchtig (und scharfkantig gemeisselt) ausspielen, gleichzeitig aber war ihm, wohl auch aus Rücksicht auf die Sänger, an einer nervig Schlanken, lienear intensiven Darstellung gelegen, wo alles in stetem Fluss blieb.
Zu loben ist die noble Stilistik in der Klangkultur des , Orchesters, sowohl in der raumgreifenden Fortissimo-Totale wie im feinsten Solofiligran, im gleissenden Klangfarbenspektrum wie in der Dynamik. Christoph von Dohnány bewies einmal mehr, dass - über die rein klangliche Dimension hinaus - Orchesterpräzision und interpretatorische Strenge die besten Mittel sind, um die üppig ausufernde «Elektra»-Musik als das erfahrbar zu machen, was sie letztlich ist: Höhe- und Endpunkt einer operngeschichtlichen Entwicklung, kühle Dekadenz und Überhitzung in einem.
|

15. 12. 2003
Lara Croft in Arbeiterhose
Jenseits aller Opernklischees: "Elektra" von Kusej/von Dohnányi in Zürich
von Manuel Brug
Kein Blut, nirgends. Weder Gekröse, noch Schlamm oder Mist. Nur ein hügeliger Boden aus Automatten, neun von außen gepolsterte Türen in ein nebeliges Nichts, zeitweise Neonleuchten als Oberlichter. Rolf Glittenbergs aseptisches Bühnenbild zeigt keinen altgriechischen Palasthinterhof, eher eine zeitgenössische Ausnüchterungskammer, Gummizelle, Abstellraum. Ein Ort der unangenehmen Erinnerung, der sehr bösen Träume. Die allerdings wogen und krachen, schneiden scharf durch die Atmosphäre. Christoph von Dohnányi dirigiert das bestens aufgelegte Zürcher Opernorchester mit gleißender Wucht in einer Elfenmusik mit der Kettensäge. Das kracht und bolzt, das glänzt und glimmert. Die überfordernde Strauss-Partitur wird aufgefräst wie die geschmeidig biegsame Titanaußenschale einer Frank-O.-Gehry-Architekturlandschaft.
Und Martin Kusej inszeniert - neuerlich nach Mozarts eigentlich traditionell, aber monumental ausziseliertem "Titus" in Salzburg - vivisektiv analysierend bis in die Nervenenden eines Psychoschockers hinein. Diesmal - der kleinen Zürcher Oper geschuldet - intimer, auf den Punkt konzentriert. Die Stunde der Atridentochter Elektra, die auf die Ankunft des Bruders Orest wartet und auf Rache an ihrer, den Vater Agamemnon gemordet habenden Mutter Klytämnestra sinnt - das wurde die triumphale Stunde von Janice Baird, die als zweiter Ersatz für die erkrankte Eva Johansson mit einer einzigen Probe todesmutig in die Premiere sprang - und gewann, den Albtraum in einen Sopranistinnensieg verwandelte.
Eine Elektra, jenseits aller Opernklischees. Keine füllig-vollbusig Hochdramatische im Zottellook, die megärenhaft ihrem finalen Tanz entgegenstampft. Sondern Lara Croft in Arbeiterhose und Kapuzenshirt, eine royale Rächerin aus dem emanzipierten Bilderstrip, die die Stellung hält, die Mutter ins Verderben treibt. Und schließlich mit dem Revolver statt dem Hackebeil den prolligen Onkel Aegisth in die tödliche Umarmung des Orest treibt. Auch stimmlich eine Elektra jenseits der Konvention. Schlank, sehnig mit glühenden Vokalisen, aber wenig satter Mittellage.
Ein atemloser Thriller, ganz im Sinne ihrer Erfinder Euripides, Hofmannsthal und Strauss. Wieder einmal schafft Kusej eine sinister-kalte Atmosphäre aus Sex und Erniedrigung. Die Mägde sind hier Liebesgehilfinnen in Straps, Lack und Dienstmädchenschürze. In diesem Schlachthaus der abgetöteten Emotionen, wo nur die nach ihrem "Weiberschicksal" greinende Schwester Chrysothemis (Melanie Diener) noch nach Zukunft sich sehnt, erscheinen alle in Nachthemd, Unterhose oder Pyjama: bettfertig für die leer laufende Dauerorgie, in welcher der Bewegungschor zuckt und - folgerichtig - federnbestückt im Finale anstelle der starr harrenden Elektra in einer letzten Todessamba powackelt. Da sind sie dann beide schon von Orest abgestochen worden: Marjana Lipovseks grandios dumpf tönende Klytämnestra als Rabenmutter-Wrack und Rudolf Schaschnigs grell gellender Aegisth; ein Psychopath der vorher schon, nur zum Plaisir, einfach ein Mädchen abgeknallt hat.
Die übrig gebliebenen Geschwister haben nicht viel von ihrer Rache. Schon als sich der schlankstimmige Orest von Jukka Rasilainen und Elektra endlich erkennen, glotzen sie aneinander vorbei. Ist das Blutbad vollendet, zittern sie isoliert, ausgebrannt und erledigt in den Ecken. Die wahre Kusej-Tragödie, sie findet im Kopf statt.
|
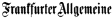
15. 12. 2003
Die Wahrheit in den Schlafzimmern
Martin Kusej und Christoph von Dohnányi interpretieren Strauss‘ „Elektra“
an der Zürcher Oper
In Mykene, der innere Hof, begrenzt von der Rückseite des königlichen Palasts und niedrigen Gebäuden für die Diener, vorn links ein Ziehbrunnen - so die Szenenbeschreibung für die Oper "Elektra" von Richard Strauss und Hugo von HofmannsthaI. In Zürich sieht alles anders aus: ein nach hinten spitz zulaufender dunkler Raum, eine Art "Korridor" mit vielen Türen links, rechts und hinten, oben schmale Fenster, die wie Schießscharten wirken, auf dem Boden wellt sich Erde, bedeckt mit schwarzer Teerpappe. Dort hat sich Elektra eingegraben, dort hält sie das Beil versteckt, mit dem einst Aegisth und Klytämnestra ihren Vater Agamemnon erschlugen.
Regisseur Martin Kusej und dessen Bühnenbildner Rolf Glittenberg erzählen nicht die Geschichte, wie sie im Buche steht, sie bebildern sie nicht mit antikischen Palastmauern, sie versuchen vielmehr, hinter die Geschichte zu gelangen und damit in sie hinein, in ihr Zentrum. Dabei verkennen sie nicht, daß ihnen auf diesem Weg schon die Schöpfer der Oper vorangegangen sind: HofmannsthaI und Strauss applizierten dem alten Mythos die Erkenntnisse der Psychoanalyse, Freud avancierte zum Koautor. Die marmorweiße Antike der Winckelmann, Goethe & Co. war nur eine schöne Verklärung der einst blutigen Wirklichkeit.
Martin Kusej aber setzte zudem auf ein Verstärkungsmittel aus der Rezeptur Heiner Müllers. In dessen "Hamletmaschine" beschwört die an einen Rollstuhl gefesselte Ophelia das Bild der Atridentochter: "Hier spricht Elektra. Im Herzen der Finsternis. Unter der Sonne der Folter. An die Metropolen der Welt. Im Namen der Opfer. Ich stoße allen Samen aus, den ich empfangen habe. Ich verwandle die Milch meiner Brüste in tödliches Gift. Ich nehme die Welt zurück, die ich geboren habe. Ich ersticke die Welt, die ich geboren habe, zwischen meinen Schenkeln. Ich begrabe sie in meiner Scham. Nieder mit dem Glück der Unterwerfung. Es lebe der Haß, die Verachtung, der Aufstand, der Tod. Wenn sie mit Fleischermessern durch eure Schlafzimmer geht, werdet ihr die Wahrheit wissen." Martin Kusej hat dem Zitat, wie er sagt, nichts hinzuzufügen, was so nicht stimmt: Er fügt seine Inszenierung hinzu, indem er Müllers stählerne Härte, scharfe Beobachtung und erbarmungslose Analyse einer Elektra in unserer Zeit in seine Darstellung hereinnimmt. Vielleicht nicht immer mit der brutalen Direktheit Müllers. Doch immer wieder bannen einen starke Bilder und Aktionen, die in dem kafkaesken "Korridor" mit den vielen Türen klaustrophobische Schocks erzeugen. Immer Wieder jagen, springen, rasen die Akteure des Bewegungschores aus den sich öffnenden Türen quer durch den Raum, stürzen zu Boden, kämpfen, schwingen die Äxte, wenn es zum Mord an Aegisth geht: Die einstige individuelle Tat ?explodiert" zur aktuellen kollektiven Wahnsinnstat. Im magischen Zentrum aber verharrt Elektra, kostümiert als Straßenkind unserer Tage: Sie tanzt sich am Ende nicht im triumphierenden Wahnsinn in den Tod, sie stolpert vielmehr über die welligen Hügel, stürzt nieder, rafft sich wieder auf, erschöpft, ausgebrannt, aber sie wird irgendwie weiterleben: verlassen, das vor allem. Wie viele Menschen in unserer Zeit. Kusejs Annäherung an die Figur besitzt Plausibilität. Was hat sich eigentlich seit alters geändert im Verhalten der Menschen? Wenig, nichts. Nur die Vervielfältigungstechniken haben an Geschwindigkeit gewonnen. Und dabei sind zugleich die Figuren geschrumpft. Deren Fallhöhe wird nicht mehr als Tragödie empfunden, eher als eine Art Betriebsunfall. Diesen Reibungsverlusten zwischen den Figuren der Vorlagen und deren Abbild in sogenannten "modernen" Inszenierungen entgeht auch Kusejs "Elektra" nicht überall. Aber sie bannt immer wieder durch die Intensität, mit der sie ihre Intentionen umsetzt.
Bewunderungswürdig in dieser Hinsicht die Elektra-Sängerin Janice Baird: Erst am Vormittag der Premiere für die plötzlich erkrankte Eva Johansson eingesprungen, fand sie sich, rasch eingewiesen, in der ungewohnten Inszenierung offensichtlich souverän zurecht, gewann in Darstellung und Gesang großes Format. Marjana Lipovseks Klytämnestra und Melanie Dieners Chrysothemis bewahrten in Stil und Erscheinung am meisten die Erinnerung an die Aufführungstradition, aber sie sangen grandios. Jukka Rasilainens Orest wiederum war ungewöhnlich differenziert gezeichnet bis in die sichtbaren mimischen und physischen Verstörungen nach der Tat. Auch vokal war das differenziert durchgestaltet. Eine prägnante Studie auch der Aegisth von Rudolf Schasching.
Daß Christoph von Dohnányi ein großer Strauss-Dirigent ist, weiß man. An diesem Abend erlebte man dazu noch den Quantensprung ins Übergroße. An Präzision, Transparenz des Klanges, dramatischer Energie, explosiver Kraft und artikulatorischer Deutlichkeit dürfte die Aufführung nicht zu überbieten sein. Das Zürcher Opernorchester agierte auf höchstem Niveau, selbst im stärksten Fortissimo blieb der Klang stets genau konturiert. Die Musik lieferte mit ihrer "Nervenkontrapunktik" und Psychologisierung des Klanges der Szene den Beweis für die Stimmigkeit des Regiekonzepts.
GERHARD ROHDE
|

30. 12. 2003
Scheusale, kariert verpackt
Zwei Schweizer Weihnachtsopern: "Elektra" in Zürich, "Freischütz" in Basel
VON HANS-KLAUS JUNGHEINRICH
Klytemnästra, die gattenmörderisch grässliche Königin, reißt sich auf dem Höhepunkt ihrer megärenhaften Echauffage die Halskette ab, so dass die Perlen über die ganze Bühne spritzen. Auch sonst gibt es in Martin Kusejs Zürcher Elektra-Inszenierung etliche Temperaments-Aufwallungen. So ist ein splendider Bewegungschor aufgeboten zur Illustrierung der perversen Hofhaltung Klytemnästras. In bald orgiastischem, bald katastrophischen Taumel eilen Komparsenmassen durch seitliche Tore (Bühne: Rolf Glittenberg) bald von links nach rechts, bald von rechts nach links in verschiedenen Graden von An- und Ausgezogenheit. In all dem Getümmel erscheint Elektra, die auf dem gewaltig dicken Ei ihrer Rache Brütende, Inbild einer fatal mutterfeindlichen Vatertochter, zunächst als einziger ruhender Pol.
Außenseiterisch hockt sie da, fast wie ein vergessenes Möbelstück, angetan mit einer Kapuzenjacke (Kostüme: Heidi Hackl), die sie beinahe wie einen Kohlenträger aus Puccinis Tabarro aussehen lässt. Zu den scheinbar irritierenden Zutaten Kusejs gehört am Ende, als Kontrapunkt zu Elektras daktylisch dithyrambischen Tanz, ein aufgeputztes Can-Can-Trüppchen, das sich in diese Straussoper aus einer altfränkischen Offenbachiade verirrt zu haben scheint. Eine dennoch nicht ganz uneinleuchtende Bereicherung, die daran erinnern mochte, dass der Komponist selbst seine frühen Einakter gerne als "Operetten mit tödlichem Ausgang" charakterisierte.
Elektra gehört zu den Stücken, die nahezu zwangsläufig mehr durch die betäubende Wucht der musikalischen Realisierung gefangen nehmen als durch noch so deutliche Hundemarken inszenatorischer Könnerschaft. Auch in Zürich war's, trotz auf- bis eindringlicher Kusej-Signierungen, also ein Abend der musikalischen Kapazitäten. Dabei machte die Einspringerin Nadine Secunde in der Titelrolle nicht den ungewichtigsten Eindruck: eine versierte Vokalistin, darstellerisch auf plausible Weise minimalistisch, ohne je steif oder fade zu wirken. Marjana Lipovseks Klytemnästra wandelte souverän auf dem schmalen Grad zwischen kultivierter Gesanglichkeit und grellem stimmlichen Chargieren. Am Dirigentenpult war Christoph von Dohnányi ein unerschütterlicher Logistiker der monströsen Partitur, der sich auch vor brutalsten Entladungen nicht scheute. Für ein unweit vom schweren Blech sitzendes Publikum ist die Musik ohne einschlägige Suzie-Quatro-Stählung offenbar kaum unbeschadet zu überstehen; manch ängstliche(r) Zürcher(in) hielt sich partienweise die Ohren zu. Dohnányis besondere kennerische Aufmerksamkeit galt aber auch den verschwiegenen, im Wispernden, Nervösen hektischen Passagen, weniger bei der noch etwas ungelenken Mägdeszene als in den quasi emotionslos schweifenden Strecken vor dem Auftritt Orests.
Eigentlich besteht fast das komplette Personal der Elektra aus Scheusalen, und als solches wäre auch die kathartische Figur des Orest (machtvoll baritonal: Jukka Rasilainen) zu apostrophieren, der, nach schönem lyrischen Austausch mit Elektra, resolut zur Doppelschlachtung seiner Mutter und ihres Beschälers Aegisth (bizarr tenoral: Rudolf Schaching) schreitet. Im bürgerlichen Sinne angenehmste Erscheinung bleibt die unberührt feminine Chrysothemis, bei Melanie Diener prächtig sopranesk aufgehoben.
Erzstück deutscher Opernromantik
Als typisch weihnachtliches Opernangebot war ein neuer Freischütz in Basel zweifellos fashionabler als das düstere Zürcher Antikendrama, und in zusätzlichen Conference-Texten zu Webers Meisterwerk wurden ausdrücklich Verbindungslinien zwischen Frei- und Christbaumkugeln gezogen. So richtig satte Festfreude wollte die Konzeption des Regisseurs Claus Guth freilich nicht vermitteln. Das Erzstück deutscher Opernromantik fordert die Szeniker seit langem zu allerlei Allotria, auch zu ambitioniert-reflektierten Distanzierungsbemühungen, heraus. Guth schwankte zwischen beidem etwas unentschlossen hin und her. Das Niveau und den interpretatorischen Durchstich seines Bayreuther Holländer erreichte er mit dieser Basler Arbeit nicht.
Recht attraktiv immerhin die Ausstattung von Christian Schmidt, imaginierend eine immense (Sport-)Arena mit prospektmalerischen Zuschauermassen. In enger Försterstube turnen die Akteure dann ziemlich symbolisch isoliert zwischen tiefen Gräben herum. Apart die Wolfsschlucht als kafkaeskes Szenario mit einem Drehbühnenkarussel von nüchternen Bürotischen. Recht genant bricht Guth das frömmlerische Finale auseinander, indem er es "realistisch" mit der Tötung Agathes durch Maxens dämonische Freikugel enden lässt, um es dann, nach dem letzten Einspruch des die gesamte Handlung ironisch-sinister durchmusternden hinzugefügten Erzählers, um so ungeschmälerter "utopisch" und partiturgerecht abschließen zu können. Man hat's mithin teuer und billig zugleich. Der zerbröselte Keks kann heil genossen werden.
In diesem musikalisch so wunderbar reichen Opernfinale (in dem Guth den Chor gegen Ende in somnambuler Mückenseligkeit schweben und tanzen lässt) fällt auch der auf Kaspar gemünzte, vom Fürsten Ottokar wahrhaft imperial hingeschmissene unsterbliche Satz "Fort, werft das Scheusal in die Wolfsschlucht". Gemessen an der bösen Lächerlichkeit legitimer Herrschaft (prägnant verkörpert von Hendrik J. Köhler) ist die kasparische Schwärze in dieser Aufführung beinahe Mitleid erregend schmal und Björn Waag seinem schrankhaften Jägerkollegen Max (John Charles Pierce) auch figürlich nur allzu unterlegen. Der Tenor hielt sich gleichermaßen respektabel wie die Agathe (Christiane Iven) in ihren empfindsamen Sequenzen; Catherine Swansons Ännchen gefiel mit klarer Diktion ebenso wie mit körperbewusst kapriziösem Spielvermögen. Mit sehr gebremster Gravität amtierte der Eremit von Victor Jakovenko. Ansprechende Chorleistungen.
Musikalisch wurde die Aufführung betreut von dem neuen, aus Slowenien stammenden Basler Chefdirigenten Marko Letonja, der schwungvoll und mit Verve, aber auch mit lebhaftem Faible für Feinschattierungen musizierte. Allerdings pflegte er, im Gegensatz zu den Szenikern, einen eher traditionalistischen Stil, was bereits in der Ouvertüre überdeutlich wurde (verspätetes "a tempo" nach den Eingangstakten, starke Verbreiterung nach der Generalpause kurz vor Schluss). So war dieser Freischütz ein etwas kariert verpacktes Weihnachtspräsent: modern (und interessant durchsprenkelt) mit seiner szenischen Narration, etwas altmodisch und nicht ohne Merkmale von Routine im Musikalischen.
|

15. 12. 2003
Raum, der rebelliert
Schreiende Diskrepanz – die „Elektra“ von Richard Strauss
neu inszeniert in Neapel und in Zürich
Es brüllt der Raum, er klagt an, schreit Mord und Totschlag, rebelliert, trotzt. Der Raum ist der entscheidende Protagonist, ist Capocomico dieser noch heute durch Schrecken faszinierenden Oper, und er besitzt gleich drei gleichberechtigte Stimmen: die des Bühnenbildners, natürlich, aber auch die des Orchesters und die eine, fast schon unmenschliche Stimme, die Stimme der Elektra. Grausig begleitet von dumpf nach Grabromantik schmeckenden Hörnern und Posaunen, aufgereizt von heftig fordernden Streichern, ertönt der furchtbare Ruf in einem längst allen Welten abhanden gekommenen b-Moll – ein schauriges ?Agamemnon?, dem dann, ganz am Ende, wie ein Schatten, ein verzweifeltes ?Orest? antwortet. Signum und Garantie dafür, dass der Fluch der Atriden auch in unserer Zeit kein Ende finden wird, dass Mord, Folter, Hass und Zerstörungswut unsere wahren Brüder sind, von denen wir uns nie werden trennen können.
Die 1909 erstaufgeführte ?Elektra? von Richard Strauss ist ein Stück ohne Erlösung. Ein Stück, in dem aller Tanz und aller Jubel durch Mord vergiftet sind. Darüber klagt der Raum in Zuckungen und Schreien. In Neapel ist für die erste Stimme des Raumes Anselm Kiefer verantwortlich. Der Bildmeister aus Donaueschingen stellt gegen den riesigen, spätaristokratischen Innenraum des Teatro San Carlo ein ins 21. Jahrhundert gewendetes mykenisches Megaron: die drei Seiten eines Innenhofs aus hellem Beton, in riesigen zurückgesetzten Stufen sich nach oben weitend, ein heruntergekommener Bunker im Rohbau, mit Türen und Fenstern wie Wunden. Dieser Raum schreit gegen die Zivilisation, gegen die Kunstgeschichte, wie sie das San Carlo in seiner vollendeten Pracht behauptet.
Im Vergleich zum San Carlo ist das Züricher Opernhaus so etwas wie die in jeder Hinsicht verkleinerte Volksausgabe eines Theaterraums. Entsprechend sparsamer fällt auch das Bühnenbild von Rolf Glittenberg aus. Ein länglich sich nach hinten erstreckender Schuhkarton, ein Kerker, ein Gefängnis, mit vielen außen wattierten Türen. Wem Kiefers neapolitanischer Schock noch in den Knochen sitzt, der wittert in Zürich allenfalls Theaterpappmaché.
Die zweite und vielleicht wichtigste Stimme des ?Elektra?-Raums muss der Dirigent inszenieren. Gabriele Ferro, lange Jahre Opernmeister in Stuttgart und jetzt der Musikchef des San Carlo, bietet eine zutiefst undeutsche Lesart. Seine ?Elektra? dampft und schwitzt nicht. Der Maestro sucht im abgrundtiefen Schrecken nach jenen Formen, die Strauss für diesen Abgesang auf die Menschheit mit biergestählter Pranke zerschmettert hat. In der Asche und in den Trümmern der Partitur wird Ferro immer wieder fündig. Wie einst Schliemann in Mykene findet Ferro Goldschätze und kann und will nie verbergen, dass er sie in einer wüsten Ruinenlandschaft aufgesammelt hat. Sein Strauss gibt sich kühl konstruktivistisch als Bruder von Strawinsky, Schostakowitsch, Prokofiev zu erkennen, allerdings elegant aus dem Blickwinkel eines Franzosen gesehen.
Ins Endstadium geschleudert
Das tut der Partitur ausgesprochen gut. Die Distanz, die Ferro hält, entlässt das Publikum aus der Notlage, sich mit der monomanen Elektra und ihren Überspanntheiten identifizieren zu müssen. Wird doch der Zuschauer ohne alle Erklärung ins exaltierte Endstadium einer Psychose geschleudert, wird ihm doch zugemutet, die Geschichte einer Frau glauben zu müssen, die in einem bodenlosen Hass – dem einzigen Gefühl, dessen sie fähig ist und das allein sie am Leben hält – jahrelang nichts anderes will als blutige Vergeltung für den Mord an ihrem Vater.
Christoph von Dohnányi bietet, kühler Analytiker der er ist, in Zürich die herkömmlich vertraute Lesart, an der Moderne geschult, von hoher Genauigkeit. Hier heißen die Bezugspunkte Zweite Wiener Schule und Johann Strauß. Die Walzerseligkeit, die in „Elektra“ immer wieder durchscheint, versteht Dohnányi als „Rosenkavalier“-Ankündigung und damit als retrospektiv, als des Komponisten Feigheit vor dem eigenen avantgardistischen Mut. So kommen die Schärfen der Partitur zwar brutal plakativ, so geben sich die Stimmreibungen und Akkordzerfleischungen genauso unerbittlich wie die Rächerin Elektra. Doch Dohnányi weist, genauso wie Regisseur Martin Kussej, darauf hin, dass Strauss sich bald weniger mit der Protagonistin als mit deren Schwester Chrysothemis und deren Sehnsucht nach einem normkonformen Leben identifizieren wird.
An diesem Punkt denunziert die Regie beinahe. Melanie Diener muss mit irdischer Direktheit die Matrone geben, die Reaktionärin. Während in Klaus Michael Grübers neapolitanischer Regie Inga Nielsen die Chrysothemis flammend als Jungmädchen singt, unbekümmert vom Leben verführt, in ihrer Rebellion gegen das System so ganz und gar nicht vom Hass gesteuert, sondern von der unbändigen Sehnsucht nach Freiheit. Neapel bietet in den Schwestern zwei in die Zukunft gerichtete, gleichberechtigte Formen des Aufstands, Zürich malt in beiden Frauen finale Verfallsmomente ohne Hoffnung auf Zukunft.
Die dritte Stimme des Raums müsste die Protagonistin Elektra sein. Sie müsste den Schrei, den Bühnenbild und Orchester formen, zur Vollendung bringen. Gabriele Schnaut wird in Neapel von Grüber zur Selbstverantwortung gezwungen. Der Regisseur scheint kaum gewillt, die differenzierten Vorgaben von Bühnenbildner und Dirigent aufzugreifen. Also kämpft sich Gabriele Schnaut mit einem Standardrepertoire an Gesten durch die Rolle. Reißt die Arme hoch, läuft herum wie ein gejagtes Tier, verkriecht sich im Stroh, schießt heraus wie eine Mänade, wimmert, klagt, hasst. Das hat Format, auch wenn die Stimme in der unteren Hälfte nicht so recht anspricht.
In Zürich dagegen ergeben Glück und Pech eine sonderbare Melange. Eva Johansson musste grippebedingt absagen, und Kathleen Broderick springt todesmutig ein. Da steht ein Girlie in leinener Fliegerhose und gelber Kuscheljoppe, rotzfrech und mit einer dunkel timbrierten Riesenstimme. Wie schlimm diese Zitterpartie für Kathleen Broderick sein muss, merkt man so richtig erst beim Schlussbeifall. Davor scheint sie souverän und kann sich stolz behaupten neben Chrysothemis Melanie Diener und ihrer hinterhältigen Gruselmutter – Marjana Lipovsek ist präsent boshafter als ihre zu nette Kollegin Mette Ejsing in Neapel, während Jukka Rasilainen und Peter Edelmann zwei gleicherweise statische Oreste geben. Aber was zählen schon Männer in diesem Frauendrama.
So ist zwar die Züricher Premiere gerettet, aber alle Feinheiten der Personenführung sind beim Teufel. Aus den Probenfotos im Programmheft lässt sich erahnen, dass Kussej in Elektra das Psychogramm einer Geistesverwirrung zeichnen wollte, einer Störung, die durch das mörderisch alltägliche Unrecht hochgezüchtet wurde. Elektra ist Kussej eine Gottesnärrin, eine heilige Irre, die, weil sie auf der Wahrheit beharrt, an ihr zerbricht. All das kann allerdings selbst eine so grandiose Sängerdarstellerin wie Kathleen Broderick nicht an einem Tag erlernen. Dennoch treiben sie und Christoph von Dohnányi das Publikum zu Raserei. Die brodelnde „Elektra“ funktioniert nach wie vor als ein fulminantes Rauschmittel. Die Neapolitaner dagegen reagieren auf diese, durch Ferro schon von allzu großem expressionistischen Überdruck befreite, bayerisch-antike Barbarei eher zurückhaltend. So richtig warm werden will da niemand mit diesem unzivilisierten Import von nördlich der Alpen.
REINHARD J. BREMBECK
|

15. 12. 2003
Elektra darf nicht sterben
Ovationen: Richard Strauss‘ Oper in Zürich - inszeniert von Martin Kusej
Akkorde wie Monolithe. Ehern gemeißelt, bohren sich im Zürcher Opernhaus die d-Moll-Zacken des Agamemnon-Motivs ins Ohr. Unüberhörbar ist bei dem Dirigenten Christoph von Dohnanyi: Die Rache für Elektras im Bade abgeschlachteten Vater treibt auch in dieser Deutung die Titelheldin ausschließlich um. Gewiss, auch in der dritten Zürcher Richard-Strauss-Interpretation des berühmten Gastes tobt, rast und zuckt diese extreme Nervenmusik - wie auch nicht, wo es doch um eine entsetzliche Mischung aus Mord, psychischer Deformation, brütender Verzweiflung und Hass und nochmals Hass geht? Aber in Zürich schwitzt der Dirigent und nicht die Musik. Es ist, als bleibe wie oft bei Dohnanyi eine Spur von Distanz zwischen ihm und dem Werk statt dem Versinken in der Klangflut.
Als werfe eine Mooroberfläche Bläschen: Es blubbert, brodelt und rumort darunter. All die kleinen Arabesken sind zu hören - man nehme nur die unablässig quirlenden Holzbläserkommentare. Ein glasklares Orchesterspiel - und das, nachdem vor gerade mal zweieinhalb Wochen der "Meistersinger"-Koloss zu bewältigen war. Und wie selten sonst: Ein leichtes, ja duftiges Spiel, das immer wieder deutlich macht, dass 1908 die Walzersphäre des "Rosenkavalier" schon in der Luft liegt, und ein Spiel, das auch im beseligenden Instrumentalgesang beim Wiedererkennen Elektras und des als Vaterrächer heimgekehrten Bruders Orest nicht trieft.
Der Elektra-Sopran der am Premierentag als Einspringerin für eine Einspringerin herbeigeholten Janice Baird passt genau zu solchem Spiel ohne Fettzusatz: eine eher kühle Stimme wie aus Stahl und alle Höhenzumutungen bravourös meisternd, dem schönen, dem verhaltenen Ton zugetan und allem Keifen abgeneigt. Melanie Dieners Chrysothemis in Brautweiß ist der Schwester ein kristallen leuchtendes, lyrischeres Pendant. Mutter Klytämnestra ist die seit langem weltweit darin erfahrene Marjana Lipovsek: eine grausträhnige Frauenruine, die bei aller Deklamationspräzision die Relikte der Schönheit aufsucht - zerrütteter Belcanto, auch im Mezzosopran die Reste des einst Begehrenswerten. Jukka Rasilainens baritonmächtiger Orest, wie ein verkleidetes Phantom mit Lilienstrauß nach dem Mord an der Mutter und ihrem Liebhaber Aegisth desorientiert und bereits wie von den Erynnien geschlagen, und Rudolf Schaschings grotesk-tenoraler Aegisth, ein feister Kettenträger mit Sonnenbrille: Das vokale Umfeld ist wohl bestellt.
Gewellter Boden, auf dem die Gestalten schwanken
Janice Baird ist äußerlich ein Elektra-Ideal: ein Mädchen noch, eine Audrey-Hepburn-Gestalt in heutigen Alltagsklamotten und häufig ein amüsiertes, auch ironisch-böses Lächeln auf den Zügen - eine, die die Boshaftigkeit beinahe erzwingen muss und in der Verelendung noch hübscher, als Hugo von Hofmannsthals Dichtung es eigentlich erlaubt. Wieweit diese überlegene Haltung ihre ureigene ist, wieweit sie mit Martin Kusejs Regiekonzept übereinstimmt -es muss offen bleiben. Kusejs, des künftigen Salzburger Schauspieldirektors, Inszenierung ist dicht und kommt weitgehend ohne Aufgesetztheiten aus.
Sie begibt sich in eine Art Korridor, der sich in der Bühnentiefe verjüngt (Rolf Glittenberg). Türen und Oberlichter gestatten ab und an den Blick ins kalkweiße Innere des "Palasts": Hotel, Krankenhaus, Gruft, Heilanstalt, Grau in Grau - von allem etwas. Gewellter Boden, auf dem die Gestalten schwanken - Gestalten, die auch zwischen Endspielhorror und verschütteter und doch ersehnter Zärtlichkeit schwanken - Elektra gegenüber der Schwester, dem Bruder und beinahe auch der Mutter, die vom ermordeten Mann ja auch schofel behandelt worden war.
Eine hermetische Welt, deren Gesellschaft (alle haben ein Beil) von Gewalt - und (alle werden immer "nackter") Sexbereitschaft bestimmt ist, was zumindest bei letzterem Tatbestand ganz unerotisch lächerlich wirken kann. Die nervzerrende Musik vor Kllytämnestras Auftritt nutzt Kusej zu einem Bacchanal. Elektras finaler Triumphtanz bleibt indes ein erschöpftes Stolpern. Tod und Erlösung sind ihr verwehrt. Sie verharrt wie angewurzelt, und ein paar Schlusstakte lang schält sich ein reich gefiederter Revuetrupp tanzend aus dem Bühnennebel. Das bizarre Ende einer überaus spannenden Werkbefragung. Ovationen noch und noch.
Heinz W. Koch
|

18. 12. 2003
Martin Kusej inszenierte Richard Strauss" "Elektra" im Zürcher Opernhaus
In der Mitte und doch daneben
Ist Hugo von Hofmannsthals Elektra ein pathologischer Fall? Ja, sagen viele Regisseure, wenn sie sich Richard Strauss" Oper über das Libretto des Dichters annehmen - und stilisieren die Frau zu einer Hysterikerin, die es manisch nach Rache gelüstet. Nein, sagen wenige andere - und erklären Elektra schlicht zum trauernden Opfer einer lieblosen, gewalttätigen Gesellschaft.
Ich weiß nicht recht: Das ist die Antwort, die Martin Kusej mit seiner Neuinszenierung des Stücks an der Zürcher Oper suggerierte. Seine Elektra nämlich hat beides: Sie ist Trost suchende Trauernde ebenso wie jenes wahnsinnige, wilde Weib, das nach dem Beil des Vaters sucht, um damit zu morden.
Bewusst will Kusej offen lassen, wohin der Weg seiner Heldin nach dem Vollzug der ersehnten Bluttat führen wird. Am Ende der Oper steht Elektra bei ihm an demselben Ort, wo sie am Anfang schon stand: eine Frau im Kapuzenpulli, die starr zu Boden blickt. Nadine Secunde singt sich mit Anstand, aber auch mit einiger Mühe in der Höhe durch die intensive Partie; an ihr, die als Einspringerin die B-Premiere übernahm, mag es mit liegen, dass der Eindruck des allzu Lauen und Unentschiedenen auf den Bildern des Abends lastet. Kusejs dezente Halbnackte, die sich erst als Dienerschar und schließlich als Internierte einer Irrenanstalt über die Bühne robben oder mit spastischen Bewegungen schleppen, gehören ebenfalls jenem mittleren Weg an, den der Regisseur gesucht und für sich gefunden hat.
Dass die neue Zürcher "Elektra" dennoch packend wirkt, liegt nicht zuletzt einfach daran, dass sich ihre Klänge und Strukturen zu einem zwingend durchorganisierten theatralischen Ganzen fügen. Christoph von Dohnányi am Pult des Opernorchesters formulierte die Schroffheiten der Partitur lustvoll aus, stellte den kantigen Glanz der Bläserakkorde gegen die weichen Reminiszenzen, welche die Streicher dem Agamemnon entgegenbringen. In dem engen, dunklen, nach hinten zu sich verjüngenden Kasten, den Ralf Glittenberg als Palast auf die Bühne gestellt hatte, konnten vor allem Melanie Diener als sehr klar und ausdrucksvoll gestaltende Chrysothemis und Marjana Lipovsek als gestenreiche und stimmlich erfreulich vitale Klytämnestra überzeugen.
Nach knapp zwei Stunden, die etwas kryptisch mit dem Auftritt einer brasilianischen Sambatruppe enden, war das Ganze dann vorbei. Die mittlere Dynamik des Beifalls entsprach dem Eindruck, den die Bilder des Abends zurückließen: Wer die Mitte wählt, kann offenbar auch einmal danebenliegen.
Susanne Benda
|

16. 12 2003
Blut, Tanz und Tod
Christoph von Dohnányi und Martin Kusej zeigen "Elektra" von Strauss in Zürich in klarsten Bildern als Mythos von erschreckender Gegenwärtigkeit.
KARL HARB
Elektra wartet. Sie wird den Mord an ihrem Vater Agamemnon rächen, den ihre Mutter Klytämnestra und ihr Buhle Aegisth verbrochen haben. Orest, ihr Bruder, soll ihr starker Arm sein. Als die Nachricht kommt, Orest sei tot, sucht sie selbst das Beil, um ihre Tat auszuführen, die Todeshalluzination in den realen Tod überzuführen.
Chrysothemis kneift. Elektras Schwester will ganz als Frau leben, einen Mann und Kinder kriegen. Zwischen dem Vorhof, wo Elektra lebt, und dem Palast der Angsttraum-Ausschweifungen ist Chrysothemis Botin, Mittlerin. Sie sieht mehr als ihre Schwester - und hat im entscheidenden Augenblick doch nicht die Kraft zur Tat.
Klytämnestra träumt. Sie hat Albtraumgesichte. Es verfolgt sie die begangene blutige Tat. Der Elektra-Realität kann sie nicht ins Auge sehen. Ihr bleibt verschlossen, was die zur Rache Entschlossene auszuführen gedenkt. Ihre Erlösung wä-re, wenn Orest wirklich tot wäre. Aber das ist irrwitzige Verkennung der Tatsache.
Denn Orest kommt. In Martin Kusejs Zürcher Neuinszenierung, die am Samstag Premiere hatte, erscheint er mit blonder Perücke, in Frauenkleidern über seinen eigenen. Erst im Erkennen wird er selbst erkennbar: der Tat-Mensch. Wer aber ist er? Nachdem er den Hof "gesäubert" hat, steht er im gleißenden Licht mit verzerrtem Gesicht, den Todes-Arm umkrampfend. Er steht mitten unter lauter lebenden Toten, starr und weiß. Weiß ist die Farbe des Todes.
Kusejs "Elektra"-Inszenierung handelt von Blut, Tanz und Tod. Graue, spitz nach hinten zulaufende Mauern mit einer Türenflut und schmalen Oberlichten begrenzen den Raum, dessen unebener, welliger Boden mit Filz bedeckt ist (Bühnenbild: Rolf Glittenberg). Hinter den (gepolsterten) Türen ist der Palast zu denken. Kaltes Neonlicht. Scharfe Lichtwechsel. Schlag-Lichter. Kusej erklärt nicht, psychologisiert nicht, moralisiert nicht. Er zeigt nur: die Ungeheuerlichkeit des Mythos. Dabei ist kein Tropfen Blut zu sehen, bis auf eine kleine, aber präzise Geste am Ende der Mägdeszene: Da putzt eine der Mägde mit einem blutigen Lappen kurz einen Türpfosten. Auch der Tanz, die Ekstase sind nur angedeutet. Surreal, als Traumvision a` la Brasil Tropical. Und der Tod ist nicht dunkel, sondern hell, kalt, weiß. So setzt Kusej seine Bilder: überwältigend in ihrer schlichten Genauigkeit, in grausamer, gnadenloser, analytischer Klarheit.
Das emotionale Zentrum ist die Musik
Das emotionale Ereignis liegt in der Musik. Im vergleichsweise kleinen Raum der Zürcher Oper schafft Christoph von Dohna`nyi ein Wunder aus kapitaler Energie, Klangdichte, Übersicht und fulminant geschärften Details. Er führt die Ereignisse der Partitur jederzeit am straffen Zügel, ohne dem Klang Fesseln anzulegen. Die Genauigkeit der Partiturauslegung begründet die große Geste - nicht umgekehrt; aufregend kühn und vom Orchester phänomenal gestaltet.
Am Tag der Premiere musste Janice Baird als Elektra einspringen. Der Outcast im lässigen Look mit Kapuzen-Shirt und Skaterhose (Kostüme: Heidi Hackl) passte ihr trotzdem wie angegossen. Ihre vokale Leistung war imponierend. Mit Melanie Dieners wunderbar fraulicher Chrysothemis harmonierte sie bravourös. Marjana Lipovsek hat man als Klytämnestra oft gesehen, aber vielleicht kaum je so erschreckend präsent: königlich und jämmerlich hilflos in einem, würdevoll und zerstört, hell und irr zugleich.
Die Männer spielen kaum eine Rolle, aber Jukka Rasilainen als Orest und Rudolf Schasching als Aegisth erfüllen ihre Partien momenthaft auf den Punkt genau und klar. Und beglaubigen mit allen anderen eine Aufführung, die den Mythos zeitlos vergegenwärtigt.
Frenetischer Jubel für alle. Zürich zeigt einen Strauss-Abend, der in solcher Intensität Salzburg seit langem fehlt.
|

17. 12. 2003
Elektra
By Shirley Apthorp
Frozen with rage, she waits. Janice Baird's Elektra is a still point of fury at the heart of a society rotten with depravity. The others, in their lace suspender belts and latex, barely seem to see her. But we do. In cargo pants and hooded jacket, she is androgynous, damaged, and consumed with focused anger. She hardly spares a glance for the palace revellers as they tumble, drugged and naked, between offstage orgies.
Martin Kusej's new Zurich Elektra is surprisingly true to the text. Yes, we see more naked flesh and knickers than strictly necessary, but it's all in the good cause of painting a context twisted enough to produce a daughter hell-bent on murderous revenge. We glimpse whips, handcuffs, lewd intentions.
Rolf Glittenberg's set is the lobby of some diabolical hotel where sadism, incest and suicide are on the menu. Essentially, though, Kusej tells the story a psychopathic mother (Marjana Lipovsek, both ghastly and wonderful), a dreamy sister (Melanie Diener, with lush, creamy phrases), a sinister yet seductive brother (Jukka Rasilainen makes a dark, velvet-toned Orest), and a truly repugnant stepfather in a claustrophobic world where awful things happen as a matter of course.
It was almost impossible on the opening night, to believe that Janice Baird had arrived that afternoon from Düsseldorf to take over from the indisposed Eva Johansson. Nothing in her taut, smouldering performance suggested that she had not spent the previous six weeks rehearsing with the rest of the cast. Even the voice, slight but well-managed, seemed perfect for the 1,200-seat house. Zurich can afford an Elektra with more technique than power. And Baird brought a new level of thrill to an already exciting evening.
But with Christoph von Dohnányi on the podium, how could this Elektra fail? His Strauss has the self-evidence of Mozart, each line clear and natural. With a minimum of fuss, he makes the most of the score's astringency, giving equal weight to brutality and tenderness. Sick, but superb.
|

