Aufführung
|

16. 10. 2004
(Première)
*
Musikalische Leitung: Nello Santi
Inszenierung: Grischa Asagaroff
Ausstattung: Reinhard von der Thannen
Choreographische Mitarbeit: Stefano Giannetti
Lichtgestaltung: Martin Gebhard
Einstudierung der Chöre: Jürg Hämmerli
*
Manon Lescaut: Sylvie Valayre
Des Grieux: Marcello Giordani
Lescaut: Cheyne Davidson
Geronte: Carlos Chausson
Edmondo: Boguslaw Bidzinski
Wirt: Reinhard Mayr
Madrigalsänger: Judith Schmid
Ballettmeister: Peter Keller
Lampenanzünder: Andreas Winkler
SYNOPSIS - LIBRETTO - HIGHLIGHTS
|
Rezensionen
|
|
|
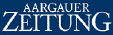
18. 10. 2004
Programmatische Unterkühltheit
Gruss von Sartre: «Manon Lescaut» am Opernhaus
TORBJÖRN BERGFLÖDT
Die Endlos-Weite? Ist klaustrophobisierend eng. Auf einem unendlich scheinenden Ödland spielt der vierte Akt im Originallibretto von Puccinis «Manon Lescaut». Der Regisseur Grischa Asagaroff und sein Ausstatter Reinhard von der Thannen haben nun in Zürich das dialektische Gegenteil imaginiert. Der variierte Einheitsraum, in dem sie das Vier-Stationen-Drama von Manon und ihrem Liebhaber Des Grieux ansiedeln, schliesst sich (noch mehr) zusammen. Die durch den ganzen Abend geschleppten schwarzen Koffer, Chiffren für Unbehaustheit und nomadisches Leben, mögen jetzt zu Sarg-Metaphern hinüberspielen. Aber halt! Als Manon wirklich stirbt, lassen Asagaroff und von der Thannen die Decke des geschlossenen Raumes hochfahren. Und auch, wie jene «Sonne» von Manons Schlussgesang, eine der Leuchten. In einem Bühnenfenster hinten erscheint nochmals die Kutsche aus dem ersten Akt.
Sartre und Beckett grüssen herein in diese Neuinszenierung am Zürcher Opernhaus, die der Gefahr von Sentimentalität bei Puccini mit einer programmatischen Unterkühltheit wehrt, die nicht Herzenskälte bedeutet, und mit einer ästhetischen Bebilderung, die sich nicht ans Geschmäcklerische verrät. Die Handlungszeit erscheint von der Rokokozeit ins beginnende 20. Jahrhundert verlegt. Die leerlaufenden Kutschenräder und eine sich drehende (Schiffs-)Schraube werden zu Sinnbildern für Stillstand in der Bewegung sowie das Räderwerk der Fortuna. Und immer formieren sich die Leute in dem Raum zu einer «geschlossenen Gesellschaft».
Italianità im Gefühlskern
Marcello Giordani hat die «amour fou» beim Studenten Des Grieux mit rückhaltlosem vokalem Engagement vergegenwärtigt, wobei der Tenor über eine veritable «Verismo-Gurgel» verfügt, die sich selbst noch gegen ein brausendes Orchestertutti zu behaupten vermag. Die Sopranistin Sylvie Valayre, die mit einem gleichfalls wunderbar strahlkräftig-raumfüllenden Organ wirkte, war, richtigerweise, keine psychologisch sich erklärende Manon, sondern eine Art von Elementarweib. Carlos Chausson gönnte Geronte, dem ältlichen Liebhaber auf Zeit, etwas französischen Puder. Manons Bruder Lescaut erschien bei Cheyne Davidson als geschwisterlicher Spielkomplize. Der von Jürg Hämmerli einstudierte Chor des Hauses bewies eindrückliche Schlagkraft. Santis Puccini atmete die Glut einer direkt auf den Gefühlskern zielenden Italianità und war doch gleichzeitig objektiv gebändigt, wobei das Orchester fallweise eine enorme Durchschlagskraft entwickeln konnte.
|

18. 10. 2004
Nur der Regisseur stört
Der Funke von Puccinis «Manon Lescaut» wollte nicht so recht springen. Einsamer Höhepunkt: der Liebestod am Ende. Premiere war am Samstag im Opernhaus Zürich.
Manon Lescaut» nach dem gleichnamigen Roman des Franzosen Abbé Prévost: Eine schöne Frau, im Clinch zwischen Liebe und Reichtum, entscheidet sich fürs Herz, wird wegen Unmoral eingesperrt, nach Amerika deportiert, Liebhaber folgt, am Ende Liebestod für beide.
Musikalisch steigert sich die Oper von Akt zu Akt. Im ersten Teil plätschert sie, gewinnt nach der Pause an Intensität und Tiefe. Besonders im letzten Akt, wenn die Titelheldin erkennt, dass ihre Liebe im Tod und nicht im Leben endet, geht Puccinis Musik echt unter die Haut. Da zeigen sich Sylvie Valayre als Manon und Marcello Giordani als Des Grieux auf der Höhe ihrer Aufgabe.
Problematisch ist das Regiekonzept von Grischa Asagaroff und Bühnenbildner Reinhard von der Thannen, die im Einheitsbühnenbild ein geschmäcklerisches Kostümfest veranstalten. Gipfel der Absurdität ist, dass die beiden Flüchtlinge in Koffern Wasser suchen und nur Kleider finden.
Am Dirigentenpult erweist sich Nello Santi als Meister der Dramatik und der intensiven Farben. Das Orchester macht es den Sängern auf der Bühne nicht leicht. Durchsetzen können sich nur die beiden Helden. Der italienische Tenor Marcello Giordani ist Weltklasse, der französischen Sopranistin Sylvie Valayre gelingt die Verzweiflung am Ende besser als die Naivität am Anfang.
Fazit: Lehrbuchfall für die These, dass Oper so schön sein könnte, wenn nur der Regisseur nicht ständig stören würde.
Roger Cahn
|

18. 10. 2004
Prostituierte auf dem Luxusdampfer
Con brio: Nello Santi macht am Opernhaus Zürich Puccinis «Manon Lescaut» zum aufregenden Ohrenschmaus
Tobias Gerosa
Herzlicher Applaus schon am Anfang, Jubel nach der Pause und nach dem Intermezzo: Nello Santi ist in Zürich ein Publikumsliebling – und wenn man hört, mit welcher stilistischen Sicherheit, welchem untrüglichen Sinn für Agogik und Rubato er das Opernhausorchester (mit ein paar exponierten Patzern) und seine Sänger jetzt durch die Partitur der «Manon Lescaut» führt, wird unmittelbar verständlich, warum. Santi versteht die Musik sinnlich aufrauschen zu lassen, nimmt sie aber immer wieder auch zurück ins Leise. Kein Verismo, sondern ein wirkliches «Dramma lirico» mit Wurzeln im Belcanto.
Sängerisch kann Marcello Giordani davon am meisten profitieren. Bei seinem Rollendebüt als Des Grieux stösst er zwar an dramatische Grenzen (und dies geht dann auch nicht ganz spurlos an den lyrischeren Passagen vorüber), doch er gestaltet die verzweifelte Liebe zu Manon musikalisch reich und überlegt, mit vielen Piani. Den jugendlich-ungestümen Liebhaber nimmt man ihm allerdings nur stimmlich ab, darstellerisch bleibt er eher reserviert. Das passt zum strengen grauen Anzug, den ihm Ausstatter Reinhard von der Thannen verpasst hat, zeigt aber auch, wie wenig Regie auf Personenführung verwendet wurde.
Ironie und Leichtigkeit
Regisseur Grischa Asagaroff verzichtet weitgehend auf eigene Ideen zum Stück, hat aber immerhin die Operngesten verhindert und gibt den Nebenfiguren und Chorszenen der ersten beiden Akte komödiantische Leichtigkeit. Wie auf einer Kontrastfolie erscheint die Liebe zwischen Manon und Des Grieux davor noch tragischer.
Geronte, der reichen Freier Manons, den Carlos Chausson mit bitterem Grimm und vollem Bariton spielt, gerät dabei prächtig nahe an die Karikatur. Allerdings ohne seine Gefährlichkeit zu verlieren. Cheyne Davidson als Manons ältlicher Bruder (eine undankbare Rolle) hingegen trägt nicht nur stimmlich zu wenig. Ironie, die vor allem in der Ausstattung dann und wann aufblitzt und zusammen mit dem eindrücklichen Bühnenbild für den optisch überzeugenden Rahmen der Aufführung sorgt, ist seine Stärke nicht.
Von der Thannen und Asagaroff verlegen die Geschichte in die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts. Kalt und hell ist die elegante Halle des Bühnenbildes, die an berühmte Fotos der New Yorker Central Station erinnert. Wie Buster Keaton kommt das Personal (der von Jürg Hämmerli gut vorbereitete Chor) des ersten Aktes daher. An Film lässt auch die Ankunft der Kutsche denken: Wie auf einer Leinwand rollt sie – unerreichbar – oben an der Rückwand ein. Später wird dort im selben Raum hochästhetisch ein Meer aus roten Lichtern die Glamourwelt des zweiten und eine bedrohliche Schiffsschraube den Hafen des dritten Aktes symbolisieren. Die Ästhetik kippt aber in Ästhetizismus (oder die Ironie in Zynismus), wenn das Schiff, das Manon und die andern verurteilten Prostituierten nach Amerika bringen soll, mit seinen strahlend weissen Matrosen und seiner gläsernen Freitreppe an einen Luxusliner erinnert. Mit dem schlichten vierten Akt wird dieser Ausrutscher jedoch rasch korrigiert.
Denn hier, im grossen, tragischen Schlussduett, lässt die Musik keine Ironie zu. Dafür wachsen die Ansprüche an die Titelfigur noch einmal. Sylvie Valayre bleibt ihr vokal einiges schuldig. Entschuldbar, denn eigentlich müsste man für die Rolle über mehrere Stimmen verfügen: eine mädchenhaft leichte für den Anfang und eine lyrisch-dramatische für die Fortsetzung. Problematisch ist, dass Valayres Sopran verbraucht klingt, schwer und vibratoreich und in den Spitzentönen steif und fahl. Ihr Gestaltungswille und ihre darstellerische Intensität helfen darüber hinweg. Das vokale Schweben auf der Melodie, das für Puccinis Primadonnen so typisch ist, gelang bei der Premiere aber nur im zweiten Akt.
|

18. 10. 2004
Lieben - Sterben in Verzweiflung
Kühle Ambiance für eine leidenschaftliche Liebe
Im Opernhaus Zürich glüht Puccinis «Manon Lescaut» in der Musik.
Herbert Büttiker
Als sich Puccini für den berühmten Romanstoff des Abbé Prévost entschied, sprach vieles gegen das Sujet. Seit ein paar Jahren machte Jules Massenets «Manon» Karriere, und die dramaturgische Mühe war gross: Nicht weniger als sechs Mitarbeiter mühten sich wechselnd um ein «italienisches»Libretto, bis das Werk 1893 an der Scala zur Aufführung gelangte. Aber es hatte eben sein müssen: Mit «Manon Lescaut» kam Puccini zu seinem Thema und zu seiner Musik der «passione disperata». An der Verstrickung des Chevaliers des Grieux und der wankelmütigen Manon entzündete sich seine musikalische Inspiration einer Musik der Leidenschaft und Verzweiflung, der entgrenzenden Gesangsmelodik und einer gereizten Klangsinnlichkeit des Orchesters. Vier Akte sind darauf hin angelegt und führen vom intimen Zauber der ersten Begegnung zur dramatischen Wiederbegegnung der im Pariser Salonluxus lebenden Dame mit dem Mann, den sie geliebt hat, und von der wiederum dramatischen Abschieds- und Vereinigungsszenerie im Hafen von Le Havre zur schliesslich wieder ganz intimen Sterbeszene der Manon in der amerikanischen Wüste.
Packendes Rollendebüt
Sängerisches Format im grossen Spannungsbogen ist da herausgefordert und zumal für die Darstellerin der Manon auch die Kunst, Gegensätzliches zu verbinden, Koketterie und Brillanz mit Wärme und Leidenschaft. Sylvie Valayres Sopran neigt zur Schwere, und der gar mädchenhaft-verschämte Auftritt verstärkt das Disparate ihres ersten Aktes. Mit der zunehmenden dramatischen Intensität, in der sich freilich auch stimmliche Ermüdungen bemerkbar machen, wächst ihre Figur in die letzte Szene und das «Sola, perduta, abbandonata» hinein. Geradlinig, impulsiv, mit tenoraler Strahlkraft, die heute wenig Konkurrenz zu scheuen hat, gestaltet Marcello Giordani den Des Grieux überlegen. Im Schluss des dritten Aktes kulminierte ein beeindruckend intensives Rollendebüt,das zweifellos und auch vom Publikum gefeiert das Ereignis dieser Premiere war.
So zentral die Arien- und Duettmomente das Werk tragen und so dominant Sopran und Tenor die Aufführung beherrschen: Puccini erweist sich schon in «Manon Lescaut» auch als grosser Szenenmaler. Die heitere Piazza-Stimmung im ersten Akt, der dünnblütige Rokoko-Zauber im zweiten, die Dumpfheit der Massenhysterie im dritten und die Unwirtlichkeit im vierten – das alles bedeutet nicht nur instrumentale Fülle, mit der das Orchester glänzt, sondern auch eine beachtliche Zahl von Figuren und Nebenfiguren. Die Zürcher Oper mobilisiert ein musikalisch überaus farbiges und sattelfestes Ensemble, angefangen beim Chor über markante Episodenfiguren (Judith Schmid als Musico, Peter Keller als Maestro di ballo, Andreas Winkler als Lampionaio etwa) bis zu den neben den Protagonisten wichtigen Handlungsträgern, zu denen Boguslaw Bidzinskis prägnanter Edmondo gehört, vor allem aber Cheyne Davidsons Lescaut – trotz pointiertem musikalischem Einsatz als Figur ein wenig blass – und Carlos Chaussons Geronte, der hier auf überzeugende Weise über die reine Karikatur der Dekadenz hinaus als glaubwürdige Figur erscheint.
Die Inszenierung verfährt mit all dem nicht nur glücklich. Grischa Asagaroff und sein Bühnen- und Kostümbildner Reinhard von der Thannen haben sich mit einigen Grundlagen ihrer Arbeit Steine in den Weg gelegt. Obwohl nur der zweite Akt in einem Innenraum spielt, haben sie sich für eine geschlossene Einheitsbühne mit hohen kassettierten Wänden, hochgelegten kleinen Fenstern und schmalen Türen und für eine Beleuchtung im kalten Neonlicht entschieden: ungeeignet für die Strassen- und Wüstenszenerie und am stimmigsten als Pariser Salon, wenn auch nicht des 18. Jahrhunderts. Die Kostüme verweisen auf die zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts – nicht die Zeit des jungen Puccini also, aber auch nicht konsequent die Zeit des arrivierten Liebhabers teurer Automobile: Manon entsteigt im ersten Akt einer aufwendig rekonstruierten Kutsche (die Opernhauszeitschrift widmet ihr eine Doppelseite). Amortisiert wird sie, wenn sie am Ende der Oper mit dubioser symbolischer Wirkung noch einmal sichtbar wird.
Sterben im Bühnenbild
Gerade diese Oper, die statt im romanhaften Zusammenhang der Handlung sprunghaft in einzelnen Momenten aufgeht, wäre umso mehr auf die Plausibilität des Augenblicks angewiesen, und plausibel wirkt zu vieles nicht, angefangen bei den flanierenden Studenten und Bürgern, die sich mit ihren Koffern hier offenbar in einem Wartesaal auf den Füssen herumstehen, und aufgehört bei der Frage, an welchem verteufelten Ort sich Manon und Des Grieux wohl befinden, wo zwar die Neonleuchtkörper noch strahlen, aber kein Tropfen Wasser aufzutreiben ist.
Statt vor dem weiten Wüstenhorizont ein Sterben im Bühnenbild: Das bedeutet, dass die Inszenierung zur Eindrücklichkeit von Puccinis «passione disperata» nicht sehr viel beiträgt. Was die Aufführung aber diesbezüglich insgesamt leistet, ist fesselnd genug – auch dank Nello Santis Dirigat. Zwar nimmt seine Neigung, lyrische Tempi breit zu nehmen und mit ausgekosteten Ritardandi zusätzlich zu verlangsamen, dieser Musik einiges von ihrem jugendlich drängenden Atem. Wo expressive Spannung die Wirkung sein könnte, kommt sie jetzt aus der Schwere – ein altes ist mittlerweile zum Altersphänomen des Maestros geworden. womit er auch deshalb für sich spricht, weil er andererseits Puccinis Brillanz und Verve temperamentvoll angeht wie eh und je.
|

18. 10. 2004
Der Protagonist am Pult
Puccinis «Manon Lescaut» im Opernhaus Zürich
Vor vierundvierzig Jahren hatte Nello Santi Giacomo Puccinis frühe Oper «Manon Lescaut» erstmals im Opernhaus Zürich dirigiert. Welche Reife hat unterdessen seine Sicht auf diese gar nicht einfache Partitur erlangt! Sie sind da, all die grossen Gefühle, welche diese Oper tragen und die manchmal leicht ins Rührselige kippen könnten; Santi dosiert sie heute so genau, dass man atemlos zuhört. Er mischt Puccinis raffinierte Orchesterfarben beeindruckend schön, vor allem aber hat sein Dirigieren einen Atem, ein Gespür für die je eigenen Zeitverläufe in den verschiedenen musikalischen Schichten, ein unvergleichliches Timing. Die kleinen Brüche, welche die Partitur durch ihre doch etwas verwickelte Entstehungsgeschichte aufweist, kann er einen souverän vergessen machen. Santis «Manon» hat Italianità und gleichzeitig Abgeklärtheit. Wunderbar, wie er die Stimmen führt, ihnen Raum gibt und wie er das Orchester der Oper Zürich zu einer Höchstleistung motiviert. Nello Santi ist der heimliche Star der Zürcher Neuinszenierung von «Manon Lescaut», er machte den Premierenabend zum Ereignis.
Vier Stationen der tragischen Liebe einer ambivalenten Frauenfigur, Manon, und des für diese zu allem bereiten Cavaliere Renato Des Grieux werden in dieser Oper gezeigt, vier Fluchtsituationen. Manon, hin - und her gerissen zwischen ihrer Liebe zu Des Grieux und dem gierigen Verlangen nach dem Reichtum des alten Lebemannes Geronte, ist einem nicht immer sympathisch. Sylvie Valayre unterstreicht dies vor allem im zweiten Akt mit leicht geschärftem Timbre und einer eher etwas unterkühlten, beinahe monochromen Gestaltung ihrer Rolle. Man fragt sich manchmal, warum Des Grieux ihr verfallen ist. Doch dann, im dritten und vierten Akt, wird Valayre auch warm, gestaltet mit Farben und differenzierterem Ausdruck, und man glaubt ihr schliesslich die Entwicklung, die sie über die vier Stationen vom jungen, unerfahrenen Mädchen bis zur sterbenden, sich endlich ihrer Liebe bewusst werdenden Frau durchmacht. Man glaubt es ihr auch, weil ihr Geliebter, Des Grieux, in Marcello Giordani einen Interpreten hat, der sich mit Leib und Seele in seine Rolle hineingibt und sich mit ihr identifiziert. Von ihm kommen die grossen Emotionen, und er stattet sie mit ergreifenden tenoralen Farben aus.
Der alternde Geronte, der sich Manon gleichsam als Vorzeige-Kurtisane hält und sie mit seinem Reichtum und seiner Verehrung überhäuft, um sie sogleich dem Richter zu überantworten, als er sie beim Stelldichein mit Des Grieux erwischt, Geronte ist bei Carlos Chausson und seinem wunderbar kräftigen Bass bestens aufgehoben. Ist es ein Zufall, dass er etwas an Salvador Dalí erinnert? Dieser etwas absurd wirkende, geckenhafte Alte in seiner herausgeputzten Paradiesvogel-Welt? Der Spieler im Hintergrund, der zwischen Manipuliertwerden und Manipulieren schwankt und der zeitweise massiv von Manons Lebensumständen profitiert, ist ihr Bruder Lescaut, der von Cheyne Davidson in seiner ganzen etwas zwielichtigen Art ausgezeichnet verkörpert wird.
Diese erste Zürcher Neuinszenierung von «Manon Lescaut» seit mehr als einem Vierteljahrhundert stammt von Grischa Asagaroff (Regie) und Reinhard von der Thannen (Bühnenbild/ Kostüme). Sie placieren das Geschehen behutsam im frühen zwanzigsten Jahrhundert, geben der Bühne eine konstante Grundstruktur. Einige leicht surreale Elemente, einige unaufdringliche Zitate tauchen auf. Aber es geht Asagaroff nie darum, etwas in die Geschichte hineinzuprojizieren, das nicht oder höchstens als Subtext-Interpretation da ist. Er erzählt sie einfach, so gut und phantasievoll wie möglich. Und er sorgt dafür, dass die Sängerin und die Sänger bei ihren grossen vokalen Auftritten sich vorne auf der Bühne befinden und sich kaum mehr bewegen müssen. Dennoch gelingt es ihm, gerade bei solchen Momenten das Geschehen im Hintergrund mit dem Chor und den Statisten wirkungsvoll so zu beleben, dass nie Langeweile aufkommt.
Da hilft ihm die Bühne enorm. Denn von der Thannen hat hinten über der eigentlichen Bühne gleichsam einen zweiten Guckkasten geschaffen. Die Kutsche im ersten Akt steht da, beleuchtet wie ein Scherenschnitt. Wie auch der ganze erste Akt - er ist in einer Art Wartsaal mit Café angesiedelt - fast nur in mitunter grotesk eingesetztem Schwarz und Weiss gestaltet ist. Wie wirkungsvoll, wenn die Damen plötzlich ihre schwarzen Mäntel ausziehen und kräftige Farben auftauchen! Heftig ist, bei gleich bleibender Struktur des Bildes, der Farbkontrast im zweiten Akt: Regenbogenfarben dominieren, und im Guckkasten wird der Vortrag von Gerontes Madrigal durch den «Musico» (Judith Schmid) von einem seltsamen Ballett begleitet. Beklemmend dann das Licht, das im dritten Akt durch einen riesigen Ventilator auf der Hinterbühne hindurch auf die Gefängnisszene geworfen wird, und plötzlich mutiert der Ventilator zum Rad des bereitstehenden Dampfers im Hafen. Solche Abstraktionen und Transformationen beleben das optische Geschehen raffiniert. Eine Inszenierung also, die ihre Qualitäten hat, die aber vor allem auch hilft, zu hören, und das ist, denkt man an Santis Dirigieren, besonders wertvoll.
Alfred Zimmerlin
|

18. 10. 2004
Manierismus in Schwarz-Weiss
«Manon Lescaut» ringt im Zürcher Opernhaus um das grosse Gefühl.
Gänsehaut gab es bei der Premiere aber selten.
Von Michael Eidenbenz
«Ich empfinde die kleinen Dinge, und nur sie liebe ich zu behandeln. So gefiel mir Manon, weil sie ein Mädchen von Herz war und nicht mehr.» Mit solchen Worten begründete Giacomo Puccini seine Wahl für eine ins Kleinbürgerliche versetzte Femme fatale, für jene Kurtisane, die Abbé Prevost 1731 in die Literaturwelt gesetzt hatte. Man hat aus seiner Neigung zu den kleinen Dingen, zu den kleinen Leuten schon versucht, Tendenzen zu psychologischem und sozialem Realismus zu erkennen. Was «Manon Lescaut» betrifft, den ersten anhaltenden Erfolg für den 35-jährigen Komponisten, wäre freilich nichts falscher als dies.
Alles andere als realistische Charaktere mit ihren ambivalenten und widersprüchlichen Aspekten hat seine Musik hier im Sinn. Vielmehr schleift sie alle Charakternuancen so lange ab, bis als Kern bloss das Gefühl an sich übrig bleibt, vorzugsweise der Liebes-, Abschieds- oder Todesschmerz. Wenn sich Singstimme und Orchester im Unisono vereinigen und zusammen mit den Herzen des Publikums dem einen, einzigen melodischen Moment folgen, dann ist jeweils die Kulmination erreicht. Dann gelangt Puccinis fiebriges Streben nach der puren Emotion an ihr Ziel, dann gibt es nichts mehr zu denken, zu relativieren oder zu differenzieren, dann hat sich die Musik von der Welt gelöst. Das Ergebnis ist schliesslich nicht die Darstellung von Menschen, sondern Manierismus. Zum Beispiel: Der junge Liebhaber Des Grieux hat seine Manon aus den Händen der Soldaten zu befreien, zückt einen Revolver, doch im nächsten Moment entscheidet er sich fürs Flehen um Mitleid. Aggressivität schlägt in Wehleidigkeit um, ein eigentlich aufschlussreicher psychologischer Vorgang. Doch Puccini zieht übergangs- und hemmungslos sofort sämtliche Tränenregister, die Folge ist mit der Tenorarie «No! Pazzo son» ein weiterer Höhepunkt der emotionalen Temperatur.
Elastische Melodik
Diesem Suchen nach den Höhepunkten dient Puccinis ganzes Repertoire an melodischen, farblichen und harmonischen Mitteln bis hin zum Tristan-Zitat, das so üppig ist, dass später Generationen von Filmkomponisten davon noch profitieren konnten. Nicht in jedem dieser Momente sprang bei der Premiere am Samstag der Funke, obwohl in Zürich Stimmen zur Verfügung stehen, die dem geforderten Kraftaufwand und der zweckenthobenen Emotionalität gewachsen sind. Marcello Giordani etwa: Sein geschmeidiger strahlender Klang blüht kraftvoll auf in Puccinis elastischer Melodik, und er verkörpert in nuce, was Puccini von ihm verlangt: einen Tenor. Sylvie Valayre als Manon hält mit. Auch sie stürzt sich mit viel vokaler Intensität in den Strudel der Gefühle, der sich nicht mehr um die psychischen Details einer zwischen Verliebtheit und Luxuslust hin und her gerissenen Kurtisane kümmern kann. Mit gewohnter Souveränität lenkt Dirigent Nello Santi Puccinis musikalische Luxuslimousine durch sämtliche agogischen Kurven und sorgt dafür, dass das erzählende Vorspiel zum dritten Akt zu einem weiteren Höhepunkt des Abends wird.
Schliesslich galt es aber auch, die Gefühle in Bilder und Kostüme einzukleiden. Regisseur Grischa Asagaroff und Ausstatter Reinhard von der Thannen haben sich fürs grosse Schwarze entschieden. Schwarz-weiss ist das Dekor in allen Akten, zu Beginn deuten einige Spektralfarben in Kostümen und Licht noch einen Rest von buntem Leben an. Historisch wird die Geschichte in Puccinis Zeit lokalisiert, einige symbolische Elemente sorgen für etwas Abstraktion (wie etwa die vielen Koffer, die als Hinweis auf künftige Fluchten und Reisen im ersten Bild herumstehen). Der Bühnenhintergrund wird für illustrierende Accessoires genutzt für eine Kutsche als Fluchtfahrzeug im ersten Akt; für ein allegorisches Ballett bei der musikalischen Unterhaltung im Hause Gerontes, Manons reichem Liebhaber, im zweiten Akt; für eine stilisierte Schiffsschraube, die auf die Deportation nach Amerika im dritten Akt hinweist.
So weit ein stimmiges innenarchitektonisches Design, in dem man sich ein wenig wie auf einer leicht hysterischen Kostümparty fühlt: Alle tun, als ob. Und unvermeidlich leistet sich die Party auch einen Schuss Tuntigkeit. Peter Keller hat einen scharwenzelnden Tanzlehrer zu verkörpern, Judith Schmid einen aufgetakelten Musiker, einige Studenten im ersten und einige Prostituierten im dritten Akt dürfen sich im Crossdress präsentieren. Auch Carlos Chausson muss mit gewohntem Schauspieltalent seinen reichen Geronte im Glanzglitzerkleid absolvieren, während Cheyne Davidson als Lescaut und Boguslaw Bidzinski als Edmondo trotz vokaler Kompetenz eher blass bleiben.
Der Schluss ist ein Problem. Bizarrerweise lässt das Libretto die Liebenden irgendwo in einer Wüste bei New Orleans stranden. In Zürich verdurstet Manon im Raum des ersten Akts, die Kutsche scheint noch einmal als Reminiszenz an bessere Zeiten auf, Des Grieux schwankt derweil händeringend über den Ort des Desasters. Eine Lösung, die der Schablonenhaftigkeit der Figuren auch nicht weiteres Leben einhauchen kann. Viel emotionales Drängen in polierter Hülle, wenig Gänsehaut. Das Publikum zeigte sich freundlich angetan.
|

18. 10. 2004
Klischee mit der Musik wettgemacht
Das Opernhaus Zürich feierte am Samstag Premiere mit Giacomo Puccinis «Manon Lescaut»
Es sind zwei berüchtigte und gefürchtete Partien, der «Des Grieux» und die «Manon Lescaut» in der gleichnamigen Oper von Giacomo Puccini. Die Premiere der klischeehaft gestylten Inszenierung von Grischa Asagaroff ging am Samstag im Opernhaus Zürich über die Bühne.
Marcello Giordani, der Tenor mit sizilianischer Glut, sorgte an der Zürcher Premiere vom Samstag mit seinem beeindruckenden «Des Grieux»-Debüt für Furore. Auch Sylvie Valayre zeigte sich der monströsen Manon-Lescaut-Partie bravourös gewachsen. In der klischeehaft gestylten Inszenierung von Grischa Asagaroff sorgte Altmeister Nello Santi mit dem Opernorchester für echten Schmelz und ergreifende Leidenschaft.
Französisches Sujet mit italienischem Blickwinkel
Die «Manon Lescaut» ist, geht man auf die Erzählung von Abbé Prévost von 1731 zurück, ein französisches Sujet. Und nur einige Jahre vor Puccini hatte Jules Massenet mit seiner «Manon» in Frankreich grossen Erfolg gefeiert. Giacomo Puccini verstand es aber, die Frauengestalt von einem anderen, eben italienischen Blickwinkel aus zu betrachten. Er beschränkte sich auf die entscheidenden Schlüsselstellen der Geschichte und komponierte mit seinem dramaturgischen Sinn und seiner Instrumentierungskunst ein Gefühlsge- mälde, das ihm als Opernkomponisten den Durchbruch brachte.
Doch was wäre diese simple und sehr klischeehafte Frauengeschichte ohne diese Musik. Manon Lescaut wird auf der Fahrt ins Kloster vom Bruder begleitet. Auf einem Zwischenhalt trifft sie auf den Studenten Des Grieux, der sich sofort in sie verliebt. Und sie beschliessen auch von einer Sekunde auf die andere, gemeinsam nach Paris zu fliehen. Das nächste Bild zeigt Manon in Paris, wo sie von ihrem Bruder mit dem reichen alten Geronte verheiratet wurde. Ihr Liebhaber Des Grieux, mit dem sie ja geflohen ist, leidet schrecklich. In diesem zweiten Akt vollbringt Sylvie Valayre ihre grandiose Meisterleistung. Zuerst die puppenhafte Tanzstunde beim karikierten Tanzlehrer (Peter Keller), welcher Ehemann Geronte mit nobler Gunst zuschaut. Und gleich danach der heimliche Besuch von Des Grieux.
In dem Moment als er auftrat, wechselte Valayre ihre Ausdruckshaltung schlagartig: sie zeigte echte Gefühle, kam aus sich heraus, bat um Verzeihung und beschwörte die Liebe. Unerhört, was da musikalisch aufbrach, was diese Sängerin im Wechsel zwischen Dramatik und Lyrik an Authentizität und Kraft zulegte - einer der grossen Momente dieses Abends.
Klischee im Vordergrund
Man hatte sich bis dahin aber auch in der ausgesprochen ästhetizistischen und mit den gestylten Kostümen von Reinhard von der Thannen stereotyp überzeichneten Regie von Grischa Asagaroff nach etwas Echtem gesehnt. Der Auftritt der naiven und scheuen Manon, die ins Kloster fahren will, wird eins zu eins dargestellt. Nichts Hintergründiges lässt sich da erahnen, die ganze Situation unter den in ihren grauen Anzügen und schwarz-weiss getupften Krawatten «lackiert» wirkenden Studenten bedient nur das Klischee von der reinen, aber auch puppenhaften Naiven. Das dunkle erotische Timbre von Valayres Stimme entglitt hier zu einem schweren und unpassenden Vibrato.
Asagaroff ist ein solider Handwerker unter den Regisseuren, der die glitzernde Ästhetik der Opernwelt liebt und gerne ins Gestylte überhöht. Es fehlt jedoch an der Inspiration, die diese Geschichte neu erzählt, die aus dem Stoff etwas macht. Was hier auf der Bühne passiert, ist einfach, wie es ist. Es spielt sich alles im grauen Einheitsbühnenbild ab, im kalten Licht zweier grosser Neonlampen-Lüster. Im Hintergrund werden erhöht - wie auf einer Kinoleinwand - eine echte fahrende Kutsche und choreografische Einlagen gezeigt.
Und inmitten dieser unterkühlten Ästhetik Marcello Giordani als armer Student Des Grieux. Er ist natürlich, wie alle, im grauen Anzug elegant gekleidet, aber er glühte in dieser durchgestylten Welt aus allen heraus. Giordani sang sein Herz aus der Seele, kämpfte um seine Liebe, seine Gefühle, seine Hoffnung und gestaltete das alles mit lyrischer Intensität, Wärme und agiler Kraft. Manon, die von ihrem Gatten, den sie betrügt, verstossen und eingekerkert wurde, begleitet er in ihre Verbannung nach Übersee, nach Amerika. Und dort befreit er sie erneut, wird dabei zum Mörder und flieht mit ihr in die Wüste, wo sie erschöpft verdurstet und stirbt.
Hochkarätige Sängerbesetzung
Bei Asagaroff ist auch die Wüste grau, die Decke hängt tief, einer der Neonlüster liegt am Boden - man könnte in einem Kerker sein. Nicht aber im mörderisch gleissenden Sonnenlicht der endlosen Wüste. Kommt dazu, dass Manon im hochgeschlossenen weissen - und ebenso reinen - Seidenkleid den physischen und psychischen Erschöpfungstod stirbt - kein Anzeichen von Staub, von Schweiss, von Hitze, auch beim perfekt gebügelten Anzug von Des Grieux nicht. Doch wie die beiden Protagonisten diese Ausweglosigkeit sangen, das war an der Premiere von bezwingender Dramatik, von inniger Liebe und verzweifeltem Lebenskampf.
Die Inszenierung wird durchwegs von der hochkarätigen Sängerbesetzung und von der souveränen musikalischen Gestaltungskraft aus dem Orchestergraben getragen. Carlos Chausson gab einen noblen Geronte, der seine geschmeidige Stimme vielleicht etwas gar gepflegt führte. Als Bruder Lescaut gestaltete der Amerikaner Cheyne Davidson ein Rollendebüt von schlichter Grösse, dessen schattenhafte Präsenz auch stimmlich überzeugte.
Und auch der Edmondo erhielt im Rollendebüt von Boguslaw Bidzinski einen sehr lyrischen und sanften Ton. Nello Santi sorgte jedoch dafür, dass Puccinis verführerische Klänge auch eine strenge rhythmische Härte erfuhren. Und die fliessenden Übergänge gelangen dank des hoch präsenten Orchesters mit dramaturgischer Ballkraft und hintergründiger Sehnsucht.
Sibylle Ehrismann
|
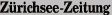
18. 10. 2004
Raffinement statt Sentiment
Neuinszenierung von Giacomo Puccinis «Manon Lescaut» am Opernhaus
Pointiert ästhetisch wirkt hier alles, vor allem aber Bühnenraum und Kostümzauber. Grischa Asagaroff inszeniert mit leichter Hand, als würde die Handlung sich ihre Spielanordnungen gleich selber vorgeben. Und Nello Santi sorgt im Orchestergraben für eine Puccini-Sternstunde.
WERNER PFISTER
Wohl würde er heute staunen, der Weltgeistliche Antoine François Prévost d'ExiIes. Staunen, dass sich kaum einer mehr durch die einst so trendsettigen sieben Bände seiner «Mémoires et aventures d'un homme de qualité» lesend hindurchquält - auch nicht durch den siebten Band, der den Roman «Les Amours du chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut» enthält, einst ein entscheidender Wegbereiter der französischen literarischen Empfindsamkeit und als solcher eine perfekte Bilderbuchgeschichte.
Das Bild - genauer gesagt: das Bild, als es endlich laufen gelernt hatte - nahm sich der Manon-Geschichte denn auch erfolgreich an. Und darüber würde Prévost noch mehr staunen: wie im Jahr 1949 der Filmregisseur Henri-Georges Clouzot die blonde Cécile Aubry im Film «Manon» in die ferne, trockene Wüste geschickt hatte, wo sie in den Armen ihres Liebhabers verdurstend ihre schöne Seele aushauchte (und dafür mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet wurde). 1968 doppelte der Filmregisseur Jean Aurel mit seinem. Streifen «Manon 70» nach - diesmal mit der unvergesslichen Cathérine Deneuve.
Reine Leidenschaft
In der deutschsprachigen Version übrigens hiess dieser Film «Hemmungslose Manon», was uns der Sache, respektive der unverwüstlichen Brisanz dieser Story, entschieden näher bringt. Denn auch die Opernkomponisten liessen sich wiederholt von ihr anstecken. Zuerst Daniel François Esprit Auber mit seiner 1856 uraufgeführten «Manon», 1884 dann Jules Massenet, ebenfalls mit einer «Manon», und 1893 schliesslich Giacomo Puccini mit seiner in Turin uraufgeführten «Manon Lescaut». Die Gefahr einer lähmenden Konkurrenz wusste Puccini indes geschickt zu umgehen: «Massenet empfindet als Franzose, mit Puder und Menuetten. Ich empfinde als Italiener, mit einer tiefen Verzweiflung.»
Damit ist ein wichtiges Stichwort auch für die Neuinszenierung am Opernhaus gegeben. Mit dem einheitlichen Grundraum, den Reinhard von der Thannen für sein Bühnenbild konzipiert hat, löst er das aktuelle Bühnengeschehen von seinen örtlichen, seinen historischen Bedingtheiten los und verlegt es in einen symbolischen Raum, wo reine Leidenschaften den Ton (oder die Koordinaten) angeben.
Im ersten Akt wähnt man sich in die Wartehalle eines Bahnhofs versetzt; im zweiten ist es ein Pariser Salon in klinischem Design, im dritten lösen sich gar die Grenzen zwischen Aussen- und Innenraum auf, und im vierten Akt, ein hügeliges Gelände an der Grenze zu New Orleans (das in Wirklichkeit eh nicht existiert), scheinen sich alle räumlichen Bedingtheiten aufzulösen. Entgrenzung heisst hier das Stichwort, und in der Tat geht es um die Auflösung menschlichen Daseins, um den Tod.
Das alles wird ebenso schlüssig wie unaufdringlich ins Bild gebracht und mit wenigen Requisiten bedeutungsvoll belebt. Mit schwarzen Koffern etwa, die in jedem Bühnenbild da stehen und auf die Unbehaustheit jener Menschen verweisen, die ausschliesslich ihrer Leidenschaft leben: Manon und Des Grieux, Aussenseiter in einer selbstherrlichen Gesellschaft, die vordergründig auf das Ideal einer enthaltsamen Moral setzt (und hintergründig also auf Doppelmoral). Gleichsam eine «kostümierte» Gesellschaft also, und Reinhard von der Thannen lässt mit seinen kunstvoll überhöhten Kostümen keinen Zweifel daran, dass es Kleider sind, welche Leute machen.
Triumph für Nello Santi
Kleider aus der Jahrhundertwende, der vorletzten, sowie aus den zwanziger Jahren: Das Spiel findet zur Entstehungszeit der Oper statt, von Grischa Asagaroff mit sicherer Hand zu lebendiger Bewegtheit gebracht. Da darf der Chor in lauter Ausgelassenheit schon mal schunkeln. Auch Klischees werden bedient: Der Friseur agiert so, wie man sich in der Provinz eine exaltierte Schwuchtel vorstellen
mag - provinzielles Theater dann. Dasselbe wiederholt sich beim Auftritt des Tanzlehrers im zweiten Akt, sichtlich zum schmunzelnden Vergnügen des Publikums. Dass darob die beklemmende Atmosphäre dieses Aktes, das Ausgeliefertsein Manons an einen von Geld für Liebe diktierten Lebenswandel, ihre Abgründigkeit verliert, muss man in Kauf nehmen.
Musikalisch gerät die Aufführung zu einem grossen Triumph für den Dirigenten Nello Santi: seit seinem ersten Dirigat 1958 am Opernhaus die dritte Neuinszenierung von Puccinis «Manon Lescaut», die er betreut. Bedächtiger sind seine Tempi seither geworden, das aber mit Bedacht: Anstelle von Sentiment waltet Raffinement. Unter seiner kundigen Hand verleihen die kraftvollen, aber nie blendend grellen Klangfarben der Musik Puccinis Glanz und Poesie. Mühelos gelingt es ihm, die musikdramatische Grossarchitektur des Werks im Blick zu behalten und gleichzeitig sein Augenmerk auf das mit Sorgfalt und purer Klangschönheit ausformulierte Detail zu richten. Der Chor des Opernhauses ist stimmlich bei bester Laune, und das Orchester der Oper Zürich arbeitet mit einer derart impulsiven Hingabe an den zuweilen geradezu impressionistischen Stimmungsvaleurs, dass die Musik einen unwiderstehlichen Sog entwickelt.
Dieser verstärkt sich noch, wenn Marcello Giordani singt: sein erster Des Grieux überhaupt. Bewundernswert der stimmliche Glanz bis hinauf in die exponierten Spitzentöne, bewundernswert auch die ganz dem Fluss der Sprache nachempfundene Artikulation, welche seinem Gesang Leben und Farbigkeit verleiht. Genau das vermisst man bei Sylvie Valayre: Ihre Manon klingt, vor allem zu Beginn der Oper, stellenweise mulmig, und der Glanz ihres Timbres hat hörbar Kratzer abbekommen, was sich vor allem im Pianobereich bemerkbar macht. Umgekehrt gelingt es ihr flamos, die Entwicklung der Manon vom behüteten, ungelenken Mädchen zu einer von purer Leidenschaft getriebenen Frau darstellerisch ins Spiel zu bringen.
Die mittleren und kleineren Rolle sind allesamt stimmig besetzt: Carlo Chausson als geil-gieriger Geronte, Cheyne Davidson als Manons Bruder, hin und her gerissen zwischen dem eigenen Schicksal und demjenigen seiner Schwester. Judith Schmid singt den Musiker mit madrigalesker Eleganz (und bewegt sich auch so); Boguslaw Bidzinski verleiht dem Edmondo schwärmerische Züge. Und Peter Keller als Tanzlehrer mimt - wie schon angedeutet - mit beredter Beinarbeit einen auf-(oder ab-)getakelten Ballerino, der vermutlich nie bessere Tage gesehen hat.
|