|
Aufführung
|

2. 5. 2004
(Première)
*
Musikalische Leitung: Michel Plasson
Inszenierung: Reto Nickler
Bühnenbild: Hermann Feuchter
Kostüme: Katharina Weissenborn
Lichtgestaltung: Jürgen Hoffmann
Chor: Jürg Hämmerli
*
Marquis de la Force: Cheyne Davidson
Blanche: Isabel Rey
Der Chevalier: Reinaldo Macias
Madame de Croissy: Felicity Palmer
Madame Lidoine: Juliette Galstian
Mère Marie de l'Incarnation: Stefania Kaluza
Soeur Constance: Christiane Kohl
Mère Jeanne: Katharina Peetz
Mère Mathilde: Irène Friedli
In weiteren Rollen:
Gabriel Bermúdez
Burles
James Cleverton
Peter Kálmán
Horst Lamnek
Giuseppe Scorsin
Martin Zysset
SYNOPSIS - LIBRETTO
|
|
Rezensionen
|
|
|
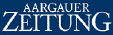
4. 5. 2004
Glaubensmutig aufs Schafott
Dialogoper Poulenc-Erstaufführung am Opernhaus Zürich
Torbjörn Bergflödt
Was tun mit einer französischsprachigen Oper, die ihr Schwergewicht im erörternden Gespräch unter den Figuren hat? Der Regisseur Reto Nickler und sein Bühnenbildner Hermann Feuchter haben das schon im Werktitel angekündigte dialogische Prinzip in den «Dialogues des Carmélites» nicht verdrängt oder gar verleugnet.
Für die erstmalige Inszenierung von Francis Poulencs Dreiakter am Opernhaus Zürich haben sie es vielmehr regelrecht umarmt: Projektionen der wichtigsten Textabschnitte in deutscher Übersetzung auf wechselnde Flächen bilden einen prominenten Bestandteil des Bühnendekors. Der mit Packpapier und Klebband wie improvisiert ausgekleidete Raum samt Kulissen ist denkbar unkulinarisch und durchaus gewöhnungsbedürftig - aber wird vielfältig genutzt. Für (weitere) Verfremdungseffekte sorgen Bühnenarbeiter, die kleinere Umbauten verrichten, und ein Souffleur, der vorne rechts und gut vernehmlich seinen Dienst tut.
Starke Darstellerinnen
Die Handlung spielt in Paris und in Compiègne in den Jahren 1789 bis 1794. Die junge Blanche, seit frühster Kindheit an Panikanfällen leidend, sucht ihr Heil in einer Klostergemeinschaft. Im Zuge eines Dekrets zur Aufhebung aller Klöster legen die Karmeliterinnen einen Märtyrereid ab und steigen singend aufs Schafott. Als Letzte auch Blanche, die ihre Angst im christlich-katholischen Glauben überwunden hat. Das vom Komponisten erstellte Libretto der 1957 uraufgeführten Oper geht zurück auf ein Filmskript beziehungsweise ein Stück von Georges Bernanos (1947), das seinerseits die Novelle «Die Letzte am Schafott» (1931) von Gertrud von Le Fort beerbt.
Katharina Weissenborns Kostüme stehen in chiffrierter Form für Rokoko- oder Klosterwelt oder verweisen auf die Brutalität jedweder Revolution. In der sorgfältig ausgestalteten Personenführung Nicklers und unter der musikalischen Leitung von Michel Plasson sind starke singdarstellerische Leistungen herangewachsen. So wurden an der Premiere die Todesängste der (nicht unter der Guillotine) sterbenden alten Priorin von Felicity Palmer mit bohrender Intensität glaubhaft gemacht. Isabel Rey brachte die existenzielle Geworfenheit der Blanche über die Rampe und Christiane Kohl die frohgemute Glaubenszuversicht der Schwester Konstanze. Eindrücklich auch Stefania Kaluza als prinzipientreue «Mère Marie» und Juliette Galstian in der Rolle der neuen Priorin. Jürg Hämmerli hat die Chorpartien sauber einstudiert.
Singendes Sprechen: Dass Poulenc seine Partitur unter anderen Monteverdi dedizierte, wird auch hörbar. Anderes gemahnt an Mussorgski, einen weiteren Widmungsträger. Schwächelnder Eklektizismus allerdings ist nicht auszumachen. Unter Plasson hörte man im Graben den breiten Radius im Orchesterpart aus von der «keusch»-zarten Durchsichtigkeit bis zum zufahrenden Tutti-Schlag.
|

4. 5. 2004
Die Gefahr der Guillotine lauert überall
Die Nonnen singen «Salve regina», steigen aufs Schafott, und aus dem Orchester saust das Fallbeil nieder. Sphärische Musik verklärt die Szene. Starker Schluss. Lang anhaltender Applaus. «Dialogues des Carmélites» hatte am Sonntag Premiere im Opernhaus Zürich.
«Dialogues des Carmélites» von Francis Poulenc spielt während der Französischen Revolution und berichtet von 16 Nonnen, die für ihren Glauben kämpfen und sterben.
Der französische Komponist Francis Poulenc (1899 - 1963) schrieb das Libretto nach dem Drama«Dialogues des Carmélites» seines katholischen Gesinnungsfreundes Georges Bernanos (1888 - 1948). Uraufgeführt wurde die Oper 1951 unter dem deutschen Titel «Die begnadete Angst» am Zürcher Schauspielhaus.
Anfänglich oratorienhaft-statisch, steigert sich die Oper zu intensiver Spannung. Die melodiöse, stellenweise an Filmmusik anklingende Tonsprache trägt die Handlung.
Die Hauptlast des Abends liegt auf den Schultern des Dirigenten Michel Plasson. Er lotet alle Facetten dieser zutiefst französischen Musik aus, schwelgt mit dem hervorragend mitspielenden Orchester, lässt den Stimmen den nötigen Freiraum und hält dabei die Spannung.
Das Regieteam hat da keine Chance. Die allgegenwärtigen Karton-Guillotinen verlieren an Wirkung, die schäbige Bühne funktioniert für die ständig wechselnden Schauplätze, ist aber unästhetisch. Die Figuren werden von Regisseur Reto Nickler oft allein gelassen. Sinnvoll und hilfreich sind hingegen die eingeblendeten, übersetzten Dialoge.
Solisten, Chor und Statisterie zeichnen immer wieder eindrückliche Bilder: vom rührenden Einzelschicksal (beispielsweise Felicity Palmer als sterbende Oberin) bis zu den gewalttätigen Massenszenen, z.B. wenn die Revolutionäre ins Kloster eindringen.
Fazit: So schön und ergreifend kann zeitgenössische Oper sein.
Roger Cahn
|

4. 5. 2004
Katholizismus pur
Oper als Kulturkampf: Francis Poulencs «Dialogues des Carmelites» am Zürcher Opernhaus
Gänzlich ungebrochen bringt Regisseur Reto Nickler Poulencs religiöse Oper auf die Bühne. Das blendet auf den ersten Blick, gerade auch im Zusammenspiel mit der süffigen Musik. Schaltet sich der Kopf ein, häufen sich die Fragen: Fast alles wirkt zu einfach.
Tobias Gerosa
Ratsch, sechzehn Mal saust am Schluss die Guillotine herunter und tötet die Karmeliterinnen von Compiègne, eine nach der anderen. Francis Poulenc war der Meinung, nur ein Originalgerät könne den gewünschten Toneffekt bringen – diesen Wunsch erfüllt ihm das Opernhaus Zürich nicht.
Sonst aber hält sich Regisseur Reto Nickler szenisch brav an den Text. Dass das handwerklich auf den ersten Blick aufgeht, ist der raffinierten Bühne von Hermann Feuchter zu verdanken. Ganz in Packpapier gehalten, hat sie etwas Provisorisches und Überraschendes. Klappen, Schiebewände und verschiedene als Textprojektionsebenen dienende Flächen verändern immer wieder in spannender Weise den Blickwinkel. Wenigstens etwas davon würde man sich auch inhaltlich wünschen.
Kein Platz für Zweifel
Poulenc schrieb seine Oper 1957 nach seiner Rückwendung zum Katholizismus. Die Rollen von Gut und von Böse sind darin felsenfest gefügt, für Zweifel bleibt kein Platz: Alles was zählt, ist die Religion, und die Französische Revolution von 1789 erscheint als Zerstörerin. Und als Mittel zur Selbstverwirklichung.
Denn wie soll man Blanches freiwilligen Gang aufs Schafott anders deuten? Geplagt von Ängsten tritt die junge Adlige im Frühling 1789 ins Kloster ein. In Gesprächen mit der sterbenden Priorin, der Mit-Novizin Soeur Constance (von Christiane Kohl mit mädchenhaftem Charme gesungen) und später mit Mère Marie (Stefania Kaluza ist in ihrer unerschütterlichen Härte eindrücklich) wächst ihr Glaube, siegt aber noch nicht über ihre Todesangst. Erst wenn ihre Mitschwestern im Terreur der Jakobiner für ihre Standhaftigkeit umgebracht werden, findet Blanche die Kraft, ihnen freiwillig zu folgen. Nickler erzählt das affirmativ nach – nur ein einziges Mal, in der Abstimmung über das Märtyrergelübde, gesteht er Blanche andere Gefühle zu, als sie vorgegeben sind.
Herbe Einbrüche, straffe Tempi
Vielleicht hätte es den Mut gebraucht, Musik und Text auf der Inszenierungsebene etwas entgegenzuhalten. Denn Poulenc setzte das Opfer in emphatisch mitgehende Musik, welche die ganz grosse Geste nicht scheut, aufkommende Süsslichkeit aber meist noch rechtzeitig durch herbe, ja bisweilen brutale Einbrüche kompensiert.
Michel Plasson hält mit straffen Tempi die Handlung oft über die Szenengrenzen hinweg im Fluss. Poulenc verwendet einen riesigen Orchesterapparat. Dadurch, dass er ihn selten laut spielen lässt, vermeidet Plasson grosse Klangballungen, verschenkt aber einige dynamische Effekte – auch, weil kaum je wirklich leise gespielt wird. Dem entspricht die bis auf wenige Stilisierungen konventionelle Personenführung. So können sich die Sängerinnen – die Männer sind in dieser Oper nur als Nebenfiguren präsent, am prägnantesten Christian Jean als Priester – fast nur vokal profilieren. Während bei Juliette Galstian als neuer Priorin die Wärme ihrer Mittellage mit der unangenehm schneidenden Höhe kontrastiert, wirkt die verletzliche Expressivität von Felicity Palmers alter Priorin bestechend.
Hätten nicht ihre Zweifel am Glauben und am Sinn des Lebens der Regie eine Brücke zu einer eigenständigeren Interpretation geboten? Sie nutzt sie nicht und fokussiert ganz auf Blanche. Dass diese weniger zur Person als zur blossen Ideenträgerin wird, ist nicht die Schuld der berührenden Isabel Rey, deren Stimme an Körper gewonnen hat und zunehmend vielseitiger wird.
Die Musik wurde von einem unbekannten Selbstdarsteller, der an der Premiere im unpassendsten Moment auf der Bühne seine Show abziehen wollte und mit vereinten Kräften weggezerrt wurde, kaum beeinträchtigt. Ob das ein Regiegag sei, war nach der Vorstellung eine oft gehörte Frage. Er war es nicht, dass das aber nicht so offensichtlich war, spricht nicht unbedingt für die Inszenierung.
|

4. 5. 2004
Kloster und Welt, Terror und Gebet
Francis Poulencs Hauptwerk ist ein inspiriertes Stück zwischen grosser Oper und geistlichem Mysterium und ein musikalisches Monument. Das Opernhaus stellt sich mit schönem Erfolg der Herausforderung.
Herbert Büttiker
Eine lange, schwere Agonie und das kurze Zischen der Guillotine: Poulencs Oper konfrontiert mit den entsetzlichen Geräuschen des Sterbens, und die Angstzeigt sich in vielen Formen. Aber er begleitet es auch mit einer Musik voller ätherischer Geheimnisse und leuchtender Inbrunst. Texte katholischer Kirchenmusik sind vielfach hineingewoben, und im Klang der Musik ist der Komponist des «Stabat mater» allgegenwärtig. Wären die «Dialogues des Carmélites» nicht eben doch eine Oper, sie liessen sich als Poulencs «Requiem» verstehen. Über ihren spezifischen Klang wacht im Opernhaus Zürich mit überlegener Selbstverständlichkeit der Dirigent Michel Plasson. Eingängig und eindringlich bringt er mit dem Orchester und Ensemble der Zürcher Oper die erstaunlichen Qualitäten dieser konservativen Moderne zur Geltung. Dazu gehören eine lapidare Rhythmik, der weite Ambitus empfindsamer melodischer Gestik, alles eingebunden in die faszinierende Kraft und Ausdrucksfülle einer reichen Harmonik und farbigen Instrumentation.
Todesangst und Martyrium
Dass die Oper in ihrer im grossen Ganzen kontemplativen Schwere kein Zugpferd der Opernspielpläne geworden ist, verwundert dennoch nicht. Im katholischen Luzern war das 1957 an der Scala uraufgeführte Werk vor vierzehn Jahren zu sehen, im protestantischen Zürich steht es jetzt zum ersten Mal auf der Bühne. Allerdings – Fotos im Programmheft weisen darauf hin – erlebte Zürich 1951 im Schauspielhaus unter dem Titel «Die begnadete Angst» die Uraufführung des Textes von Georges Bernanos (1888–1948), auf dem die Oper basiert und der sich seinerseits – als Drehbuch für einen Film – auf Gertrud von Le Forts (1876–1971) Novelle «Die Letzte am Schafott» (1931) stützte.
Die Letzte am Schafott ist Blanche de la Force, eine junge Adelige zur Zeit der Französischen Revolution, die aus schierer Lebensangst im Kloster der Karmeliterinnen Zuflucht sucht, aber als Sœur Blanche de l’Agonie du Christ auch in der Glaubenssicherheit keine Ruhe findet. Während das Revolutionstribunal die Nonnen in den Tod schickt, ist sie auf der Flucht. Aber dann – «incroyablement calme» – löst sie sich aus der Menge und schliesst sich den Märtyrerinnen an. Während die Hinrichtung von sechzehn Nonnen des Karmeliterinnenklosters von Compiègne bei Paris historisch verbürgt ist, ist die Figur der Blanche dichterische Erfindung: die «Verkörperung der Todesangst einer ganzen zu Ende gehenden Epoche», wobei Gertrud von Le Fort vor allem an ihre eigene Zeit dachte.
Das weltliche Trauerspiel
Dramatische, meist verhaltene, aber an einigen Stellen auch explosive Spannung entfaltet sich in den Kontrasten von Kloster und Welt, von Terror und Gebet und vor allem in den geheimnisvollen Beziehungen zwischen Blanche und den Nonnen. Zu Blanches ängstlichem Wesen kontrastiert die unbekümmert naive Zuversicht ihrer Freundin Constance, und ihrem leichten Tod in «begnadeter Angst» steht der angstvolle Tod der Priorin nach einem vorbildlichen religiösen Leben gegenüber. Christiane Kohl mit dem leuchtend leichten Sopran ist für die Rolle der Constance eine ebenso ideale Besetzung wie Felicity Palmer, deren alternde Stimme noch den ganzen Glanz für die Glaubensautorität der Priorin besitzt, die aber auch all die Register für den grauenhaften Missklang ihres Sterbens mit grandioser musikalisch-darstellerischer Präsenz ziehen kann. Dieses zentrale Frauendreieck erweitern zwei weitere Vorsteherinnen des Klosters. Stefania Kaluza gibt der Mère Marie, der stellvertretenden Priorin, die ihre schützende Hand über Blanche hält, eindrücklich den Charakter von ruhiger Strenge, während Juliette Galstian als Madame Lidonie, die Nachfolgerin der verstorbenen Priorin, stimmlich zu forciert agiert und ihrer Partie und der menschlichen Grösse dieser Figur so wohl kaum gerecht wird.
Aber «Les Dialogues des Carmélites» ist keine «Frauenoper»: Zu den Figuren, mit denen Blanche in geistig-dialogischer Verbindung steht, gehören auch der Vater und vor allem der Bruder. Cheyne Davidson gibt den Marquis de la Force markant und kontrastiert ihn mit herb distanzierter Noblesse zur zärtlichen Zuneigung, die der junge Chevalier seiner Schwester entgegenbringt. Reinaldo Macias gestaltet sie mit viel belcantistischer Sensibilität. Bewegend sein Auftritt in der Schlussszene des 2. Aktes, in der die «Karmeliterinnen» als weltliches Trauerspiel kulminieren: Der Vater wird der Guillotine zum Opfer fallen, der Sohn wird ins Exil gehen und kämpfen, und sein Versuch, die Schwester zur Flucht zu bewegen, scheitert. Aber über diesem Scheitern liegt doch der Zauber menschlich reiner Liebe und im Gesang der Violinen die Trauer über eine Welt, die ihr Totengräber ist.
Kraft und Fragilität
Blanche gehört ihr von Anfang nicht an, alles kreist um ihre Angst. Aber weil sie durch diese Angst zugleich mit allem und allen in einer speziellen Verbindung steht, ist sie in ihrer ganzen inneren Armut dann doch die facettenreichste Figur des Stücks wird. Isabel Rey leuchtet das beeindruckend aus mit nuancenreichen Zwischentönen, mit grossen stimmlichen Reserven und auch mit der Kunst, die für die starken Emotionen und die langen Gespräche dieser Partie notwendige Kraft in den Dienst der Darstellung eines fragilen Wesens zu stellen.
Priester, Staatsfunktionäre, das aufgebrachte Volk: eine Vielzahl von Nebenfiguren, denen die Inszenierung ein kräftiges Profil gibt, weiten die Dialog-Oper zum Panorama der Zeit. Reto Nickler (Inszenierung), Hermann Feuchter (Bühnenbild) und Katharina Weissenborn (Kostüm) akzentuieren den philosophisch religiösen Diskurs. Die Bühne zeigt keine realistischen, sondern zeichenhafte Räume, und der gesungene Text wird in deutscher Übersetzung ins Bühnenbild hineinprojiziert. Dennoch kommt Theatralik in der prägnanten Personenführung und Gestik nicht zu kurz, und auch das Bühnenbild ist für verschiedene Aspekte offen. Es erscheint als äusserst ärmliches, auf eins zu eins vergrössertes, mit Karton und Klebeband zusammengeschustertes Bühnenmodell, ist aber auch eine effektvoll-komplexeBühnenmaschinerie. Die Inszenierung wird so dem Stück nach beiden Seiten hin gerecht, seiner meditativen Konzentration auf das religiös-existenzielle Thema und der «grossen Oper», als deren ferner Nachkomme die «Karmeliterinnen» eben auch zu sehen sind.
|

4. 5. 2004
Angst und Schrecken
Poulencs «Dialogues des Carmélites» im Opernhaus Zürich
Unerbittlich verrichtet das Fallbeil im Namen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit seinen Dienst. Die kleine Gemeinschaft der Karmeliterinnen aus dem Kloster Compiègne erleidet auf dem Schafott um ihres Glaubens willen das Martyrium. Ja, auch davon erzählt Francis Poulencs Oper «Dialogues des Carmélites», und im Schlussbild erfährt diese verbürgte Geschichte aus den Tagen der jakobinischen Schreckensherrschaft melodramatische Verdichtung. Das Aufeinandertreffen von Religion und Revolution gibt nur den äusseren Rahmen ab. Was den Abend im Innern zusammenhält, ist das Thema der Angst, das in der Figur der Blanche fokussiert ist. Das Schicksal der Tochter aus gutem Hause, die ihr Geburtstrauma und die folgende Lebensangst im gemeinsamen Tod mit ihren Mitschwestern überwindet, hat Gertrud von le Fort in der Novelle «Die Letzte am Schafott» erzählt, die Georges Bernanos später dramatisierte.
Während in den 1950er Jahren in Darmstadt die serielle Musik ihre Artistik auf die Spitze trieb und Luigi Nono mit ganz anderem ideologischen Hintergrund in seinem «Canto sospeso» Abschiedsbriefe zum Tode verurteilter Widerstandskämpfer auf avancierte Weise vertonte, hat Francis Poulenc zu der ihn existenziell berührenden Vorlage eine unmittelbar eingängige, doch äusserst raffinierte Musik geschrieben, die ein dichtes Netz von Beziehungen webt und vieles erhellt, ohne plakativ zu werden. So wird die Musik zum unentbehrlichen Bestandteil der Dialoge, etwa in der letzten Begegnung Blanches mit ihrem Bruder, wo die ganze Kindheitssehnsucht nochmals aufscheint. Michel Plasson, seit Jahrzehnten eng vertraut mit der Partitur, erreicht mit dem Opernorchester ein wunderbar transparentes Klangbild, bringt die sparsam gesetzten Dissonanzen zu kristalliner Klarheit und versagt sich zugunsten der Deutlichkeit - oft wechselt Poulenc den musikalischen Gestus in harten Schnitten - das Baden in Klängen. Diese instrumentale Qualität findet ihre geglückte Entsprechung im ausgeglichenen Ensemble und im Szenischen.
Dem Regisseur Reto Nickler gelingt es, die katholisch geprägte Erzählung auf ihre humanistische Dimension hin zu öffnen, ohne deswegen dem Werk untreu zu werden. Gleich zu Beginn wird augenfällig, dass sich die Gesellschaftsschicht überlebt hat, der Blanche entstammt. Die prunkvollen Gewänder der untergehenden Eliten (Kostüme: Katharina Weissenborn) und die goldüberzogene Wand der Bibliothek von Blanches Vater stehen in hartem Kontrast zu dem mit Packpapier ausgeschlagenen Einheitsraum von Hermann Feuchter, der nur notdürftig mit Klebstreifen zusammengehalten ist. Doch im Zentrum stehen die Gespräche unter den Nonnen, die Nickler in der Übersetzung direkt in die Kulissen projizieren lässt. (Weshalb er uns bestimmte Textstellen vorenthält, bleibt im Dunkel.) Es sind Dialoge am Abgrund, am eigenen wie an dem der Zeitgeschichte. In ihnen manifestieren sich die unterschiedlichen Charaktere, die auch hinter den Klostermauern weit divergieren.
Eine Seelenverwandte findet Blanche, die im Kloster Zuflucht sucht, in der ersten Priorin. Ein Leben lang hat sie um ihren Glauben gekämpft. Auf dem Sterbebett muss sie erkennen, dass ihr Kampf vergeblich war. Grossartig, wie Felicity Palmer an die Grenzen ihres Alts geht, um die Todesangst auszudrücken. Von eherner Glaubensgewissheit erfüllt ist dagegen Mère Marie, die schliesslich auf Geheiss des Ordensgeistlichen dem ersehnten Martyrium entsagen und sich im Alltag bewähren muss. Stefania Kaluza gibt ihr stolze Gestalt, die sie stimmlich zu differenzieren weiss. Ihr Gegenbild ist die neue Priorin, Madame Lidoine, die ihren Mitschwestern menschliche Anteilnahme und Sympathie entgegenbringt. Juliette Galstian verkörpert sie warmherzig, wenn ihr Sopran in der Höhe auch etwas uneinheitlich wirkt. Und schliesslich ist da Sœur Constance, in ihrer kindlichen Naivität überzeugend gegeben von Christiane Kohl, die hellsichtig den Gang des Geschehens voraussieht und Blanche freudig am Schafott erwartet.
Doch zuerst hat Blanche das Martyrium ihres Lebens zu bestehen. Sie, die den Klosternamen «Sœur Blanche de l'Agonie de Christ» angenommen hat, wird immer wieder mit ihrer tiefsitzenden Lebensangst konfrontiert, die sich zunehmend in Todesangst wandelt. Isabel Rey gelingt es, die Figur langsam auf den Höhepunkt hin zu entwickeln. Intensiv gestaltet sie ihre Verzweiflung im zerstörten Haus ihres inzwischen hingerichteten Vaters, wohin sie aus dem Kloster geflohen ist. - Als der Schrecken der Revolution seinen Höhepunkt erreicht, weicht auch von Blanche die Angst. Überraschend versöhnlich wirkt das Schlussbild. Wenn vorher der Mob brutal ins Leben der Karmeliterinnen eingedrungen ist, folgt er mit wachsender Ergriffenheit dem blutigen Schauspiel. Die Lichtsäulen, die nun an der Rückwand aufscheinen, können sie auch ihm eine bessere Zukunft verheissen?
Jürg Huber
|

4. 5. 2004
Dialoge auf der Bühne
Am Opernhaus Zürich inszeniert Reto Nickler «Dialogues des Carmélites» von Francis Poulenc
Das «Zwiegespräch» bestimmt Poulencs «Dialogues des Carmélites» in Zürich musikalisch wie szenisch. Wer die Ruhe hat, sich den tiefsinnigen Gedanken hinzugeben, erlebt einen intensiven Abend.
VERENA NAEGELE
Es ist ein ungewöhnlicher Opernstoff, den sich Francis Poulenc 1953 mit dem Schauspiel «Dialogues des Carmélites» vorgenommen hat. Im Mittelpunkt der in der französischen Revolution angesiedelten Geschichte steht mit Blanche eine Frau, die sich seit frühester Kindheit mit einer unkontrollierbaren Angst vor dem Tod herumschlägt. Sie tritt in den Orden der Karmeliterinnen ein, um zur Ruhe zu kommen. Doch zuerst erlebt sie hautnah den qualvollen Tod der Priorin, die in ihrem Delirium die folgende Katastrophe vorausahnt: Von der revolutionären Masse gehetzt, besteigen alle Karmeliterinnen - bereit zum Martyrium - das Schafott. Nur Blanche ist in Todesangst geflüchtet, löst sich aber unter den Klängen des «Salve Regina» aus dem gaffenden Mob und folgt den Schwestern.
Projektionen
Fast drei Stunden lang nur Nonnen auf der Bühne, ohne eigentliche Handlung, gespeist von abstraktem religiösem Gedankengut, welch eine Herausforderung! Poulenc findet dazu eine farbenreiche, in freier Harmonie gehaltene, packende und doch nie schwelgerische Musik. Faszinierend ist, wie er innerhalb dieses monothematischen Gefüges zu wirkungsvollen Kontrasten findet: in der Orchestrierung, in der Tempogestaltung und durch die gezielt eingesetzten und differenziert komponierten Frauenstimmen. Man spürt die innere Betroffenheit des Komponisten, der Blanche einmal als Alter ego bezeichnete.
Regisseur Reto Nickler kapriziert sich ganz auf die Dialoge, denen er Raum und Personenführung unterordnet: Die Texte werden während des Abends auf verschiedene Bühnenelemente projiziert: Vorne, hinten, unten, oben, je nach Handlung und Standort. Damit wird die Bewegung der statischen Spannung zwischen Projektion und Figur fast vollends geopfert.
Hermann Feuchter hat einen offenen Bühnenraum mit wenigen verschiebbaren Wänden und einem bühnenbreiten Tisch geschaffen. Alles ist mit braunem Packpapier eingepackt und zugekleistert, wie um zu signalisieren, dass auch die dicken Klostermauern fragil sind und nicht beschützen können. Das hat im Abstrakten etwas gar Improvisiertes und Banales an sich und steht in seltsamem Kontrast zu den konkreten Kostümen von Katharina Weissenborn - wie soll man Ordensfrauen anders darstellen, wenn nicht in ihrem Ornat?
Charakterstimmen
So wird der Abend ganz der musikalischen Gestaltung und dem psychologisierenden Vermögen der Sängerinnen anvertraut. Michel Plasson am Pult des agilen, farbenfreudig spielenden Opernhausorchesters versteht es wunderbar, trotz grossem Orchester, die Nuancen und Schattierungen der Partitur herauszuschälen. Er beherrscht sowohl die grosse Geste wie im grandiosen Schluss, als auch den über weite Strecken dominierenden Parlandostil. Viel trägt dazu auch die sorgfältige Sängerinnenauswahl bei, die mit verschieden timbrierten Stimmen aufwarten.
Ein brillantes Charakterbild gestaltet Felicity Palmer, die den enormen Stimmumfang der Priorin souverän beherrscht und auch wagt, mit schrillen Tönen ihre Befindlichkeit auf dem Totenbett hinauszuschreien. Mit dramatischem Stimmtimbre wirkt die Blanche von Isabel Rey als starke, mit ihrer inneren Zerrissenheit kämpfende Frau. Nur der Schluss gerät ihr unter den Fittichen von Nickler etwas gar religiös-pathetisch. Der leichte, hohe Sopran von Christiane Kohl als Constance bildet dazu ebenso einen schönen Kontrast wie die dunkle, strenge Marie von Stefania Kaluza.
Neben diesem kompakten, stimmigen Frauenquartett fällt Juliette Galstian (neue Priorin) mit unausgeglichener Stimme und unangenehmem Pressen in der Höhe etwas ab. Ein Glanzlicht bei den Männern setzt Christian Jean mit wunderbar lyrischem Tenor als Priester, während die zahlreichen Nebenrollen und der von Jürg Hämmerli einstudierte Chor den Abend musikalisch abrunden.
Poulencs Oper fordert das Publikum zu Geduld und Konzentration, Reto Nicklers Inszenierung verstärkt dies mit seinem Fokussieren auf den inneren Gehalt. Wer in unserer agitativen Welt die Ruhe dafür findet, wird mit einem ungewöhnlichen Opernabend belohnt.
|

4. 5. 2004
Todesangst, Schrecken und Gnade
Ein Stück, das auf faszinierende Weise befremdet: Francis Poulencs «Dialogues des Carmélites» sind erstmals am Zürcher Opernhaus zu hören.
Von Thomas Meyer
Lange wirkte Madame de Croissy als starke Priorin des Karmeliterinnenklosters von Compigne. Sie hat gebetet, sich um die Nonnen gekümmert und über den Tod nachgedacht. Und ausgerechnet sie befällt angesichts des Todes Angst und Schrecken. Sie schmäht Gott und hat düstere Visionen von der Zukunft des Klosters. Später wird die junge Soeur Constance sagen, vielleicht habe Gott da zwei Tode vertauscht: Er liess die Priorin schwer, ja «schlecht» sterben, und dafür werde eine andere ganz leicht in der Todesstunde hinübergehen. Und tatsächlich schreitet ihre Mitnovizin Blanche, zu der sie das sagt, am Schluss unerschrocken und ruhig, singend aufs Schafott.
1794: Eine Tragödie aus der Schreckenszeit der Französischen Revolution. Die Kloster wurden aufgehoben, die Messe durfte nicht mehr gefeiert werden, die Nonnen wurden, wenn sie weiterhin auffielen, hingerichtet, wie dieser authentische Fall bezeugt. Aber das ist nur der äussere Anlass für dieses Drama. Die Konfrontation mit dem Bösen führt zum inneren Konflikt: zur Angst, zur Todesangst, zur Angst vor der Angst, zur Weltflucht und von da auch zu Vorsehung, Wandlung und Gnade. In der Geschichte der ängstlichen Blanche, die vor der Welt ins Kloster flieht, fand die Schriftstellerin Gertrud von le Fort den «Trost, dass im christlichen Martyrium nicht die persönliche Stärke, nicht Heroismus, sondern Gnade wirksam ist». Auf ihrer Novelle «Die Letzte am Schafott» basiert das Drama «Dialogues des Carmélites», das Georges Bernanos 1947 schrieb, das Francis Poulenc 1953-56 vertonte und das jetzt im Zürcher Opernhaus erstmals zu erleben ist - in einer eindringlichen Darstellung.
Klare, schöne Musik
Wer sich etwa an Lars von Triers Film «Breaking the Waves» erinnert, in dem eine junge Frau betend stirbt und damit ihren invaliden Freund heilt, kann ermessen, wie verstörend solches Wunder, solch grausiges Heilsgeschehen wirkt, zumal wenn es mit solcher Intensität daherkommt wie in den «Dialogues». Bernanos setzte diese Irritation gezielt ein, um den Zuschauer zu bewegen - durchaus im Sinn des konservativen «Renouveau catholique» zu Beginn des 20. Jahrhunderts: Er wollte nicht schonen, sondern die christlich-existenziellen Fragen mit aller Wucht stellen.
Befremden und Faszination vermischen sich beim Betrachter, und die Musik, die so klar, ja schön wirkt, unterstützt diesen ambivalenten Eindruck. Zu Zeiten der Uraufführung war es für manchen überraschend, dass sich ausgerechnet der als Charmeur und Clown angesehene Neoklassizist Francis Poulenc an das Werk wagte. Er hatte vor der schwarzen Madonna des Wallfahrtsorts Rocamadour eine persönliche Bekehrung erlebt. Dass er sich Bernanos' Drama annahm, war ein Glücksfall, denn er besass die Fähigkeit, diese Dialoge in einer leichten, durchsichtigen, stets fasslichen Tonsprache zu verarbeiten, sodass das Werk nie in dröhnendem Unheil ersäuft, sondern weiterträgt.
Einen Reichtum an musikalischen Einfällen (darin ist Poulenc eine Art Mozart des 20. Jahrhunderts) entfaltet er auf scheinbar ungezwungene Weise, obwohl alles doch aufs Innerste verknüpft ist. Stimmungsmalerei ist seine Sache nicht, von ewiger Melodie, von überlangen Arien will er nichts wissen: Mit einer kurzgliedrigen Wendigkeit, einem Sprechton, der sich aber jederzeit aufschwingen kann (zuweilen fast ins Süssliche), wird klar erzählt. Vergleichsweise wenige heftige, aber umso prägnantere Akzente strukturieren die Tragödie, mit der Hinrichtung am Schluss folgt noch einmal eine grosse Steigerung.
Michel Plasson dirigiert das entsprechend schlank, er arbeitet die feinen, dissonanten Reibungen heraus, mit denen Poulenc seine besonderen Farben einbrachte, er gestaltet überlegt. Gewiss ist die Transparenz auch eine Gefahr: Jedes Detail ist hörbar. Mit wachsender Erfahrung dürfte das Opernhausorchester diese Aufgabe noch sicherer bewältigen.
Kreuz und Schafott
Transparent ist auch die Inszenierung von Reto Nickler, aufs Notwendigste beschränkt: Requisiten sind kaum vonnöten. Hermann Feuchter hat die Bühne geometrisch gegliedert, die Szenerie lässt sich rasch verändern. Die packpapierartigen Flächen erinnern an Guillotinen. Sie sind kreuzartig verklebt; damit werden die beiden Hinrichtungsgeräte Kreuz und Schafott in eins gesetzt und ergeben einen bedrängenden Kontext. Die Übersetzungen, in Weiss und Rot aufs Bühnenbild projiziert und dabei manchmal etwas schwer leserlich, fügen sich selbstverständlich ein.
Der klösterlichen Schlichtheit der Nonnen setzt Katharina Weissenborn die anarchistisch bunten Kleider der Revolutionäre entgegen. So schaffen der Regisseur und sein Team einen äusseren Raum für die inneren Konflikte der Blanche. Denn mag Bernanos auch eine späte Abrechnung mit der Revolution im Auge gehabt haben, im Zentrum steht diese junge Frau, die zunächst vor dem Märtyrertod davonrennt und dann doch ruhig in den Tod schreitet. Diese Ambivalenz des Stücks wird von der Hauptdarstellerin Isabel Rey schauspielerisch und vokal überzeugend und nuancenreich interpretiert.
Gut besetztes Ensemble
Um sie herum agiert ein sehr gut besetztes Ensemble von Charakteren - und hier zeigen sich die Qualitäten der Personenführung Nicklers. Streng wirkt die prinzipientreue Mère Marie von Stefania Kaluza, allein ihrer hohen, distanzierten Erscheinung wegen; pragmatisch wendig dagegen die zweite Priorin, Madame Lidoine (Juliette Galstian); fromm-fröhlich die Constance von Christiane Kohl; liebevoll und zerrissen Blanches Bruder, der Chevalier de la Force (Reinaldo Macias), als Mann von altem Adel der Vater (Cheyne Davidson). Hinzu kommt eine Schar von kleineren Partien sowie der Chor, der vor allem am Schluss zu hören ist.
Das Ereignis des Abends allerdings ist die eingangs erwähnte, am Ende des ersten Akts sterbende Priorin von Felicity Palmer. Mit einer leichten Schärfe in der Stimme verleiht sie dieser Frau ein besonderes Timbre, dennoch wirkt die Stimme sanft, vor allem weil Palmer die vokalen Linien wunderbar rund gestaltet. Schon ihr erster Auftritt, als es darum geht, Blanche in den Karmeliterorden aufzunehmen, bewegt; die grossartige, unbedingte Darstellung ihres «schlechten» Todes schliesslich geht vollends unter die Haut.
|

4. 5. 2004
Starke Dialoge mit einer suggestiven Musik
Opernhaus Zürich: Premiere von Francis Poulencs «Dialogues des Carmélites»
Wer eine Geschichte über Nonnen auf die Bühne bringt, komponiert kein Musikdrama. Der Stoff, den der originelle französische Komponist Francis Poulenc, bekannt für seinen pointierten Witz, für seine einzige grössere Oper «Dialogues des Carmélites» gewählt hat, ruft nach einer erzählend oratorischen Form. Doch trotz des geistlichen Themas ohne grosse Handlung ging die von Michel Plasson dirigierte suggestive Musik Poulencs am Premierenabend im Opernhaus Zürich unter die Haut.
Poulenc (1899-1963) war ein Schüler von Charles Koechlin und zählte nach dem Ersten Weltkrieg zu den jungen Anti-Wagnerianern in Paris, die in der «Groupe des Six» um Jean Cocteau nach neuem Geist und pointiertem Ausdruck suchten. Als 1935 Poulencs Lebenspartner tödlich verunglückte, besuchte er ein Kloster und war derart beeindruckt, dass er im Katholizismus seiner Jugend seelisch-geistigen Halt fand. Er schrieb daraufhin viel tief empfundene Kirchenmusik und entwickelte seine ausgesprochen melodische Begabung in zahlreichen Liedern. Sein Esprit und sein Sinn fürs Praktische zeugen von einem subtilen Humor.
Märtyrertod aus Überzeugung
Die Geschichte dreht sich um die «Gespräche der Karmeliterinnen», die im Zuge der Französischen Revolution enteignet werden und, weil sie ihrem Orden nicht abschwören, den Märtyrertod erleiden. Im Zentrum steht die seit ihrer Jugend von tiefer Todesangst gequälte Blanche, die miterlebt, wie die alte Priorin (wie einst ihre Mutter) stirbt. Schliesslich flieht sie sogar, um das Martyrium nicht mitmachen zu müssen. Doch als die Nonnen auf den Richtplatz geführt werden und unter gemeinsamem Gesang dem Tode ins Auge sehen, tritt auch sie hinzu und geht mit ihren Schwestern in den Tod - sie hat die Angst überwunden.
Die Musik von Poulenc strahlt in ihrer erweiterten Harmonik viel Wärme, lyrische Kraft und einen vielschichtigen Farbenreichtum aus. Die gesungenen Melodien sind eingebettet in ein Orchester, das von den dunkel dräuenden Bassregistern bis ins gleissende Licht einen reichhaltigen «Klangraum» evoziert. Und doch sind es die meisterhaft eingesetzten rhythmischen Impulse, die das innere Drama mit Spannung aufladen. Michel Plasson sorgte am Premierenabend vom Sonntag dafür, dass diese lyrische Kraft in ihrer Vielschichtigkeit zum Ausdruck kam. Trotz den vielen «Gesprächen» fesselte die Musik den ganzen Abend lang. Die grosse Steigerung zum gleissenden, die Angst vor dem Tod überwindenden Schlusschor der Nonnen hin war von suggestiver und nie zu pathetisch empfundener Grösse. Eine musikalisch ausgesprochen engagierte Leistung des Opernhausorchesters.
Hilflose Regie
Demgegenüber wirkte die Regie von Reto Nickler samt Bühnenbild (Hermann Feuchter) eher hilflos. Die vielen Bilder spielen sich in einem grossen, leeren Einheits-Bühnenraum ab, der ganz mit Packpapier ausgekleistert ist und mit hellem Band einzelne Risse sichtbar verklebt. Der so suggerierte «zerbrechliche» Innenraum, in dem auch herumliegende Bücher eine Rolle spielen, wirkt in seiner grossen Leere zu undefiniert und hat auch gar nichts Sakrales oder Klösterliches an sich. Die Nonnen spielen auch meist an der Rampe vorne, als hätten sie gar keinen Bezug zu diesem Raum.
Um so heroischer wirkt dieses riesige «Postpaket» dann in der Bedrohung durch die Revolutionäre, welche den in einen Graben getriebenen Nonnen die Schleier vom Kopf reissen. Die von der Decke herabgelassene schiefe Ebene, die mit geöffneten Fenstern ein überdimensioniertes Kreuz evoziert, wirkte nach dieser ewigen Leere einfach zu heroisch. Umso präsenter kamen in diesem monotonen Papierraum die simultanen deutschen Übersetzungen des Librettos zur Geltung. Die starken Texte wurden wie mit Schreibmaschine fortlaufend getippt und an hängende Planen oder an die Wände projiziert. Durch diese «bewegte» Untertitelung war man ständig mit Lesen beschäftigt - zu sehr bei dieser viel sagenden Musik.
Lyrische und dramatische Höhepunkte
Wie wohl sich aber die in diesem Raum verloren wirkenden Sängerinnen im transparenten und doch vielfarbigen Orchesterklang fühlten, offenbarten die vielen lyrischen und dramatischen Höhepunkte des Abends. Von grossartiger Ausstrahlungskraft und echter Empfindung war die Sterbeszene der alten Priorin. Felicity Palmer verlieh dieser gebrechlichen, starken Frau und ihrer grossen Angst vor dem Tod eine erschütternde Kraft, die durch das Kippen der Stimme ins Schreien und den packenden Wechsel von Verzweiflung und Zuversicht zum Höhepunkt des ganzen Abends wurde.
Interessant besetzt waren auch die beiden zentralen Nonnengestalten, Isabel Rey als schwermütige Blanche und ihre Freundin, Christiane Kohl, als junge, lebenslustige Nonne. Isabel Rey stellte nicht einfach ein gottergebenes Mauerblümchen dar, sondern vor allem stimmlich eine emotional tiefe und im ständigen Schwanken echt gefährdete Nonne. Ihr nahm man den freien Entscheid für den Schafott-Tod als eindrückliche Überwindung der Todesangst auch ab. Zu ihrer weichen, im Timbre etwas dunkleren und üppigeren Stimme passte der helle, unbeschwerte Sopran von Christiane Kohl ausgezeichnet. Sie hatte durch ihr Temperament auch eine gute Bühnenpräsenz und führte ihre Stimme agil und quicklebendig.
Juliette Galstian hingegen bekundete als neue Priorin vor allem in der Höhe Mühe, presste regelrecht und vermochte so zu wenig eigenes Profil zu entwickeln. Umso eindrücklicher war die Ausstrahlung von Stefania Kaluza als Mère Marie, welcher die sterbende Priorin die junge Blanche anvertraut hatte. Sie vermochte aus dem Hintergrund eine stimmlich erdige und sehr menschliche Kraft zu vermitteln. Charakter hatten aber auch die eher kleinen Männerpartien. Reinaldo Macias wirkte als besorgter Bruder von Blanche einfühlsam und dramatisch zugleich, während Cheyne Davidson als Vater und Marquis mit souveräner Stimmführung und weiser Einsicht überzeugte. Ausgezeichnet sang auch Christian Jean als abgesetzter Karmeliter-Priester, mit schlanker und doch innig berührender Stimme. Das Publikum, spürbar betroffen von dieser suggestiven Musik und der «brutalen» Geschichte, spendete allen Beteiligten herzhaften Applaus - auch der Regie.
Sibylle Ehrismann
|
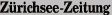
4. 5. 2004
Lebensangst und Todesangst
Zum ersten Mal am Opernhaus Zürich: «Dialogues des Carmélites» von Francis Poulenc
Fast ein halbes Jahrhundert hat es gedauert, bis Poulencs grosse Oper, 1997 an der Mailänder Scala uraufgeführt, den Weg nach Zürich gefunden hat. Die Neuinszenierung bleibt dem Werk allerdings Entscheideindes schuldig, - szenisch wie musikalisch.
WERNER PFISTER
Der Vorhang ist schon offen, bevor es überhaupt losgeht. Entsprechend hat man Zeit, das Bühnenbild von Hermann Feuchter zu betrachten: ein Innenraum aus Packpapier und Klebeband, aus herabhängenden Abdeckplastikbahnen und Pavatex-Imitationen. Das sieht scheusslich aus, und soll wohl auf die scheussliche Zeit der Französischen Revolution anspielen, aufs sozialpolitische Saubermachen vielleicht, verbreitet indes mehr den diskreten Charme einer Wohnungsrenovation.
Sinn fand ich darin keinen, aber viel Sinn wurde diesem Bühnenbild geopfert: seiner Einheit zuliebe. Denn dass das (zu Beginn der Oper) die elegante Bibliothek eines Marquis sein soll und dass die Oper, anschliessend und im ganzen zweiten Akt, in unterschiedlichen Räumlichkeiten eines Klosters spielt, davon weiss dieses Bühnenbild nichts zu erzählen. Revolutionäre Verwüstung aber, wenn es nach der Partitur ginge, dürfte sich erst im dritten Akt Raum schaffen.
Dialog-Desaster
Nun haben solche mit Papier überklebten Wände und hängenden Plastikbahnen neben dem rein bühnenräumlichen noch einen weiteren Zweck: Sie dienen als Projektionsflächen für den fleissig und in grossen Buchstaben projizierten Gesangstext. «Dialogues des Carmélites» ist in der Tat ein Werk der Zwiesprache unter Nonnen im mystischen Jenseits-Brennen, auch der Zwiesprache mit sich selbst, und es ist eminent wichtig, dass man diesen Text versteht.
Gesungen wird in der französischen Originalsprache, und davon - von den Sängerinnen und Sängern - versteht man herzlich wenig. Umso eifriger wird die deutsche Übersetzung projiziert: mit laufenden Buchstaben, einer nach dem andern aufleuchtend, und das langsamer, als einer zu lesen fähig ist, dafür mal in Gelb und dann wieder in Rot. Das absorbiert sehr viel (viel zu viel) Aufmerksamkeit und braucht auch viel Zeit. Oft ist es schlicht zu wenig Text, der projiziert werden kann, als dass man den Dialogen auf der Bühne wirklich folgen könnte; umgekehrt ist es für den, der das Werk kennt, eine visuelle Zumutung. Mehrmals verstellt zudem der Chor (der Regisseur) den Blick auf die Textprojektionen, oder diese werden schlicht in die schwarze Leere gebeamt. Ein Desaster.
Angst vor der Angst
Um Angst geht es in dieser Oper: um Lebensangst und umTodesangst, um «Angst vor der Angst», wie der Chevalier de La Force zu seiner Schwester Blanche sagt. «Ich bin in die Angst hineingeboren worden», sagt diese, «ich habe darin gelebt, ich lebe noch darin.» Wie aber kann diese Angst überwunden werden? Indem man sich selber loszulassen lernt, sich nicht als absolut begreift, sondern in Relation zu allem anderen. So wie jeder einzelne Wassertropfen, so klein er ist, die Unermesslichkeit des Himmels widerspiegelt (sagt die Priorin); so, wie nicht jeder Mensch für sich allein stirbt, sondern die einen Menschen für die andern sterben (sagt Constance).
Allerdings, ob diese Botschaft wirklich greift in dieser Neuinszenierung - ich weiss es nicht sicher. Regisseur Reto Nickler hat guten Spürsinn für das Statuarische mancher Personenkonstellation: mehr kontemplative Situationen als darstellbare Handlungen. Anderes überzeichnet er bis zur Farce: Wenn die Priorin, auf blütenweisse Kissenberge gebettet, ihren letzten Kampf, den Todeskampf, ausficht (eigentlich stirbt sie für Blanche) und sich plötzlich vom Krankenlager erhebt, um operndramatisch neben dem Bett zu Boden zu gleiten. Das ist schon fast wie in «Traviata» Auch bin ich mir nicht ganz sicher, ob der Auftritt eines Exhibitionisten im dritten Akt - er entkleidet sich auf der Bühne - wirklich zur Inszenierung gehört. Vielleicht spielt es (er) gar keine Rolle.
Gemartertes Gehör
Musikalisch wollte der Funke nicht so recht springen, jedenfalls nicht von Anfang an. Mit Michel Plasson stand zweifellos ein souveräner Kenner der Partitur am Pult, doch die ersten Szenen klangen im Orchester relativ blutarm - da liesse sich mehr emotionale Kraft entwickeln. Im weiteren Verlauf der Aufführung indes entfaltete sich die genussreiche Ausdruckspalette von Poulencs Musik mehr und mehr. Einer Musik, die so gar keinen modischen Prinzipien oder avantgardistischen Richtlinien folgt, sondern ihrer ganz persönlichen Ästhetik treu bleibt - und die ist von mächtiger Ausdrucksspannweite. Vorbildlich hielt Michel Plasson die oft schwierige Balance zwischen lakonischer Nüchternheit und leidenschaftlicher Emphase, zwischen kühler Prägnanz und herzenswarmer Einfühlung.
In sängerischer Hinsicht war vieles gut - vor allem all die Sängerinnen und Sänger in mittleren und kleinen Rollen, die sich mit einem Gesamtlob begnügen mögen -, aber es stand bei weitem nicht alles zum Besten. Isabel Rey kam mit der horrend schwierigen Partie der Blanche zwar gut zurecht, aber zuweilen schien es, als würde ihr eine (stimmlich) restlose Identifikation mit der Partie vorläufig noch nicht ganz gelingen. Felicity Palmer, die einzige übrigens, die schon Erfahrung mit dieser Oper mitbrachte, legte die Priorin in vokaler Hinsicht zu eindimensional an: über weite Strecken ein metallisch klingendes Gekeife auf Hochdruck, ohne Rücksicht auf Verluste. Und Juliette Galstian als neue Priorin marterte unser Gehör mit unzureichenden Höhen: vor allem im dritten Akt eine Pein.
Wesentlich einfühlsamer und im Gesang jederzeit souverän Stefania Kaluza als stellvertretende Priorin, und Christiane Kohl stattete Soeur Constance mit einem besonderen Liebreiz aus. Cheyne Davidson war als Marquis de La Force wohl fehlbesetzt, weil zu jung und viel zu vital; im Gespräch mit seinem Chevalier-Sohn, den Reinaldo Macias mit einem Schuss adliger Blasiertheit ausstattete, wirkte er wie ein gleichaltriger Bruder. Vielleicht wäre das anders herausgekommen, wenn man den alten Marquis zu Beginn der Oper in einem grossen Lehnstuhl hätte vor sich hin dösen lassen, wie es die Partitur will, weil das Alter eben seinen Tribut fordert. Aber eben.
|

