|
Aufführung
|

25. 1. 2003
(Première)
*
Musikalische Leitung: Marc Minkowski
Inszenierung: Jürgen Flimm
Bühnenbild: Erich Wonder
Kostüme: Florence von Gerkan
Regiemitarbeit: Gudrun Hartmann
Choreographie: Catharina Lühr
Lichtgestaltung: Martin Gebhardt
Bellezza: Isabel Rey
Piacere: Cecilia Bartoli
Disinganno: Marijana Mijanovic
Tempo: Christoph Strehl
Orchestra "La Scintilla" der Oper Zürich
Statistenverein am Opernhaus Zürich
TänzerInnen, SchauspielerInnen
|
|
Rezensionen
|
|
|

27. 1. 2003
Allegorien im Bistro
Händels Oratorium «Il trionfo» im Zürcher Opernhaus
Feurig und virtuos lässt der Dirigent Marc Minkowski das Barock-Orchester «La Scintilla» der Oper Zürich die Sonata zu Beginn von Georg Friedrich Händels erstem Oratorium «Il trionfo del tempo e del disinganno» (1707) spielen. Dann ein unvermitteltes Umschlagen in einen Adagio-Teil; die nachklingenden Saiten der Theorbe schaffen einen schier unwirklichen Klangraum. Und der Vorhang hebt sich, gibt - noch verschleiert - den Blick frei auf das Interieur eines grossen Pariser Bistros in den vierziger oder fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts. Erich Wonder hat einen riesigen, tiefen Bühnenraum geschaffen mit einer unendlich langen Bar auf der rechten Seite, gedeckten Tischen zur Linken und Nischen, aus denen die Gäste ein Kommen und Gehen veranstalten können. Das Bühnenbild kann als Architektur sofort erfasst werden, bietet viel Offenheit und lässt das Auge mit zahlreichen, schönen Details nie müde werden. Der Regisseur Jürgen Flimm bevölkert diese Bühne mit Gästen, welche schon mit ihrer Präsenz, ihren von Florence von Gerkan geschaffenen fabelhaften Kostümen die morbide Stimmung des Nachkriegs-Paris vermitteln. - Kann man so ein hochbarockes, allegorisches Oratorium bebildern, bei dem es um den «Triumph der Zeit und der Enttäuschung» über die vom Vergnügen (Il Piacere) sekundierte Schönheit (La Bellezza) geht? Jürgen Flimm kann. Im Opernhaus Zürich, dank einer Besetzung, die stimmiger kaum sein könnte, und dank einem Dirigenten, der seinen Händel liebt und genau weiss, welch opernhafte Dramatik, welch verrückte Farben, welche Emotionen er Händels Partitur entlocken kann.
So steif wie der Titel ist das von Kardinal Benedetto Pamphilj verfasste Libretto nicht. Denn dieser mochte Händels Sinnlichkeit und wollte ihm die Möglichkeit verschaffen, sein Talent als Opernkomponist auch in der Heiligen Stadt ausleben zu können, wo Opern per Papst-Dekret verboten waren. In brillanter Rhetorik lässt er La Bellezza (Sopran, Isabel Rey) und Il Piacere (Sopran, Cecilia Bartoli) mit Il Tempo (Tenor, Christoph Strehl) und Il Disinganno (Alt, Marijana Mijanovic) über Genuss und Vergänglichkeit streiten. Bellezza wird verunsichert, am Ende stehen Zeit und Enttäuschung als Sieger da: Bellezza entsagt dem weltlichen Leben, während sich Il Piacere mit einer Wut-Arie Luft verschafft. Die Allegorien haben sprachlich und musikalisch ausgesprochen menschliche Züge. Was Jürgen Flimm dazu bewogen hat, vier Bistro-Gäste in den Disput geraten zu lassen und ihnen auf der Bühne ein wechselndes Publikum zu geben.
Seine Bilder können unter die Haut gehen; es gibt Momente, wo einem der Atem stockt. Wo intelligent Bedeutungsräume aufgetan, Zeichen gesetzt werden, die einen unmittelbar berühren. Und wo der Regisseur auch klug mit dem emotionellen Verweilen in den Da-capo-Arien umgeht und den Wiederholungen Hintersinn gibt. Die Bewegungen des Bistro-Publikums, ihr Hin und her ist streng choreographiert (von Catharina Lühr), jeder optische Reiz ist inhaltsreich. Oft bieten die Bilder Hörhilfen, allerdings können sie auch ablenken und in einen doch etwas überladenen Aktivismus kippen. Die vier Protagonisten legen grosse Wege zurück, die nicht immer einleuchten. Flimm wehrt sich mit allen Kräften gegen die Statik der Oratorien-Form, und da tut er mitunter des Guten zu viel. Reizworte im Text werden zu Reizbildern und sind direkt umgesetzt. Ist vom Winter des Lebens die Rede, schneit es zu den Türen herein, und drei verschneite Männer setzen einen vierten, eine Puppe, als Quasi-Schneemann an die Bar. Am Schluss geht dieser in Flammen auf wie der Böögg am Zürcher Sechseläuten. Um nur eine der drastischen Illustrationen zu nennen.
Die grosse Qualität der Inszenierung besteht darin, wie Flimm die Allegorien auch psychologisch deutet. Wie depressiv-gruftig Disinganno im ersten Teil wirkt, wie Tempo Züge eines Existenzialisten annimmt, wie wankelmütig Bellezza wird. Und wie temperamentvoll aufbegehrend Piacere all ihre Überzeugungskraft mobilisiert, um dann unendlich enttäuscht zu werden. Der Unsicherheit von Bellezza gibt Isabel Rey von Anbeginn an Glaubwürdigkeit mit differenzierter farblicher Gestaltung; am Ende versinkt ihre Stimme buchstäblich in der Trauer. Die Rolle von Piacere ist Cecilia Bartoli gleichsam auf den Leib geschrieben. Sie kann ihre Durchschlagskraft und Virtuosität mit scharfem Timbre zur Geltung bringen, gestaltet dann aber die Hit-Arie «Lascia la spina» (wir kennen sie auch aus «Rinaldo») mit einer enormen Dynamik und vokalen Feinheiten: Hier ist der Punkt, wo keine Umkehr mehr möglich ist. Marc Minkowski hat den Mut, dafür ein äusserst langsames Tempo zu wählen, das diese Musik auf so nie gehörte Weise zur Geltung bringt.
Il Tempo wird von Christoph Strehl mit einem flexiblen Tenor ausgestattet, dessen beinahe baritonale Färbung für diese Rolle wie geschaffen ist. Eine Sensation ist der Alt von Marijana Mijanovic: Der Wandel der Disinganno von einer depressiven Frau zur triumphierenden Siegerin wurde in ihrem Gesang Wirklichkeit. Sie hat eine wahre Altstimme mit unglaublichen Farben und einer erstaunlichen Tiefe; jede ihrer Arien ist gestalterisch ein Ereignis. Zum Protagonisten wurde indessen auch das Orchester «La Scintilla», von dem Händel eine instrumentale Virtuosität sondergleichen verlangt und das von Minkowski zu einer hoch inspirierten, brillanten Leistung beflügelt wurde. Musikalisch ist dieser Opernabend unbestritten ein Grossereignis, der Inszenierung täte manchmal eine redigierende Hand gut.
|

27. 1. 2003
Selten so leidenschaftlich wie hier
Will da noch jemand behaupten, Barockoper sei eine schematische und gleichförmige Angelegenheit? Der sehe sich Händels «Trionfo del Tempo e del Disinganno» an!
Von Michael Eidenbenz
Bei aller normalerweise obligaten Kritikerscheu vor Lokalpatriotismus: Notlösungen auf diesem Niveau sind derzeit wohl nur in unserem Zürcher Opernhaus möglich. Da wird eine «Armida»-Produktion unter Nikolaus Harnoncourt wegen gesundheitlicher Schonung des Dirigenten noch während der laufenden Saison abgesagt, und man kann kurzerhand als Ersatz einen Marc Minkowski ans Dirigentenpult holen, eine Cecilia Bartoli eine neue Rolle lernen lassen und einen Erich Wonder die bereits begonnenen Bühnenbilder so umfunktionieren, dass statt des heroischen Haydn-Dramas nun eben ein Allegorienspiel des jungen Händel sich darin zutragen kann. Und zuletzt wird das Ergebnis einer solchen Notlösung zur vermutlich geschlossensten, spektakulärsten und wohl auch schönsten Produktion der ganzen Saison: musikalisch eine Glanzleistung der hauseigenen Barockformation La Scintilla, sängerisch eine einzige Paradebesetzung und szenisch eine Umsetzung durch Regisseur Jürgen Flinim, die bei aller eigenwilligen Originalität den nötigen Raum für die grosse musikalische Geste lässt. Worum geht es?
Den Blues mit einein Glas wegspülen
Es geht um die Depression, die ja gelegentlich in der nächtlichen Bar zu Gast sein soll. Etliche Flaschen sind schon leer, und nun kommt unweigerlich der graue Verdacht, dass dieses Vergnügen nicht ewig dauern, dass Geselligkeit, Eleganz und Schönheit irgendwann zu Ende gehen müssen. Während man heute solchen Blues mit einem weiteren Glas wegspülen kann, war das gleiche Erlebnis in barocken Zeiten eine Vanitas-Erfahrung und daher eine ernste Sache. Und ist gar ein Kardinal der Autor des sich daraus ergebenden Dramas, so ist auch dessen Ausgang vorgegeben: Entsagung und Verzicht auf Schönheit und Vergnügen! Der unerbittlichen Zeit ist nur beizukommen, indem man sich schon im Diesseits auf die selige Ewigkeit vorbereitet. Der besagte Kardinal hiess Benedetto Pamphili, der 22-jährige Händel hat den Stoff vertont, und Jürgen Flimm hat barocke Vanitas nun mit zeitgenössischem Blues kurzgeschlossen und eine zwischen Groteske und tiefem Ernst eigenartig schillernde Inszenierung zu Stande gebracht.
Dass auch Flimm im Sinne einer Regie-Botschaft dem Publikum den Klosterbeitritt empfehle, so wie er ihn zuletzt für seine Hauptfigur, die allegorische Belezza, verfügt, ist ja wohl nicht anzunehmen. Und so wird auch seine nächtliche Bar nicht zum realistischen Ort, obwohl Bühnenbildner Erich Wonder sie der Pariser Brasserie «La Coupole» nachgebildet hat und Florence von Gerkans Kostüme eine historische Lokalisierung etwa Mitte des 20. Jahrhunderts nahe legen. Zwar präsentiert auch die Statisterie eine bestens vertraute Vergnügungsgesellschaft, in der selbst die obligate Rosenhändlerin und die «De Tagi vo morn»-Verkäufer nicht fehlen. Doch tauchen auch seltsame Figuren auf, schwarze Vogelgestalten, eine Gruppe Blinder, einmal gar ein barocker Orgelspieler samt Instrument, und an der Bar sitzt als der einzige «ewige Gast» eine allmählich auftauende Puppe, die zuletzt sogar die bizarre Explosion ihrer Gewänder stoisch übersteht. Nein, es ist kein realistischer, sondern ein zusehends surrealer Ort, der nur den atmosphärischen Hintergrund für das eigentliche Drama von barocker frühpsychologischer Naivität und gleichzeitiger Raffinesse abgibt.
Dieses nun ist ein Wettstreit um die endgültige Wahrheit angesichts der Vergänglichkeit. Vier allegorische Figuren ringen darum mit allen Mitteln der Verführung, des Spotts, des Temperaments, der inständigen Bitte, des Zweifelns, der Trauer, der Wut. Natürlich hat das Vergnügen zuletzt keine Chance gegen Zeit und Enttäuschung, Piacere muss gegen Tempo und Disinganno im Werben um die Bellezza verlieren. Musikalisch freilich geschieht das pure Gegenteil: Der Abend ist ein einziges, anhaltendes und lange nachwirkendes «piacere»! Mag auch die Vergänglichkeit auf der Opernbühne wahrhaft oft besungen worden sein: So leidenschaftlich wie hier ist es wohl nur selten geschehen.
Ein Abend voller Entdeckungen
Was Marc Minkowski aus dieser äusserlich schematischen, im Inneren aber von enormem dramatischem Spürsinn des jungen Händel zeugenden Abfolge von Dacapo-Arien und Rezitativen macht, ist schlicht hinreissend. Da fegen Stürme durch den Raum, die nicht nur die Bassgruppe des Orchesters La Scintilla ins Schwitzen bringen. Da werden aber auch sämtliche Temperatur- und Dynamiknuancen bis zum Beinaheverstummen mit genauem Sinn und grösster Musikalität ausgekostet: stilisierte Affekte, einst den legendären Kastraten zugedacht und nun von einem blendenden Solistenquartett umgesetzt. Cecilia Bartoli als furiose Piacere raubt allen den Atem. Ob in paralleler Koloraturenvirtuosität zusammen mit der zweifelnden und zuletzt in ihre Vergänglichkeit sich schickenden Bellezza Isabel Rey, die man in Zürich noch nie in derartiger Barockfulminanz erleben konnte; ob aber auch in der in stiller Schönheit verklingenden Arie «Lascia la spina» (die später als «Lascia ch'io pianga» in Händels «Rinaldo» erst zum barocken Hit werden sollte). Christoph Strehl ist der Mann im Quartett, dessen lyrische Gelassenheit dem unanfechtbaren Sieg der Macht des Tempo eindringlich Gestalt verleiht. Und schliesslich die Entdeckung: Marijana Mijanovic war in Zürich schon im Konzert, nun aber erstmals auf der Opernbühne zu erleben. Eine Altstimme von phänomenaler Ausstrahlung und Umfang, von schlanker, gradliniger Kraft, kühl und doch von lodernder Intensität in der düsteren Rolle des Disinganno. Im kaum enden wollenden Schlussapplaus war sie es, die vom einhellig begeisterten Publikum mit besonderen Ovationen bedacht wurde. Eine Entdeckung an einem Abend, an dem es so vieles zu entdecken gab.
|
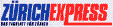
27. 1. 2003
Sternstunden mit Händel
Sein erstes Oratorium «Il Trionfo del Tempo e del Disinganno» begeisterte im Opernhaus
Mit der szenischen Aufführung des Händel-Oratoriums «Il Trionfo del Tempo e del Disinganno» (Der Sieg der Zeit und der Desillusion) gelang dem Opernhaus wohl der Höhepunkt der bisherigen Saison. So berauschend und gleichzeitig glaubhaft nahe an menschlichem Empfinden kann Barockoper klingen. Dirigent Marc Minkowskis Klang ist nie spröde, bleibt immer voluminös und warm. Er holt aus dem mit Verve musizierenden Orchester La Scintilla und dessen exzellenten Solisten ein selten gehörtes Spektrum von Nuancen hervor. Die Zusammenarbeit zwischen ihm und den Musikern war eine der Sternstunden an der Premiere.
Die zweite war Jürgen Flimms geniale Inszenierung, zusammen mit Erich Wonders ebensolchem Bühnenbild und mit Florence von Gerkans Kostümen. Der junge Händel vertonte den Text des römischen Kardinals und Opernfans Benedetto Pamphilj als Oper - freilich als Oratorium «maskiert», um damit das damalige Opernverbot im päpstlichen Rom zu umgehen.
Entstanden ist eine musikalisch und inhaltlich packende Parabel zwischen den vier Personen Bellezza, Piacere, Disinganno und Tempo (Schönheit, Vergnügen, Enttäuschung und Zeit). Flimm bringt sie als Menschen aus Fleisch und Blut auf die Bühne, und er stellt sie in die heutige Zeit: Der Abend spielt in einem der grossräumigen, eleganten Bar-Restaurants, wie sie heute überall chic sind. Orte, wo die Schönheit im äusserlichen Vergnügen gesucht wird. Bis zur Erkenntnis, dass echte Schönheit sich nur in der Wahrheit findet.
Das vierköpfige Ensemble ist die dritte Sternstunde. Isabel Rey zeigt als blonde Lebedame grossartig die Wandlung von der vergnügungssüchtigen Schönheit bis zur Entsagenden. Und sie findet mit hellem, ungekünsteltem Sopran wunderbar gestaltete Töne. Als ihre Verführerin Piacere findet Cecilia Bartoli ein ideales Spielfeld für ihr ausdrucksstarkes Bühnentemperament und ihre atemberaubenden stimmlichen Facetten. Ihre Piani der Mittellage sind und bleiben hinreissend. Die rasenden Koloraturhöhen sind, vor allem in jenen Höhen, die nicht für sie und ihr schmales Stimmvolumen gemacht sind, zirzensische Kunststücke, produziert, als wäre es eine olympische Disziplin. Mit elegantem, agilem und hellem Tenor überzeugt Christoph Strehl als Il Tempo die oberflächliche Schönheit von ihrer Vergänglichkeit. Verführerisch auch er, jedoch auf die ernste Art. So wie Marijana Mijanovic als II Disinganno, die Desillusion. Ihre Darstellung und ihr in seiner Dunkelheit farbenreicher und makellos geführter Alt gehören zu den Entdeckungen des Abends.
|

27. 1. 2003
Ein kraftvolles Memento mori
An so viel brausende Zustimmung im Opernhaus Zürich vermögen wir uns nicht zu erinnern: Das erste Oratorium Georg Friedrich Händels begeisterte das Publikum an der Premiere vom Samstag.
Der Komponist sitzt von Anfang an im Orchester. Und dessen schöne Allongeperücke kann niemand mehr übersehen, wenn der Organist Jory Vinikour als Händel-Double für ein Miniatur-Concerto am Portativ auf die Bühne gefahren wird, begleitet von der gleichfalls im Barockkostüm steckenden Konzertmeisterin Ada Pesch. Auch der 22-jährige wirkliche Händel hat seinerzeit im ersten Teil von «Il trionfo del tempo e del disinganno» an der Uraufführung 1707 in Rom die Orgel traktiert.
Der Komponist und Tastenvirtuose war damals freilich nach Italien gereist, um sich als Schöpfer von Opern zu profilieren. In der Ewigen Stadt, wo per päpstliches Dekret die Gattung als solche verboten war, fand er Ersatzbetätigung auf dem Felde des Oratoriums. Händels erster Gattungsbeitrag ist eine allegorische «Moralität» zum Thema der Vergänglichkeit. Schönheit, Vergnügen, Enttäuschung und Zeit treten hier an und tragen Argumente und Gegenargumente für die Vorzüge ihrer jeweiligen Begriffswelten vor. Wobei «Piacere» auf der einen und «Disinganno» sowie «Tempo» auf der anderen Seite versuchen, sich der «Bellezza» zu versichern beziehungsweise sie zu bekehren. Am Ende steht die totale Absage der bussfertigen Schönheit ans Vergnügen.
Flimm beweist glückliche Hand
Jürgen Flimm, der im Zürcher Opernhaus nicht immer eine ganz glückliche Regiehand bewies, hat diesmal eine hervorragende, ja bewegende Inszenierung zu Stande gebracht. Unter Mitarbeit von Gudrun Hartmann, Erich Wonder (Bühnenbild) und Florence von Gerkan (Kostüme), ist da, in Wechselwirkung mit der Musik, ein kraftvolles Memento mori erwachsen, das über jede geschmäcklerische oder platt tautologische Visualisierung der im Werk bildsatt vorgetragenen Gedanken und Affekte einen haushohen Sieg davonträgt.
Der Raum von Wonder zieht uns hinein in ein glamourös aussehendes riesiges Restaurant mit ausladender Bar. Es ist der 1927 eröffneten Brasserie «La Coupole» im Pariser Montparnasse-Viertel nachempfunden. Ein Tempel eines einsam-geselligen weltlichen Treibens, in den aber immer wieder unmissverständlich die Zeichen der Hinfälligkeit alles Menschlichen, der Bresthaftigkeit und des Todes hereingrüssen. Gruppen trinkender und feiernder Leute, ein in dialektische Dauerbetrachtung mit einer Kindpuppe versunkener Alter, eine Modeschau junger Frauen auf dem Tresen, Beschwipste, ein Mann mit kolossalen Engelsflügeln und, und, und: Statisterie, Schauspieler und Tänzer bestreiten hier einen Part, der über die Funktion einer rein atmosphärischen Sättigungsbeilage weit hinausreicht.
Ohne Verquältheiten
Eindrücklich ist auch der neben «Bellezza» einsam übrigbleibende Gast, als Sensenmann kenntlich gemacht – bei dem allerdings stört, dass er noch für einen oberflächlich anmutenden pyrotechnischen Einfall herhalten muss. Erfrischend ist, dass die Szenerie für Metaphysisches und Groteskes auch durchlässig gemacht wird. Und der in Händels Partitur nicht vorhandene Chor erscheint, gewandelt, gewissermassen durch die Hintertür wieder hereingebracht. Die in dezent charakterisierende (und wechselnde) Kostüme gesteckten vier eigentlichen «Figuren» des Oratoriums handeln ihren Disput ab – vor und in diesem Treiben, prosten sich zu, riskieren fallweise einen Flirt, werden für Momente zu sängerischen Grosstaten vorne an die Rampe gestellt. Das geschieht alles ohne Verquältheiten und ohne Drücker.
Prachtvolle Gesangskunst
Isabel Rey als «Bellezza» sang an der Premiere mit gut fokussiertem und dabei beweglich gehaltenem Sopran und viel Espressivo. Cecilia Bartoli als «Piacere» spreizte die barocke Affektrhetorik ganz weit auf: Das reichte von der Höchstgeschwindigkeits-Koloraturenkette bis zum gerade noch hingehauchten Hyper-Piano in der Schlusspartie der Arie
«Lascia la spina» (der Erstgeburt des «Lascia ch'io pianga», bekannt aus dem «Rinaldo»). Marijana Mijanovic gab mit dem «Disinganno» ein fulminantes Hausdebüt: Mit gleichsam instrumentalem Gestus führte sie ihren Alt, der erstaunlich tief hinunterreichen kann und dessen Timbre eine wunderbare Schärfedosis beigemischt ist. Auch Tenor Christoph Strehl, der den Part des «Tempo» versah, wirkte mit biegsam-agiler, textausdeuterisch wacher Gesangskunst.
Wie gerade eben bei Mozarts «Idomeneo», spielen die Orchestermusiker nicht als Grabenarbeiter, sondern in erhöhter Position. Die Unterschiede sind allerdings erheblich. Denn wo bei Dohnányi unter nicht-«authentischen» Prämissen musiziert wurde, wirkt jetzt mit dem Franzosen Mark Minkowksi einer der profiliertesten jüngeren Vertreter der historischen Aufführungspraxis. Überhaupt agiert nicht dasselbe Orchester der Oper Zürich, sondern vielmehr das ausgekoppelte Spezialensemble «La Scintilla». Mit historischen Instrumenten, in tieferer Stimmung, bei kontrastdramaturgischen Dynamikschärfungen, einem auch bis zu «sturmmusikalischer» Erregung anziehenden Tempi und mit sparsamen Streichervibrati. Zwar scheint, als hätten die Instrumentalisten an der Premiere eine Weile gebraucht, um sich freizuspielen. Aber dann begann es zu leben und zu pulsieren.
|
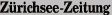 27. 1. 2003
27. 1. 2003
Die Tränen der Gerechtigkeit
Georg Friedrich Händels Oratorium "Il trionfo del tempo e del disinganno" auf die Bühne gebracht
Vom Oratorium zur Oper, vom Betsaal auf die Bühne: Der gewagte Sprung, er ist geglückt, und wie! Am Schluss der Vorstellung eine Viertelstunde lang exaltierte Ovationen: für die Sänger und Musiker, für die szenische Visualisierung - und für Händel.
WERNER PFISTER
Es ist sein letztes Oratorium und gleichzeitig sein erstes überhaupt. «Il trionfo del tempo e del disinganno» schrieb Händel während seines Italienaufenthalts in Rom im Mai 1707. Und zwar im Auftrag und auf einen Text des Kardinals Benedetto Pamphilj, bei dem Händel bei freier Kost (und mit eigener Kutsche und allen übrigen Bequemlichkeiten) logieren durfte. Kein Zweifel, Pamphilj war vom jungen Händel angetan, hofierte und charmierte ihm derart aufdringlich (das soll vorkommen), dass ihn Händel später, in London, als «old fool» bezeichnete. Dennoch, in London nahm Händel seinen Oratorien-Erstling dreissig Jahre später wieder hervor und bearbeitete ihn, nun unter dernTitel «Il trionfo del tempo e della verità», für eine Aufführung im Covent Garden Theatre. Nochmals zwanzig Jahre später ging Händel abermals über die Bücher, richtete ein englisches Textbuch ein und brachte das Werk, sein letztes überhaupt, nun unter dem Titel «The Thriumph of Time and Truth» 1757 und 1758 zur Aufführung.
Sacrum und Profanum
Eigentlich ist es eine Allegorie, wie sie das Barockzeitalter liebte. In einer schier endlosen Aneinanderreihung von 24 Arien, dazu Duette, Quartette und ein kleines Orgelkonzert, machen sich allegorische Figuren - Schönheit, Vergnügen, Zeit und Wahrheit - einander den Rang streitig: Was ist ausschlaggebend im Leben? Der Vergnügungssüchtigen wird das «Memento mori» entgegengehalten, und der Schönheit, die ihr Leben ihm Schein verbringt, das «vitam impendere vero» Juvenals. Natürlich geht es um Moral respektive um eine Gott gefällige Lebensweise, um die Suche nach der Wahrheit im Leben (statt des schönen Scheins), um die Erkenntnis, dass der Gerechte leiden wird, dass es aber die Tränen dieser Gerechten sind, die im Himmel als Perlen aufbewahrt werden.
Wie gesagt: ein Disput in Arien; Handlung entwickelt sich daraus keine. Wie kann man das dennoch abendfüllend spannend, auf die Bühne bringen? Nun, Oratorium und Bühne, Kirche und Theater, Sacrum und Profanum schliessen sich nicht gegenseitig aus; im Gegenteil, die Struktur ihrer Wirkung und ihres Selbstverständnisses ist in nuce dieselbe. Das zeigt auch die historische Entwicklung: Seit dem 18. Jahrhundert wurde das (geistliche) Oratorium dort, wo (weltliche) Oper verboten war, gerne als brauchbarer Ersatz beigezogen, in fürstlichen Palästen und privaten Theatern.
Barbetrieb
Und der Disput als solcher, das Argumentieren in der Frage, wie wichtig Schönheit und die Lust am Vergnügen in unserem Leben sind, wie wichtig es andererseits wäre, sich die irdische Vergänglichkeit, den eigenen körperlichen Zerfall vor Augen zu halten - diese Fragen sind heute, in der Spassgesellschaft der ewig Jungen, so aktuell wie je. Genau hier setzt die Zürcher Inszenierung an. Erich Wonder hat auf der Bühne eine immense Bar aufgebaut, die an die Brasserie «La Coupole» in Paris erinnert. Der linken Wand entlang sechs weiss gedeckte Tische fürs elegante Souper, für den gepflegten Wein; rechts ein langer Tresen, der sich in adretter Schlaufe im Bühnenhintergrund verliert.
Barbetrieb einen ganzen Opernabend lang. Denn die vier allegorischen Figuren sind Gäste wie die vielen andern, die hier sitzen und sich gestylt herumlümmeln. Regisseur Jürgen Flimm hat ein wunderbar sensibles Gespür für diese sich mondän aufspielende Bar-Atmosphäre. Man verkauft hier die «NZZ», Opernbesucher kommen nach der Vorstellung zum Late Night Drink (gespielt wurde offensichtlich Händels «II trionfo del tempo e del disinganno», man siehts dem Programmheft an, das sie studieren und das man gleichzeitig selber in Händen hält). Sie quatschen und parlieren (lautlos), versuchen immer wieder, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, etwa jene Dame, die in rückenfreiem Dekolletee in Richtung Toilette geht, und das in jenem «wissenden» Gang, der Männerblicke magnetisch fixieren soll.
Apokalyptische Koloraturen
Dass diese Selbstinszenierung eine aufwändige ist, wird uns schlagartig bei jenem Herrn bewusst, der von einer Herzattacke ereilt wird und tragisch zu Boden geht. Überhaupt, was wäre diese Scheinwelt des Vergnügens ohne ihr moralisches Komplementär: Es treten Heilsarmisten auf und singen, man spürt es, mit dem lieben Gott auf der Zunge. Dazu, die Welt ist so kontrastreich, eine Modeschau auf dem Bartresen: Girls führen schwarze Designerklamotten vor, was an die klerikale Modeschau in Fellinis «Roma» erinnert.
Immer wieder wird distinguiert serviert, getrunken, gegessen; unaufdringlich, wie es die gehobene Ambiance verlangt. So- genüsslich (und formvollendet) allerdings wie Cecilia Bartoli (in der Rolle des Piacere) isst niemand, und sie schläft nach soviel leiblichem Genuss folgerichtig am Tisch ein. Übrigens trägt sie mal einen Hosenanzug, dann wieder eine raumgreifende Robe: Ist dasVergnügen, il piacere, männlich oder weiblich? Beides wohl, jedenfalls bringt Cecilia Bartoli sehr männliche Verführungskünste ins Spiel, etwa wenn sie sich mit impulsiver Entschlossenheit in apokalyptische Koloraturen stürzt, zum schmunzelnden Vergnügen des Publikums. Umgekehrt aber zeigt sie auch, dass man von Frau zu Frau eben anders - besser - reden kann.
Über die Gender-Grenzen hinweg
Isabel Rey (in der Rolle der Bellezza) ist eine Wasserstoffblondine scheinbar ohne Verfallsdatum und hat doch die Halbwertszeit überschritten insofern, als Reflexion übers eigene Leben bekanntlich erst in dessen zweiter Hälfte beginnt. Sie hat letztlich ein Einsehen, dass sie auf dem falschen Weg ist, schminkt sich ab (wie Mary alias Georg Preusse jeweils am Schluss seiner Travestie-Show), entledigt sich der Perücke, lässt sich als Nonne einkleiden (ob das wirklich die Lebenslösung ist?) und singt zum Schluss mit einem wahrhaft anrührenden Silberglocken-Ton in der Stimme eine Arie (mit begleitender Solovioline), die uns derart ergreift, dass wir diese Lösung unwillentlich akzeptieren. Bravo, Händel!
Marijana Mijanovic verkörpert die Enttäuschung (Disinganno): Mann und Frau in einem, Engel und Macho über die Gender-Grenzen hinweg - auch stimmlich, wo ein exquisit frauliches Alt-Timbre immer wieder mit Facetten eines männlichen Falsettisten zu spielen scheint. Und vor allem ist Disinganno ein Melancholiker, vielleicht sogar - schwarz schattende Augenringe könnten darauf hinweisen - mit Drogenerfahrung. Dagegen wirkt Christoph Strehl (als Tempo) wie ein Managertyp, der weiss, dass Zeit Geld ist und genau so singt und agiert: Alles ist richtig, alles sitzt, alles ist evident. Keine Selbstzweifel.
Evidenz auch im Orchester La Scintilla der Oper Zürich, obwohl (noch) nicht alles (ganz) sitzt. Marc Minkowski heizt seinen Musikern tüchtig ein, denn das Orchester hat wesentlichen Anteil am Geschehen. Oboen und Blockflöten, Solovioline, Theorbe und zum Teil dreigeteilte Geigen verschmelzen immer wieder zu neuen Klängen, konzertierten im Corelli-Stil mit den Singstimmen. Sogar der Continuo-Orgel ist ein eigenes kleines Konzert zugedacht, das Händel übrigens auf der Bühne gleich selber spielt: eine historische Frühform späterer kommerzieller Hammond-Orgel-Hintergrundklänge in Bars und Bistros.
|

27. 1. 2003
Triumphaler Erfolg der leisen Töne
Premiere von Händels «Il trionfo del tempo e del disinganno» im Opernhaus Zürich
Ein Ausfall ist immer auch eine Chance. Nikolaus Harnoncourt musste aus gesundheitlichen Gründen auf die Premiere von Haydns «Armida» verzichten, möchte die Produktion aber später unbedingt selber dirigieren. So entschied sich Alexander Pereira kurzerhand, die «Armida» zu verschieben und stattdessen Händels frühes Oratorium «Il trionfo del tempo e del disinganno» mit Marc Minkowski am Pult zu wagen. Die so auch von Regisseur Jürgen Flimm von kurzer Hand vorbereitete Premiere am Samstag wurde zu einem triumphalen Erfolg der leisen Töne.
Händel war gerade mal zweiundzwanzig Jahre alt, als er nach Rom ging, um sich als Opernkomponist zu etablieren. Die Oper war damals in päpstliche Ungnade gefallen, so dass sich klerikale Opernenthusiasten darum bemühten, Opernhaftes in Form des Oratoriums zu bewahren.
Ein Opern-Oratorium
Auch Händels Auftraggeber und Librettist, der römische Kardinal Bendetto Pamphilj, gehörte zu diesen. Er erkannte Händels Begabung sofort und schrieb ihm einen allegorischen Text über die Vergänglichkeit des irdisch Schönen. Dazu komponierte Händel sein erstes Oratorium für nur vier Solostimmen und kleines Begleitensemble, aber ohne Chor. So schlicht und in den Dacapo-Arien auch noch etwas schematisch dieses Frühwerk ist, es zeugt bereits vom Phantasiereichtum, vom Tiefgang und vom dramatischen Temperament des späteren Grossmeisters.
Marc Minkowski, einer der interessantesten Dirigenten der Nachpionierzeit der historischen Aufführungspraxis, hat dieses Oratorium bereits in den 1980er Jahren auf CD eingespielt. Seine Interpretationen barocker Werke mit den von ihm gegründeten Musiciens du Louvre haben ihn an die internationale Spitze geführt, vor allem mit Sängerinnen wie Anne Sofie von Otter oder der auch in dieser Produktion singenden Altistin Marijana Mijanovic. Dass er sich jeweils lieber für Frauenstimmen als für den männlichen Altus entscheidet, ist eines der Markenzeichen des weniger puristisch als einfach hochmusikalisch denkenden Dirigenten.
So staunte man auch am Samstag nicht schlecht, als man das von Harnoncourt gegründete Orchester La Scintilla der Oper Zürich, das sich auf historische Spielpraxis spezialisiert hat, auftreten sah. Das ganz nach oben gefahrene Orchester umfasste nicht weniger als zehn (!) erste Geigen, und für den Continuo kamen die Theorbe, Cello, Cembalo oder Orgel zum Einsatz. Besonders auffällig ist, dass Händel zu den effektvollen Streichern der Italiener die deutsche Holzbläsertradition dazunahm und zwei konzertierende Oboen und Blockflöten einfügte, die im Dialog mit den Sängerinnen und Sängern eine eindringliche Innigkeit verbreiten.
Schönheit geht ins Kloster
Inhaltlich geht es in diesem Oratorium um «Bellezza», die Schönheit, die sich mit der allegorischen «Piacere» vergnügt. Zu Beginn betrachtet sie sich in einem Spiegel und ist voller Zweifel, wie lange sie sich ihrer Reize wohl noch erfreuen könne. Die Einflüsterungen von Piacere zerstreuen zunächst ihre Sorgen, doch «Tempo», die Zeit, und «Disinganno», die Enttäuschung, vermögen sie mit ihren Argumenten zunehmend nachdenklich zu stimmen, bis sie schliesslich den irdischen Vergnügungen entsagt und sich für die Wahrheit und damit für ein enthaltsames Leben als Nonne entscheidet.
Regisseur Jürgen Flimm siedelt diesen allegorischen Widerstreit über das Schöne und seine Vergänglichkeit in einer edlen Pariser Bar der späten 1940er Jahre an (Bühnenbild Erich Wonder). Zahlreiche Statisten an der grosszügig nach hinten geschwungenen Bar und an den Tischen beleben das Bild. Es sind Kellner, normale und surreale Gäste und Kinder. Sie werden - dem oratorisch-epischen Geschehen entsprechend - geschickt choreographiert. Die Choreographin Catharina Lühr führt die Figuren aus der Situation und vor allem aus der Musik heraus manchmal tänzerisch, manchmal statisch, und manchmal ganz natürlich mit Auf- und Abtritten. So hält sich der oratorisch-allegorische Inhalt in eindrücklich magischer Balance mit der realen Amüsiergesellschaft der Szenerie.
Die vier Protagonisten singen fast ausschliesslich im Vordergrund. Das bewirkt ein Stehrampensingen, das der subtilen Choreographie im Hintergrund etwas die Kraft nimmt. Schade, dass die Sängerinnen nicht öfter singend den Raum bespielen, sondern nur, wenn sie stumm sind.
Einzig die Altistin Marijana Mijanovic singt, während sie als «Disignanno» die schlafende Zeit herumschleppt, auch mal mitten aus dem Raum heraus; das wirkt ungemein. Sie verfügt aber auch über eine ausgesprochen eigen timbrierte, weit tragende und sehr flexible Stimme, der sie auch rauhere, fast männliche Farben abgewinnen kann. Und sie entspricht so gar nicht dem eher unscheinbaren und untersetzten Altistinnen-Stereotyp. Sie ist vielmehr gross und schlank und bewegt sich auf der Bühne mit einer ausgesprochen lockeren Natürlichkeit und virtuosen Präsenz.
Farbenreichtum der Stimmen
Wunderbar auch, wie sich ihre Stimme im Duett dem lyrisch weichen Tenor von Christoph Strehl anschmiegte, und wie sie eindringlich spitzer wurde, als sie der Bellezza ins Gewissen redete. Im Hinblick auf den Farbenreichtum der vier Stimmen ergänzten sich auch die beiden eigentlichen Sopranpartien ideal: Isabel Rey als lichte Bellezza und Cecilia Bartoli als erdigere Piacere. Grandios, wie die Bartoli ihren Zorn über die abtrünnige Bellezza in mörderischen Koloraturen regelrecht austobte, gleichzeitig aber in fast gehauchtem Piano und innigster Zurücknahme die «Töne der Wahrheit» sang. Dazu das betörende Legato von Isabel Rey, die ihren Zweifeln überzeugend Ausdruck verlieh und die Wandlung zur Nonne mit höchster musikalischer Hingabe glaubhaft zu machen verstand.
Möglich machte dies Marc Minkowski mit seinem jeden Ton mitfühlenden und mitatmenden Orchester. Die grosse Streicherbesetzung sorgte für einen geschickten Tutti-Kontrast zur kammermusikalischen Intimität, doch wirkte der Streicherklang nie laut, sondern vielfarbig, elastisch und von lichter Transparenz. Umso prägnanter kamen die solistischen Leistungen zur Geltung, sei das von den Oboisten, sei das vom engagiert mitmusizierenden Cellisten Claudius Herrmann oder vom Theorbisten Luca Pianca. Die überaus melancholische, sehr leise und doch wunderschöne Schlussarie der zur Nonne bekehrten Bellezza setzte diesem unvergesslichen Abend ein letztes Krönchen auf.
Sibylle Ehrismann
|
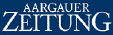
27. 1. 2003
Trauer muss Bellezza tragen
Opernhaus Marc Minkowski dirigiert G. F. Händels «Il trionfo del tempo e del disinganno» in Zürich
CHRISTIAN BERZINS
Einen solchen Opernabend hat Zürich länger nicht erlebt. Kein Wunder, mag ein Spötter sagen, wurde doch auch keine Oper, sondern ein Oratorium gespielt. Doch Regisseur Jürgen Flimm und Bühnenbildner Erich Wonder zaubern in dieses geistliche Spiel eine Handlung und Bilder, dass es spannender wird als so manche Oper. Ein Triumph für Intendant Pereira, hat er doch aus einer schier ausweglosen Situation ein Maximum herausgeholt. Im Herbst erst hatte bekanntlich Nikolaus Harnoncourt die vorgesehene «Armida»-Produktion für diesen Februar abgesagt. Innert kürzester Frist wurde umdisponiert und Georg Friedrich Händels Oratorium «Il trionfo del tempo e del disinganno» angesetzt. Wer sich diese Produktion anschaut, wird eine traumschöne und zugleich wilde Zeitreise erleben. Sie beginnt 1707.
Die Schönheit geht ins Kloster
Der 22-jährige Händel kommt nach Italien, wo die Kirche verboten hat, Opern aufzuführen. Der musikliebende Kardinal Benedetto Pamphilj bestellt bei ihm ein Oratorium, für das er das Libretto schreibt. «Der Triumph der Zeit und der Enttäuschung» ist eine geistliche Parabel, gewiss, aber eine voller dramatischer Zuspitzungen: La Bellezza (die Schönheit) geht mit Il Piacere (dem Vergnügen) einen Pakt ein. Solange sie zu ihm hält, werde sie ewig schön sein. Il Tempo (die Zeit) und Il Disinganno (die Enttäuschung) zeigen ihr aber auf, dass die Schönheit vergänglich ist. Bellezza wendet sich vom Vergnügen ab und geht ins Kloster.
Erich Wonder baute Regisseur Flimm für die Umsetzung dieses Spiels ein hinreissendes, hochästhetisches Bühnenbild: Dieser atmosphärische Raum aus den 20ern des letzten Jahrhunderts, ein Restaurant mit langer Bar, ist voller Leben. Seine zeitlose Vielschichtigkeit verblüfft: Die Bar kann zum Laufsteg werden; es gibt eine Türe, die Schneegestöber, somit die Aussenwelt, in den Raum lässt; da gibt es Lichtspiele im Hintergrund, und da ist auch eine grosse Leere: Platz für die zahlreichen Statisten und Handlungen.
Hier geschieht nichts, was nicht in jeder Bar nachts passiert. Doch gerade diese Normalität ist es, die das erhabene Spiel so menschlich werden lässt: Da kommt ein rührendes Blumenmädchen daher; es werden bald frisch gedruckte Zeitungen verkauft, an den Tischen wird gestritten wie geliebt, zu viel gegessen wie übermässig getrunken - unsere vier Protagonisten fallen weder auf noch ab. Hier kommen Bellezza und Il Piacere ganz natürlich mit den zwei Gestalten des Nebentisches ins Gespräch. Es ist spät, die Hemmschwelle tief, die Emotionen gehen hoch - auch in musikalischer Hinsicht.
Marc Minkowski leitet das Orchester «La Scintilla», jenes Opernhaus-Ensemble, das sich auf historischen Instrumenten auskennt. Minkowski entlockt ihm eine ungeheuerliche Sprache: sinnlich und gleichzeitig beredt; nicht perfekt, aber von einer Farbigkeit, oft auch Feinheit und Emotionalität, die ihresgleichen sucht. Die Sänger vertreten unterschiedliche Ansätze. Niemand spricht die Rezitative besser als Cecilia Bartoli (Piacere), doch wird bei ihr eben auch der Gesang zur Sprache - ob als Kunst oder als Hilfsmittel, lassen wir dahingestellt. Bartolis Gesang will den höchsten Ausdruck, derweil Isabel Rey (Bellezza) «nur» der Schönheit verpflichtet ist. Marijana Mijanovic steht in der Mitte: Ihre Altstimme klingt wie eine Orgel und zeugt von grösstem Ausdruck, ungemeiner Vielfältigkeit in der Tongebung und von grandiosem technischem Raffinement. Christoph Strehl (Tempo) zeigt einmal mehr die Qualitäten seines lyrischen, aber bereits recht kräftigen Tenors.
Trauer steht für erhabenes Vergnügen
In einer barocken Melancholie, die im Opernhaus-Magazin fälschlicherweise mit der «modernen Depression» gleichgesetzt wird, endet das Spiel. Ist in alten Melancholie-Darstellungen nicht immer zu sehen, dass die erlebte Trauer auch ein erhabenes, da reflektiertes Vergnügen war? So scheint es denn auch leicht verfehlt, dass bei Flimm der Schluss der Oper erdenschwer traurig wird.
Bellezza hat dann die edlen Kleider, die Perücke und den Schmuck abgeworfen. Sie erinnert an Caravaggios «Maddalena», an jenes Bild, das in der Galleria Doria Pamphilj hängt. Es hing wohl auch schon dort, als Georg Friedrich Händels Oratorium in Rom, im Palazzo Pamphilj (!), uraufgeführt wurde. Und nun würde die Zeitreise enden, wenn jetzt nicht erst begonnen werden könnte, darüber nachzudenken, was denn diese Schönheit ist. Ist Bellezza in ihrer Schlichtheit nicht viel «schöner» und anmutiger als vorher? Sind nicht auch die in Öl verewigten biblischem Maddalenen, die dem Vergnügen abgeschworen haben und sich dem Glauben zuwenden, oft viel «schöner» als die neckisch badenden Susannen oder die lockenden Venus-Figuren? Il Piacere findet naturgemäss an Letzteren mehr Gefallen und braust mit Theaterfeuer von dannen. Bei Bellezza wird niemand bleiben, denn Flimm (miss)deutet ihren Gesinnungswandel mit dem Tod.
|

Allegorien anno 2003
Händels Oratorium "Il trionfo del tempo" mit Marc Minkowski und Jürgen Flimm in Zürich
27. 1. 2003
Von der Vergänglichkeit des Schönen spricht das Zürcher Programmheft zu "Il trionfo del tempo e del disinganno" (Der Triumph der Zeit und Enttäuschung) nur mittelbar. Einem Axiom gleich präsentiert die Anzeige auf der Umschlagrückseite die Unantastbarkeit von Reichtum und Schönheit - einer Schönheit, die sich dem Zeitgeist entsprechend androgyn gerieren darf. Wie aus einer anderen Welt wirkt da die Einsicht der Schönheit in Händels Oratorium: "Io credea d'esser bella, e son deforme - Ich glaubte mich schön, doch bin ich hässlich." Der Disput der vier Allegorien Schönheit, Vergnügen, Zeit und Enttäuschung in dem weltlichen Oratorium des jungen Händel mutet an wie aus einem Lehrbuch barocker Emblematik. Am Anfang ganz eingenommen von den "Direktiven" des Vergnügens, lehren Zeit und Enttäuschung der Schönheit eine barocke Grunderfahrung: Vanitas vanitatum et omnia vanitas - Alles ist eitel, alles ist vergänglich. Eine Thematik, in der sich viele Parallelen zur Gegenwartsgesellschaft mit ihrem Jugendwahn entdecken lassen. Dass dieses in der römischen Fassung von 1707 gespielte Oratorium jetzt auf die Bühne der Zürcher Oper kam, ist allerdings eher Zufall. Geplant war "Armida" mit dem Bayreuther "Ring"-Regieteam und Nicolaus Harnoncourt. Doch Letzterer musste aus gesundheitlichen Gründen absagen.
Indes - Notlösungen sehen anders aus. Die Programmänderung bescherte der Oper ein Dirigentendebüt, nämlich jenes von Marc Minkowski. Der französische Barockspezialist hatte sich mit Händels "Trionfo" vor 15 Jahren erstmals auseinander gesetzt und rühmt den hohen Entwicklungsgrad der Musik des erst 22 Jahre alten Komponisten. Nicht nur, dass sich in dem Werk musikalische Kostbarkeiten wie die später in "Rinaldo" wiederverwendete populäre Arie "Lascia ch'io pianga" finden; Textdeutung, Instrumentation und Faktur der Nummern sind meisterlich. In ihnen bahnt sich eine stilistische Wendung an, die Händel als Urahnen der Empfindsamkeit begreifen lässt. Jedenfalls lässt Minkowskis Dirigat nicht nur barocke Affekt-Kultur erblühen, sondern schmeichelt dem Ohr mit emotionsreicher Dynamik, die fast romantisch zu nennen wäre - wenn sich das nicht im Kontext historischer Aufführungspraxis heute so gar nicht schickte . . .
Das Orchester "La Scintilla" der Zürcher Oper pflegt mit Barockbögen und historischen Blasinstrumenten diesen aufwühlenden Musizierstil höchst überzeugend, und machte im Lauf des Abends anfängliche Unkonzentriertheiten vergessen. Wie Minkowski, die Musiker und Isabel Rey (Bellezza) mit ihrem ebenso eindringlichen wie zarten Sopran die Schlussarie "aushauchen" lassen, gehört zu den vielen unvergesslichen Erlebnissen dieses an vokalen Kostbarkeiten reichen Abends. Mögen Cecilia Bartolis schier atemlose, in den punktierten Stakkati rekordverdächtigen Koloraturen auch einen sportlichen Aspekt haben, ihre aufwühlende, temperamentvolle Singdarstellung der Piacere zeigt die Ausnahmekünstlerin in ihr. Eine solche ist auch in Marijana Mijanovic erwachsen; sie singt eine grandiose Disinganno: ein Alt mit schier unerschöpflicher, räumlicher Tiefe, der sich im Duett mit dem angenehm silbrigen lyrischen Tenor Christoph Strehls hervorragend mischt. Ein musikalisches Ausnahmeerlebnis. Auch ein szenisches?
Schlüssiges, spannendes, detailverliebtes Theater
Der von Erich Wonder entworfene Raum, der Pariser Brasserie "La Coupole" nachempfunden, lässt zunächst daran zweifeln. Werden hier nicht wieder Versatzstücke - "Lieblingskinder" - des Regietheaters der Gegenwart strapaziert? Restaurants, Hotelhallen als Topoi für eine Gesellschaft, die auf der Durchreise ist? Doch hier passt es, ja, ist es beinahe zwingend. Regisseur Jürgen Flimm entwickelt den Konflikt aus der Anonymität und sterilen Schönheit der Art-Déco-Atmosphäre des Raums, in den Kostümbildnerin Florence von Gerkan die Pole Schönheit und Enttäuschung mit Metaphern der Mode (unterschiedlicher Zeitalter) plastisch umschreibt. Flimms Interpretation bleibt dicht am Text, lässt aber auch ironische Brechungen zu: Da werden schon mal Heilsarmisten, Models auf dem Laufsteg oder Matrosen herbeizitiert, wenn es um aktualisierende Deutung geht. Und als augenzwinkernden Tribut an das Barocktheater gesteht die Regie dem Vergnügen bei seinem rasenden Abgang pyrotechnischen Zauber zu. Das ist schlüssiges, spannendes, detailverliebtes Theater als unterhaltsam-moralische Anstalt. Für die Provokationen (wider die allegorischen Einsichten) sind andere zuständig: die Werbung im Programmheft etwa. Frenetischer Jubel.
|
 28. 01. 3003
28. 01. 3003
Händels Jugendsünde: "Il Trionfo del Tempio" in Zürich
von Manuel Brug
Sieht so Enttäuschung aus? Groß, schlank, ephebenhaft, mit elfenbeinernem Teint, schwarzem Strubbelschopf, Kohleaugen, kühn geschwungenen Lippen. Bebend steht die hinreißende Marijana Mijancovic da, in weißem Rolli und schwarzem Samtanzug ähnelt sie Juliette Greco aus Saint Germain, die Hände flattern, und ihr klares, androgynes Alttimbre macht wohlig schaudern. "Der Mensch glaubt, dass die Zeit schläft, während sie ihre versteckten Flügel ausstreckt", warnt also die Enttäuschung melancholieumflort, und Il Tempio alias der verlässliche Tenor Christoph Strehl spreizt seine Federn.
Es gibt schlimmere Vanitas-Symbole, ein weniger luxuriöses Ambiente für gepflegt lyrische Mementi Mori als die Pariser Art-Deco-Lokallegende "La Coupole". Die freilich, wie Erich Wonder sie mit ihrem nach links schwingenden Bar-Tresen, ihren fächerförmig transparenten Säulen und goldgehämmerten Wänden elegant nachempfunden hat, sie ist nur Bühne – Zürcher Opernbühne. Hinten tanzen, essen und trinken stumm Paare in Florence von Gerkans fließenden Vierziger-Jahre-Kleidern, vorn sitzt das Vergnügen in Gestalt einer im Dreiteiler steckenden Cecilia Bartoli, schenkt der sich im Schminkspiegel betrachtenden marilynblonden Isabel Rey Bordeaux nach und appelliert an sie, als die personifizierte Schönheit, sich endlich gedankenlos gehen zu lassen.
Das scheint selbst im hedonistischen Luxushimmel à la Paris nicht mehr möglich. So ist La Bellezza, bis sie allem weltlichen Tand entsagt hat und im Nonnenhabit büßend auf dem Boden zittert, die folgenden drei Stunden lang im Argumentationsclinch verfangen. Il Piagiere verführt, Il Tempio und Il Disinganno warnen – die Schönheit aber steht am Scheideweg.
Ganz im Gegensatz zum frömmelnden Text, den im sinnenfrohen Rom der Kardinal Benedetto Pamphili 1707 als klerikaler Gönner für seine jüngste Komponisteneroberung schrieb, nutzt der 22-jährige, unter wohligem Italien-Schock stehende Georg Friedrich Händel den statischen Allegorievorwurf als Experimentierfeld kaum kanalisierter Gefühle: unter südlicher Sonne ausgebrütet, schlüpft hier bereits der vollgültige Opernkönner aus seinem ersten Oratorien-Ei. Auch später kehrt il caro Sassone gerne zu seinem furiosen Jugendstreich "Il Trionfo del Tempio e del Disinganno" zurück – nicht nur als großzügig genutzter Melodiensteinbruch. Die 1704 als Sarabande in der Hamburger Oper "Almira" auftauchende Arie "Lascia la spina" etwa, die die sonst irrlichternde Koloraturketten spuckende Cecilia Bartoli mit größtmöglicher Pianissimokonzentration fast in den Stillstand haucht, wird 1712 im "Rinaldo" zu "Lascia ch’io piangia" und als erster Händel-Hit London im Sturm erobern.
Das seinen schnell entwickelnden Grundkonflikt nur diskursiv, kaum dramatisch austragende Oratorium ist eine problematische Opernvorlage. Die Jürgen Flimm sanft surreal verrätselt, oberflächlich schön anzusehen als szenische Ballade vom traurigen Bar-Restaurant bebildert. Diskurs im öffentlichen Raum. Mag es zwischen dem singend handelnden Quartett intensiv knistern, der 39 Statisten, als Messdiener, Heilsarmisten, alte Engel, abfackelnde Eismänner, Rosenverkäuferinnen, Drogentote beständig neu arrangiert, wird man müde: weil sie Staffage bleiben, nicht in den Kern der Auseinandersetzung stoßen. Die als Vergnügen eigentlich sächliche Bartoli mutiert kurzzeitig zur Frau. Was so folgenlos bleibt wie die übrigen Kostümspielerei mit Barockroben.
Es ist der musikalischen Seite vorbehalten, für sinnige Spannung und sinnliche Sphäre zu sorgen. Kein Problem, dank Marc Minkowski, der als bestmöglicher Ersatz für den kurenden Nikolaus Harnoncourt fungiert, welcher mit dem gleichen Team eigentlich Haydns "Armida" erproben wollte (solche hochwertige Spielplanflexibilität scheint nur in Zürich möglich...). Der Franzose am Pult des zum Spezialensemble "La Scintilla" mutieren Opernorchesters klanginszeniert Händels Frühlingserwachen mit wissender Hand als locker wehende, nie überpointierte Aufbruchsstimmung eines Genies. Bis die sonst blechern tönende Isabel Rey in ihrer letzten, nun im richtigen Glauben gesungenen Arie süßkatholische Innigkeit zelebriert und die Musik – zärtlich von letzten Oboentönen umschwebt – verklingt. Ein verzaubertes Publikum aber bleibt zurück.
|
|
Portrait
|
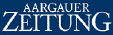
16. 1. 2003
Ein Maestro voller Energie und Theatralik
Ersatz von Rang
Begegnung mit Marc Minkowski, der am Zürcher Opernhaus Händel dirigieren wird
Ausgerechnet als Einspringer (für Nikolaus Harnoncourt) präsentiert sich einer der führenden französischen Dirigenten von heute erstmals im Zürcher Opernhaus: Marc Minkowski.
Mario Gerteis
Er ist erst 40 und steht doch schon ganz oben – gefragt in der halben Welt, in Paris und Wien, bei den Festspielen von Aix-en-Provence und Salzburg. Minkowski gilt als Barock-Spezialist und wird in Zürich auch ein Werk von Händel auf die Szene bringen. Indes wehrt er sich entschieden, auf die Musik des 18. Jahrhunderts eingeengt zu werden.
Selten in letzter Zeit habe ich einen Dirigenten so körperhaft an der Arbeit gesehen. Vor allem in den raschen Partien machen Hände und Beine ungestüm mit, der massige Körper pendelt wild hin und her – dass das Pültchen tief unten steht, ist kein Zufall, er würde es sonst umschmeissen. In der französischen Presse gilt Marc Minkowski als «Tanzbär» oder als «Sprinter». Minkowski selber wiegelt lächelnd ab: «Früher hat das sicher gestimmt, ich liess mich von meinem Temperament mitreissen. Heute bin ich ruhiger geworden, achte mehr auf die grosse Linie. Ich versuche, die Energien von aussen nach innen zu lenken. Das Ziel ist das gleiche geblieben: Espressivo – das aber mit Kanten und Ecken.»
Fagottist und Orchestergründer
Minkowski ist ausgebildeter Fagottist. Das hat sich inzwischen geändert: «Zuerst war das Dirigieren eine Art Hobby, um mich zu amüsieren. Dann gewann es immer grössere Bedeutung, obwohl ich als Fagottist von den bedeutendsten Ensembles sehr gefragt war und dort viel gelernt habe.» Er findet es wichtig, dass ein Dirigent zuerst im Orchester gesessen und praktische Erfahrungen gesammelt hat. Er erwähnt den Cellisten Nikolaus Harnoncourt, der für ihn zur Initialzündung geworden sei: «Als ich Vivaldis Quattro Stagioni erstmals mit Harnoncourt hörte, traute ich meinen Ohren nicht. Was da aus den Lautsprecherboxen auf mich einkrachte, war nicht immer schön, aber voll Leben, aufregend und dramatisch.»
Und so gründete der 22-jährige Marc Minkowksi – das war 1984 – sein eigenes Ensemble mit Originalinstrumenten: Les Musiciens du Louvre. «Zunächst war es eher eine Hobby-Formation, ein Musizieren unter Freunden. Kaum konnte ich mit den Eintrittsgeldern ein Honorar verdienen.» Ab 1987 wurde die Sache professioneller, nicht zuletzt dank der Mithilfe von Radio France. Und natürlich auch wegen günstiger Schallplatten-Verträge (zuerst mit Erato, später mit der Archiv-Produktion). So konnte er nach und nach fast alle seine Lieblingswerke von Lully und Rameau, von Händel und Gluck und Monteverdi aufnehmen. Inzwischen spielen die Musiciens du Louvre von Fall zu Fall auch auf modernen Instrumenten, «alle Musik, die nach Haydn kommt, und ich möchte diesen Anteil noch steigern».
1996 wurden die Louvre-Musiker mit dem Ensemble Instrumental de Gre-noble verschmolzen; sie zogen in die französische Alpenstadt und nennen sich seither «Les Musiciens du Louvre-Grenoble». Etliche Mitglieder kommen übrigens von der Musica Antiqua Köln, wo sie bei Reinhard Goebel «Kraft, Präzision, Angriffigkeit, Reaktionsschnelle und eine grosse technische Kontrolle» lernen konnten – lauter Dinge, die Minkowski selber hoch schätzt. Gerade konnte er auf einer ausgedehnten Europa-Tournee die Qualitäten der Musiciens du Louvre-Grenoble vorführen: bei Händels «Giulio Cesare», der als konzertante Produktion überall bejubelt und für die Compact Disc mitgeschnitten wurde (die Edition soll im kommenden Sommer erscheinen).
Barock und Offenbach
Pikante Pointe: Minkowski hasst Countertenors – zumindest für heroische Rollen. Bei der szenischen «Giulio Cesare»-Produktion im Pariser Palais Garnier sang David Daniels die Titelpartie. Minkowski: «Er machte es exzellent, aber ich finde es dennoch nicht richtig. Das war einst eine Kastratenrolle, und wir wissen nicht genau, wie es getönt hat. Aber ich glaube, dass eine agile Altistin mit einer perfekten Tiefe diesen Stil, diesen Ausdruck natürlicher trifft.» In der jungen Jugoslawin Marijana Mijanovic hat er solch eine Künstlerin gefunden. Auf der «Giulio Cesare»-Tournee sang sie den Titelhelden, eine kleine Sensation. Minkowski nimmt Marijana Mijanovic jetzt nach Zürich für Händels «Il Trionfo del Tempo e del Disinganno» mit – man darf gespannt sein.
Überhaupt hat Minkowski, der meist mit einer ausgewählten Sängerschar (etwa Mireille Delunsch, Natalie Dessay, Yann Beuron, Laurent Naouri, aber auch mit internationalen Stars wie Felicity Lott, Magdalena Kozena, Anne Sofie von Otter) zusammenarbeitet, sehr konkrete Vorstellungen über das Barocksingen. Was er nicht leiden kann, sind «weisse Stimmen», die abstrakt an diese Materie herantreten. Er favorisiert Künstlerinnen und Künstler, die in verschiedenen Stilen bewandert sind. «Alle Barockopern wurden für Sänger geschrieben, die die besten ihrer Zeit waren. Solche singen heute Mozart und meinetwegen Wagner. Warum soll man ihnen die Tür zur Barockoper verschliessen? Ich bin kein Sektierer. Aber ich denke, dass die Barockoper für alle Sänger offen sein sollte, die die Intelligenz und die technischen Fähigkeiten für solch eine Musik besitzen.»
Gleich nach der Zürcher Händel-Produktion zieht Minkowski nach Lausanne, wo er mit seinem bevorzugten Regisseur Laurent Pelly «Les Contes d’Hoffmann» seines Lieblings Jacques Offenbach erarbeitet (Premiere am 21. Februar). Vor allem geht es ihm darum, dass alle vierteiligen Partien vom gleichen Künstler verkörpert werden. Nicht nur die Diener und die Bösewichter also, sondern auch die Frauen, die in Hoffmanns Leben und Lieben so wichtig sind. «Das war zweifellos Offenbachs ursprüngliche Konzeption: ein lyrischer Sopran für alle vier Rollen. Dass man sie auseinander dividiert und auf verschiedene Stimmen verteilt hat, ist eine falsche Entwicklung.» Der Dirigent weiss natürlich, dass er mit solch einer Entscheidung selbst vorzügliche Sängerinnen vor Probleme stellt. Natalie Dessay fällt leider wegen einer Erkrankung der Stimmbänder aus. So wird sich Mireille Delunsch der Feuerprobe unterziehen. Minkowski: «Ich weiss, es ist ein Risiko, aber ich wage es. Es wird sich lohnen!»
Keine Kompromisse
Mit zunehmender Erfahrung und wachsendem Ruhm ist Marc Minkowski selbstbewusster geworden. Etwa bei der Schallplatte. «Ich kann es nicht mehr ertragen, ins Studio zu gehen und drei Stunden damit zu verbringen, fünf Minuten Musik aufzunehmen. Ich muss ein Werk im Ganzen machen, um die Energie, die Theatralik zu finden. Wenn man zum Beispiel nach dem ersten Akt im Laufe des zweiten eine Arie singt, ist das etwas anderes als um zwei Uhr nachmittags. Da ist man gerade vom Tisch aufgestanden, und das rote Licht geht an. Für mich hat das nichts mit der Spannung an einem Abend zu tun. Auch die Sänger lieben das, selbst wenn sie sich sehr konzentrieren müssen.»
Sogar ein Marc Minkowski mit seiner Bilderbuchkarriere musste Rückschläge hinnehmen. Zum Beispiel, dass ihm ein Orchester die Gefolgschaft verweigerte – passiert in Genf mit dem Orchestre de la Suisse Romande bei Offenbachs «Orphée aux Enfers». «Das klappte hinten und vorn nicht, die Musiker liebten das Stück nicht, und sie liebten mich nicht. Kurz darauf machte ich Offenbachs Werk in Lyon. Das war wie Tag und Nacht.» Auch sein einziges festes Bühnenengagement bisher, an der Vlaamse Opera in Antwerpen und Gent, brach er 1999 nach zwei Jahren ab. Zu viele Leute redeten ihm drein. «Prinzipiell wäre ich nicht dagegen, ein grosses Orchester oder ein Theater zu übernehmen. Aber ich möchte dort allein verantwortlich sein, als Künstler wie als Manager. Ich will keine Kompromisse mehr eingehen.»
|

