|
Aufführung
|

14. 3. 2004
(Première)
*
Musikalische Leitung: William Christie
Inszenierung: Claus Guth
Ausstattung: Christian Schmidt
Lichtgestaltung: Jürgen Hoffmann
*
Farasmane: Rolf Haunstein
Radamisto: Marijana Mijanovic
Zenobia: Liliana Nikiteanu
Tigrane: Isabel Rey
Tiridate: Reinhard Mayr
Polissena: Malin Hartelius
Fraarte: Elizabeth Rae Magnuson
SYNOPSIS - HIGHLIGHTS - LIBRETTO
|
|
Rezensionen
|
|
|
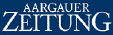
16. 3. 2004
Vom Liebeshimmel in die Rachehölle
Schweizerische Erstaufführung Georg Friedrich Händels «Radamisto» am Opernhaus Zürich
Die Inszenierung von Claus Guth ist hip, das Orchester klingt wundersam reich. Wer spricht schon davon? Marijana Mijanovic sang. Das ist der Satz, der schaudern macht.
Christian Berzins
Er war ein Superstar, ein Idol - und hinter Kastratenkönig Farinelli die Nummer zwei auf Europas Bühnen: Francesco Bernardi, genannt Senesino. Als der Kastrat 1720 nach London kam, schrieb Georg Friedrich Händel flugs seine 1712 geschriebene Oper «Radamisto» um: Die Stimme dieses Wundersängers musste mit neuen Arien beschenkt werden, ihrem Klang sollte die Orchestrierung angepasst sein.
Kalter Glanz und warme Trauer
Fast dreihundert Jahre später nimmt im Opernhaus Zürich die Altistin Marijana Mijanovic die Noten dieser Zweitfassung in die Hand und macht daraus Wunderklänge. Ihre Stimme verblüfft nicht so sehr durch technische Perfektion (obwohl alles bestens passt) oder besonders grosses Volumen (obwohl ihre Stimme einen erhabenen Klang hat), sondern durch ihren Charakter. Wie die weissen Wände im ersten Bild erscheinen die Stimmen der anderen Sänger. Mijanovics Stimme hingegen ist dem Marmor gleich, wie er an den Wänden der Zwischenbilder zu sehen ist. Das Timbre dieses Alts verströmt kalten Glanz, ihm ist eine trauernde Dunkelheit von übergrosser Wärme inne. So öffnen sich akustisch ungeahnte Strukturen, tausend Überraschungen beglücken.
Die «anderen» sind eine nett singende Malin Hartelius, ein sich wacker schlagender Reinhard Mayr, die quirligen Isabel Rey und Elizabeth Rae Ma-gnuson sowie eine wunderbare Liliana Nikiteanu. William Christie dirigiert die Spezialisten für Alte Musik des Zürcher Opernorchesters, die Formation La Scintilla: Herrlich, welch detailreichen Klang Christie erreicht. Warm und leicht ist er, zärtlich bald aufbrausend kann er sein.
Tumbe Handlung und doch Spannung
«Radamisto» von Georg Friedrich Händel singt und spielt man: Eine Oper mit einer arg tumben Handlung, die aber trotzdem fast vier Stunden dauert. Der mit Polissena verheiratete Tyrann Tiridate begehrt Zenobia. Sie aber ist mit Radamisto, dem Bruder von Polissena, verheiratet. Nach Wirren und Schrecken - Krieg, Selbstmordversuchen, Mordattacken und Racheakten - wird alles gut. Oder bleibt alles, wie es war…
Claus Guth schafft das Kunststück, aus der entwicklungsarmen Handlung einen spannenden Abend zu machen: Mit technischem Geschick, grosser Fantasie und dem Auge für abstrakte Bilder gelingts. Durch eine wenige Augenblicke dauernde Pantomime während der Ouvertüre gibt der Regisseur der Handlung ein Gerüst und versetzt die Zuschauer auf geniale Art und Weise mitten in das Drama.
Guth schafft es gar, den Zuschauern die Figur des Tiridate nahe zu bringen: Ein Mensch, von der Macht besessen, von Pillen, Blut und Zigaretten beruhigt. Dagegen kann nur die Liebe ankommen. Auf die pantomimische Ausgangsszene wird später in traumartigen Sequenzen verwiesen. Immer wieder tauchen auch die Protagonisten in eine eigene Traumwelt ab: Dort singen sie ihre grossen Arien, losgelöst von den Herumstehenden. Sie steigen also einerseits aus der einen Handlung aus, nicht aber, um szenenlos an der Rampe eine Arie vorzutragen, sondern um in einer zweiten Handlung ihre Gefühle preiszugeben. Dank einer raffinierten Drehbühne (Bühnenbild Christian Schmidt) gelangt man träumend von Raum zu Raum - vom Liebeshimmel in die Rachehölle.
|

16. 3. 2004
Klatschstory auf dem Bühnenrad
«Radamisto» von Händel als Schweizer Erstaufführung am Zürcher Opernhaus
Und sie dreht sich doch. Die Bühne im Zürcher Opernhaus. Man hat wieder etwas ausgegraben, eine Oper von Händel, «Radamisto». Die Opera seria, 1720 im King’s Theatre in London uraufgeführt, erklingt nun unter William Christies Leitung in Zürich. Ein Haus, das nicht gerade mit mutiger Uraufführungspolitik glänzt, sorgt für Repertoireerneuerung mit hierzulande erstaufgeführten Opern - knapp dreihundert Jahre nach ihrer Entstehung.
Von Benjamin Herzog
Es gibt den Tyrannen, er trägt Pelz und raucht und begehrt nicht mehr seine Frau Polissena, sondern Zenobia, die pikanterweise deren Schwägerin ist. Radamisto, Zenobias Mann und Polissenas Bruder, steht als Titelheld im Zentrum des Geschehens. Etwas ist nicht im Lot. Wie mit der Liebe einer einzigen Frau, so begnügt sich der Pelzträger, er heisst Tiridate, auch mit seinem Machtvolumen nicht. Er möchte Radamistos Anteil an der gemeinsamen Herrschaft erpressen. Der Herrschaft über ein Reich, über eine Frau - das kann dieser Machtmensch nicht so scharf trennen, weshalb er schliesslich auch bei dem Objekt seines Begehrens abblitzt.
Schöner Gesang
Claus Guth und sein Bühnenbildner Christian Schmidt erzählen die Geschichte mit ausgiebigem Gebrauch der Drehmechanik in zwei nach aussen gekehrten Hälften eines ovalen Raums. Diese Welt im klassischen Stil dreht sich zwar immer noch, aber um sich selber. Was zusammengehört, ist getrennt, kehrt sich den Rücken zu, ist verkehrt hingestellt. Damit ist die Ordnung gestört, aber nur so können wir auch hineinsehen. Ins Private, das hier massgeblich ist. Der ursprüngliche politische Kontext («Radamisto» entstammt den «Annalen» des römischen Historikers Tacitus), ist bereits in seinen Dramatisierungen im 17. Jahrhundert gewichen.
Das Leid, das Tiridates Übergriffe auslösen, ergiesst sich vornehmlich in schöne Gesangsnummern. Allen voran glänzt darin Liliana Nikiteanu. Die Sopranistin stösst in erstaunliche emotionale, aber auch ganz reale Tiefen vor. Etwa mit ihrer schwer seufzenden Cavatine «Quando mai, spietata sorte» zu Beginn des zweiten Akts. Ihre vom Tyrannen umgarnte Zenobia hält zum geliebten Radamisto. Der wird vom neuen Star der Zürcher Oper gesungen: der androgynen serbischen Altistin Marijana Mijanovic. Nicht optimal in Form, kamen ihre gestalterischen Fähigkeiten an der Premiere nur ansatzweise zur Geltung. Solide Leistungen erbrachten Malin Hartelius als Polissena, Rolf Haunstein als deren Vater Farasmane und, wenngleich an Grenzen stossend, Reinhard Mayr als Tiridate.
Starke Regie
In der Rolle der Fürsten Tigrane und Fraarte glänzten die spielfreudige Isabel Rey und Elizabeth Rae Magnuson, deren komisches Talent davon ablenkt, dass sie grösste vokale Virtuosität besitzt. Das macht viel aus in dieser Oper, deren Inhalt - eine moralisch abgefederte Klatschgeschichte - uns eigentlich wenig interessiert. Wohl lenkt der Tyrann am Schluss ein, bekehrt durch die Güte des ihm verzeihenden Radamisto. Doch blass ist das Hoch und Nieder der Stimmungen vor dieser Auflösung. Das «Barock»-Orchester des Opernhauses «La Scintilla» und William Christie begleiteten präzis, liessen aber wenig Farben und Stimmungen zu. Die vierköpfige Continuogruppe erlaubte sich sogar einige Patzer.
Der Bonus der Zürcher Produktion liegt in Claus Guths Regie. In der feinen Figurenpsychologie, in der Vermischung von Realität, Traum und Fantasie. Ein Ballett verdoppelt die Personen, stellt sie in herbeifantasierten Szenen dar. Zenobia «erdolcht» so ihren widerlichen Liebhaber, Tigrane erträumt sich das Tête-à-tête mit der Geliebten Polissena. Zu der ernsten Psychologisierung der Opera seria kommen Brüche, kommt die Nummer Fraartes als Gitarrenheld à la Presley, der seine Herrin aufmuntern will, kommen die Killer Tiridates mit Gelhaaren und Pilotenbrille.
Bei der letzten Drehung der Bühne sind wir wieder am Anfangsbild angelangt: Die Herrschaften bei Dessert und Champagner. Fraarte spielt wieder mit seiner Pistole, Tiridate beschmutzt sich erneut das Hemd, steht auf, als ob sich die Welt keinen Millimeter weiter gedreht hätte, und geht zu seiner Schwägerin. Ob er ihr noch einmal an den Busen greift, wissen wir nicht. Denn im Gegensatz zur Echtwelt hält jedes Bühnenrad irgendwann einmal an.
|

16. 3. 2004
Sex Intrige
VON ROGER CAHN
Denver und Dallas gab es schon im Barock. Georg Friedrich Händels «Radamisto» beglückte das Premierenpublikum am Sonntag in der Zürcher Oper.
Schwiegersohn Tridate (Bassist Reinhard Mayr) will Geld, Macht und seine Schwägerin Zenobia (Mezzosopranistin Liliana Nikiteanu) ins Bett. Die ganze Familie zittert vor dem Neurotiker und dessen Schergen. Doch unter Führung von Radamisto (Kontraaltistin Marijana Mijanovic) zwingt sie den Bösewicht in die Knie. Das Familienglück scheint wieder hergestellt.
Das tönt nach alter Klamotte. Doch Regisseur Claus Guth übersetzt das Geschehen in unsere Zeit und liefert den schlagenden Beweis dafür, wie barock unsere Gefühlswelt ist: Exzesse, Brutalität, Hemmungslosigkeit - ein Leben ohne Tabus. Christian Schmidt (Bühne und Kostüme) zeichnet auf einer ständig sich drehenden Bühne den idealen Rahmen mit nobler Villa und finsteren Gängen.
Der deutsche Komponist Georg Friedrich Händel (1685 - 1759) hat eine mitreissende Musik komponiert. Auf einem stimmigen Orchesterklang entfalten sich die Figuren in schwierig zu singenden Arien. Die ständigen Wiederholungen steigern die Gefühle ins Extreme. William Christie dirigiert mit Einfühlung und Liebe zum Detail. Sein rundes Klangbild ist voller Dynamik und Dramatik, und Längen werden kurzweilig.
Auf der Bühne steht ein homogenes Ensemble, angeführt von Marijana Mijanovic in der Titelrolle. Diese junge Serbin ist ein Phänomen. Mit ihrer buttersanften, androgynen Stimme und männlich wirkenden Erscheinung verkörpert sie den Idealtyp für Hosenrollen. Leider war sie an der Premiere - gesundheitlich bedingt - nicht in Top-Form.
Fazit: Ein schwieriges Werk musikalisch wie ästhetisch perfekt umgesetzt.
|

16. 3. 2004
Die Bühne als Reflexionsraum
Das Opernhaus Zürich inszeniert Händels «Radamisto» unter der Leitung des Barockspezialisten William Christie
Die Schweizer Erstaufführung von Händels «Radamisto» ist ein szenischer Versuch, der nicht recht aufgeht. Musikalisch zeigt er auf beneidenswertem Niveau, was und wie erfüllt Barockoper sein kann.
Tobias Gerosa
Dreieinhalb Stunden schon dauert die Familiensaga um Liebe, Hass und Eifersucht. Mehrmals kommt es um ein Haar zum Mord oder zur Vergewaltigung – und dann die letzten zehn Minuten: Alles löst sich in einem Duett und einem Schlusschor auf. Die während 35 Arien gesponnenen Ränke sind vergessen, die Verletzungen verschwunden: Un dì più felice, bramarsi non lice – einen glücklicheren Tag darf man sich nicht wünschen.
Der Dirigent William Christie, der in Zürich die Schweizer Erstaufführung von Händels «Radamisto» leitet, gehört zweifellos zu den Spezialisten, welche Händels Musik (auch durch historische Kenntnisse) heutig werden lassen kann. Mit ihm zeigt auch das Orchestra La Scintilla, das aus dem modernen Opernhausorchester entstanden ist, um sich ganz der historischen Aufführungspraxis zu widmen, mit seinem Klang und seiner Spielkultur deutlich, wie reich Händel komponierte und wie erfüllt seine Musik tönen kann.
An der Barockoper gescheitert
Szenisch ist es schwieriger. Historische Erkenntnisse helfen hier nicht weiter. Rekonstruktionen alter Inszenierungen würden höchstens lächerlich wirken und gerade bei Händel sicher nicht dafür sorgen, dass die zeitlose Aussage der Musik ankommt. Claus Guth (Regie) und Christian Schmidt (Ausstattung) haben es am Opernhaus auf eine sehr überlegte Weise und mit musikalischem Verständnis versucht – auf hohem Niveau, aber doch sind sie an den Eigenheiten der Gattung Barockoper gescheitert, die sich psychologisch nur zum Teil interpretieren lässt.
Guth und Schmidt lassen die Oper in zwei identischen, halbrunden Innenräumen spielen. Trotz Kronleuchter und Tapisserie sind wir im Heute bei einem Familienclan, wie er auch in Fernsehsoaps vorkommen könnte. Die hellen Räume sind die der Macht, und die hat sich Tiridate (Reinhard Mayr singt ihn mit etwas gar viel Schaugepränge als Bösewicht) eben mit Gewalt von seinem Schwiegervater Farasmane (Rolf Haunstein) geholt. Doch was er eigentlich will, ist seine Schwägerin Zenobia.
Wer sich gegen den starken Mann stellt, muss in den düsteren Gang zwischen den beiden Sälen, dorthin, wo Tiridates Bodyguards ihre Waffen offen tragen und wo konstant Unheil droht – eine starke räumliche Übertragung der Machtverhältnisse. Überzeugend auch, dass dieser Zwischenraum gleichsam als Spiegel wirken kann. Die Drehbühne ist konstant im Einsatz: Alles dreht sich und bleibt doch auf der Stelle.
Interessanterweise sind es nicht die langen Da-Capo-Arien, in denen die Inszenierung nicht vom Fleck kommt. Hier bewährt sich Guths Ansatz, das Innenleben und die Beziehungen der Personen zu verdeutlichen. Wie wenn sie sich selber zuschauen könnten, wird den Figuren die Bühne zum Reflexionsraum: Sie erleben Ereignisse nochmals, reflektieren oder können sich dank Doubles selber zuschauen. Die Handlung ist dabei angehalten – musikalischer kann man Händel nicht inszenieren, und Guth und seinen Darstellerinnen gelingen einige Male auf-schlussreiche musiktheatralische Momente. Vor allem dann, wenn Marjana Mijanovic als Radamisto, Liliana Nikiteanu als Zenobia oder Malin Hartelius als Polissena zu ihren so differenziert gesungenen Arien ansetzen.
«Labyrinth der Liebe»
Schwierig wird es dort, wo Guth nicht darum herumkommt, der Fabel zu folgen und die musikalisch so breit und farbig ausgedrückten Seelenzustände auch zu motivieren. Hier flacht die Inszenierung ab, am weitesten dort, wo die beiden Nebenfiguren Fraarte (die frisch und virtuos klingende Elizabeth Rae Magnuson) und Tigrane (Isabel Rey gesundheitlich stark angeschlagen) unnötigerweise zu Buffofiguren gemacht werden, deren Auftritte stilistisch genauso aus dem Rahmen fallen wie der golfende Tiridate oder die drehende Sabinerinnen-Plastik Giambolognas. Was sich so kaum ergibt, ist ein verbindender Bogen. Für den sorgt allein die Musik. Auch wenn die grossen Hit-Arien fehlen, ist das ganze Affektspektrum abgedeckt, nicht umsonst spricht das Leitungsteam von einem «exemplarischen Labyrinth der Liebe», und musikalisch wird dies auch eingelöst.
Perfektes Hörerlebnis
William Christie am Pult des Orchestra La Scintilla lotet das Spektrum ungemein differenziert aus. Andere Dirigenten gehen mehr in die Extreme, Christie bleibt immer elegant und tänzerisch, mit untrüglichem Sinn für Rhythmen und Farben. Das austarierte, junge und hochklassige Ensemble macht das Hörerlebnis perfekt.
|

16. 3. 2004
Seelenlabyrinth und Mafia-Comic
Ein raffiniertes Raum-Zeit-Gefüge löst im Opernhaus Zürich Händels strenge Opera seria «Radamisto» in ein Theater auf, in dem Musik und Bild, Figuren, Arien und Gefühle faszinierend ineinander kreisen.
Herbert Büttiker
Auch wenn Händel nicht der konsequenteste Vertreter der Opera seria war, so zeigt der «Radamisto» von 1720, die erste für die von ihm selber geleitete «Royal Academy» in London komponierte italienische Oper, doch deren dramaturgisches Grundprinzip. Einfach gesagt ist es der Zwiespalt zwischen dem Arienkonzert, auf das sich die Musik konzentriert, und dem Rezitativ, das die Handlung in Tönen skizziert, die eher Rhetorik als eigentliche Musik sind. In «Radamisto» folgen der Ouvertüre 37 Nummern, neben zwei Duetten, einem Quartett, einer Sinfonia und dem Schlusschor nicht weniger als 32 Arien. Die Handlung aber ist die eines szenenreichen Romans: Farasmane, der Herrscher von Thrakien, hat sein Imperium aufgeteilt auf seine Sprösslinge, den Sohn Radamisto, der mit Zenobia glücklich verheiratet ist, und die Tochter Polissena, deren Ehe mit Tiridate sich als fatal erweist. Dieser setzt sich nämlich in den Kopf, Herrscher des Gesamtreiches zu werden und dem Schwager die Frau auszuspannen. Was daraus folgt, ist in Stichworten: die Eroberung der belagerten Stadt, Zenobias und Radamistos Flucht, Selbstmordversuch der Zenobia, die in den Fluss springt, aber von Tiridates Leuten gerettet wird, Radamistos heimliches Eindringen ins feindliche Lager, das glückliche Wiedersehen der Liebenden, die sich je totgeglaubt haben, Polissenas Zerrissenheit, zwischen der Pflicht, ihren Bruder und – trotz allem – ihren Mann zu schützen, der Aufstand des Volkes, angeführt von Tigrane, der hoffnungslos in Polissena verliebt ist, schliesslich die Selbstbesinnung und Rückkehr des Tyrannen zu menschlichen Normen.
Drehbühne als Zeitmaschine
Auf das Nebeneinander aus stillstehender Arienzeit und pittoreskem Erzählraum reagiert die Zürcher Inszenierung mit einer ingeniösen Bühne. Christian Schmidt hat auf der Drehbühne spiegelbildlich zwei voneinander abgewandte identische halbrunde Räume angeordnet: hoch ästhetisches Palastambiente mit Kronleuchter, Wandteppich, Banketttisch oder herrschaftlichem Bett, je nach Szene. Dazu kontrastiert das rohe Fassadengemäuer der von den Innenräumen ausgesparten Bereiche. Düster und eng ist es hier. Die Drehbühne rückt je nachdem den einen oder anderen Schauplatz ins Blickfeld, und da alle durch Türen verbunden sind, können sie vor den Augen des Zuschauers in langen Gängen durchwandert werden.
Das tun sie ausgiebig. Claus Guths Regie lässt die Arien weit ausschreiten, und was den Figuren unterwegs begegnet, sind Bilder ihres Innern, in denen sie sich mal mutiger, mal feiger, mal entschlossener, mal inkonsequenter als in der wirklichen Handlungssituation benehmen. Zenobia, die ihre unerschütterliche Treue bekundet, ist auf diesem Gang in die Räume ihres Innern doch auch bereit, sich der Macht des Tyrannen zu beugen. Die Verdoppelung der Figuren durch Tänzerinnen und Tänzer, das Einfrieren in erstarrten Posen und nicht zuletzt eine surreale Beleuchtung laden dieses Psycho-Theater weiter auf.
Das alles mag nicht immer auf Anhieb gleich plausibel wirken, und die unablässige Bewegtheit weckt auch den Wunsch nach schlichterer Konzentration auf den Gesang. Aber immer wieder fasziniert das eigenartige Raum-Zeit-Gefüge der Inszenierung. Wenn der Sänger nach dem Arienweg, der ihn immer weiter weggeführt hat, genau mit der Schlusskadenz wieder dort ankommt, von wo er ausgegangen ist, um den Handlungsfaden wieder aufzugreifen, scheint die Zeit eben mal stillgestanden zu sein – ein «musikalischer» Effekt, der sich auf überraschende Weise im Grossen wiederholt, wenn sich am Ende wieder das Anfangsbild einstellt.
Das Traumwandlerische, das in diesem labyrinthischen Treiben die Figuren zu lenken scheint, kommt natürlich erst recht zum Tragen mit der traumwandlerischen Sicherheit, mit der Händels teilweise virtuos-akrobatischer Gesang vom Zürcher Ensemble gemeistert wird. William Christie stützt sich auf das zwar stark besetzte, aber sehr agile Orchestra «La Scintilla» der Oper Zürich und treibt die Tempi weit auseinander, wach und überlegen. Nur, Atemlosigkeit und Langatmigkeit waren nicht immer ganz gebannt, und das Glück des Duetts «Se teco vive il cor» am Ende des 2. Aktes wäre möglicherweise grössere gewesen, wenn es nicht so forsch (war das wirklich «Allegro ma non troppo»?) angegangen worden wäre. In vielen Arien jedoch kam die zündende Virtuosität des Laufwerks unerhört effektsicher zum Einsatz. Besonders brillant und mit der Zugabe treffsicherer Spitzentöne lieferte sie Elizabeth Rae Magnuson, wobei sie mit der Rolle des Fraarte, der nur untergeordnet am Geschehen beteiligt ist, nebenbei auch noch gekonnt eine lockere Blödelschau abzog.
Zündende Arienkunst
Passt sie in diese Werk? Die Inszenierung jedenfalls versteift sich nicht auf die heroische Stillage. Von den Kostümen her in einer obskuren High Society der Gegenwart angesiedelt – Farasmanes Reich ist vielleicht ein Firmenimperium oder etwas noch Schlimmeres –, liebäugelt sie auch mit einem Mafia-Comic und dem Schwulst der Vorabendserie, wozu Rolf Haunstein als alternder Patriarch ja auch ausgezeichnete Figur machte. Nur Isabel Reys Tigrane, im Libretto ein Principe di Ponto und durchaus ein heroisch Liebender, hat bei allem musikalischen Glanz, den er mitbekommt, unter diesem Milieu, in dem glänzende Pistolen und schwarze Sonnenbrillen zu den unverzichtbarsten Requisiten gehören, ein wenig zu leiden. Die weiteren Figuren bleiben in ihrer emotionalen Substanz unangetastet und entfalten ihre musikalische Expressivität ungebrochen.
Und wie! Reinhard Mayr ging die Partie des wütenden Tiridate in den Rezitativen vielleicht zu brüllerisch an, aber zur treffenden Figurenzeichnung trug der nervöse Griff zu Zigarette, Alkohol und Tabletten genauso bei wie der bewegliche Einsatz seines energischen Baritons. Liliana Nikiteanu als Zenobia gestaltete ihre vielen ausdrucksvollen Arien mit dem berührenden Legato und dem zündenden Temperament einer gereiften Stimme. Marijana Mijanovic als Radamisto stattete zumal das berühmte Largo «Ombra cara» mit überlegen ruhiger Phrasierung aus, liess aber auch – vor der Aufführung krank gemeldet – in den Allegro-Attacken bei aller Verve eine gewisse Verhaltenheit spüren. Malin Hartelius zog als Polissena alle Register ihres makellosen Soprans, und schlicht grandios war, wie sie in ihrer letzte Arie («Barbaro, partirò») die rasende Wut im tiefernsten Pathos auf die Spitze trieb und gleichzeitig – sie packt ihren Koffer – eine hochkomische Slapsticknummer lieferte: ein brillantes Kabinettstück, das dem nach vielen Seiten hin schillernden Händel-Abend eine Krone aufsetzte.
|

16. 3. 2004
Über Zivilcourage
«Radamisto» von Händel im Opernhaus Zürich
Wiewohl in Mode, jedenfalls allerorten ausgegraben, können sich Opern von Georg Friedrich Händel ziemlich in die Länge ziehen. Eine Arie nach der anderen und alle nach demselben Muster: mit einem Hauptteil, einem im Ausdruck zurückgenommenen, auch in eine andere Tonart versetzten Mittelstück und der Wiederholung des Hauptteils - da capo. So ist es auch bei «Radamisto» von 1720, Händels erster Oper für die damals neu gegründete Royal Academy of Music in London. Nicht weniger als achtundzwanzig Da- capo-Arien folgen sich hier im Verlauf von drei Akten und gut drei Stunden Spieldauer; ganz selten mischt sich eine Cavatina darunter oder ein Ensemble - da könnte es einem möglicherweise fad werden.
Auch von der Geschichte her, die hier erzählt wird. Sie dreht und dreht sich, bis alles derart ineinander verknotet ist, dass es für die Lösung schon einer sehr wundersamen Fügung bedarf. Die Rede ist von einem Vater mit Sohn und Tochter, und zur Befriedigung von Farasmane sind beide glücklich verheiratet: Radamisto mit Zenobia, Polissena mit Tiridate. Auch mit Amt und Würden sind sie versehen; der Sohn herrscht über Thrakien, der Schwiegersohn über Armenien. Doch aus dem Nichts heraus verlangt es Tiridate nach seiner Schwägerin Zenobia. Mit brutaler Willkür geht er zu Werk, verstösst er die Gattin und bricht er einen Krieg mit dem Nachbarstaat vom Zaun. Seine Gegenspieler indessen geben nicht auf. Arie um Arie stellen sie ihre Zivilcourage unter Beweis; am Ende siegt das Gute so vollkommen, dass kein Tropfen Blut fliesst. Das ist nicht ohne Aktualität, in der dramaturgischen Durchführung aber so krud, wie es nur in der Oper möglich ist.
Musikalisch ausgelotet
Dennoch hat das Opernhaus Zürich mit Händels «Radamisto» jetzt einen vielfach anregenden Abend im Programm: dank einer Aufführung, welche die Vorzüge des Werks mit Sorgfalt wie Vehemenz ans Licht stellt. Schon in der einleitenden Sinfonia mit der französisch überpunktierten Einleitung und dem wirbelnden schnellen Teil macht der Dirigent William Christie deutlich, dass er auf den zugespitzten Kontrast der Affekte zielt, und das hauseigene Barockorchester «La Scintilla» setzt dieses Konzept glänzend um. Sehr üppig kann sich da der Klang ausbreiten, und gleich kann er auch wieder zurückgenommen werden auf ein solistisch besetztes Concertino; abwechslungsreich die Tempi, die metrischen Konstellationen, die Artikulationen. Gut zu hören ausserdem, wie raffiniert die Holzbläser eingesetzt werden: teils colla parte, parallel zur Singstimme, teils konzertierend, also im Wettstreit mit ihr, teils als Färbung des Gesamtklangs. Und wunderbar, wie vielfältig in den Da-capo-Teilen nuanciert und ausgeziert wird - da sind ganze Entdeckungsreisen zu machen. Aber natürlich geht es bei einer italienischen Oper, wie sie Händel in London vertrat, weit weniger um Instrumentales als bei «Les Indes galantes» von Rameau im letzten Jahr; was bei «Radamisto» im Vordergrund steht, ist der virtuose Gesang.
Und da gab es an der Premiere zwar einige Einschränkungen, doch sang sich das Ensemble hörbar frei und fand zu immer bewegterer Gestaltung. Zwei Sängerinnen liessen sich als indisponiert melden, unter ihnen Marijana Mijanovi in der Hauptrolle des Radamisto; die junge, enorm begabte Altistin bewältigte ihre sieben Arien aber prächtig und liess etwa in «Ombra cara» am Anfang des zweiten Aktes eine herrliche Tiefe hören. In je eigener Weise ausdrucksstark Liliana Nikiteanu und Malin Hartelius in den Partien der standhaften Gattinnen Zenobia und Polissena, während Reinhard Mayr als der Bösewicht Tiridate mit überschäumendem Temperament operierte, in den finalen Koloraturen jedoch etwas ermüdet wirkte. Dass Isabel Rey in der Rolle des edlen Feldherrn Tigrane unter einer Indisposition litt, war zu hören; allerdings geriet ihr gerade die grosse Arie mit der obligaten Oboe am Ende des ersten Akts, bei der sie mit stimmlichen Problemen zu kämpfen hatte, besonders schön. Eine würdige Erscheinung, wenn auch bisweilen stilfremd opernhaft Rolf Haunstein als der alte Farasmane. Und blendend beweglich, witzig und frech Elizabeth Rae Magnuson in der Partie des Juniorministers Fraarte.
So hätte es gut und gerne ein Arienkonzert mit Bildern werden können - aber dem stellten sich der Regisseur Claus Guth und sein Ausstatter Christian Schmidt wirkungsvoll entgegen. Dass die ganz unterschiedlichen Temperamente der handelnden Figuren auch in der Körpersprache so krass herausgearbeitet werden, mag nicht nach jedermanns Geschmack sein; zum Teil geht es an die Grenze zum Chargieren, zum Teil wirkt es grob, ja plump. Aber immerhin ermöglicht es der Ansatz zusammen mit der aufs Bühnenportal projizierten Übersetzung, sich in dem nicht ganz einfachen Handlungsgefüge rasch zurechtzufinden. Und dass da und dort das Pathos durch szenischen Witz gebrochen wird - etwa wenn zwei Frauen in Hosenrollen auf der Herrentoilette Blutsbrüderschaft schwören oder die zornige Gattin ihren Koffer packt und dabei auch den Walkman nicht vergisst -, wirkt immerhin erfrischend.
Psychologisch erhellt
Weitaus interessanter jedoch der Versuch, das Gefüge der Oper auch szenisch zu nutzen. Wie sich die Handlung dreht, so dreht sich die Bühne. Gleichsam Rücken an Rücken stehen zwei Räume mit je einer halbrund gebogenen Rückwand: hell ausgeleuchtete Säle in strengem Klassizismus, dazwischen zwei düstere Vorplätze. Das erlaubt nicht nur schnelle räumliche Wechsel und szenische Beweglichkeit, in der Anlage spiegeln sich auch die musikalischen Formen. Zum Teil schon in den Mittelstücken der Da-capo-Arien, spätestens aber in den wiederholten Hauptteilen wandeln sich die Säle zu von unten beleuchteten, durch mächtige Schattenwirkungen geprägten Seelenräumen, in denen sich die Projektionen der singenden Figuren verwirklichen: Hoffnungen, Wunschträume, Ängste. So erhält die virtuose Aussenseite von «Radamisto» eine Tiefendimension, welche die Produktion ganz unprätentiös zum Ereignis macht.
Peter Hagmann
|

16. 3. 2004
Barocke Gefühle gehen durchs Ohr
Premiere von Georg Friedrich Händels «Radamisto» im Opernhaus Zürich
Zürichs Neuinszenierung von Händels «Radamisto» ist ein szenischer Versuch, der nicht recht aufgeht. Musikalisch zeigt er auf beneidenswertem Niveau, was und wie erfüllt Barockoper sein kann.
Tobias Gerosa
35 Arien und dreieinhalb Stunden schon dauert die Familien-Saga. Mehrmals kommt es beinah zum Mord oder zur Vergewaltigung - und dann die letzten zehn Minuten: Alles löst sich in einem Duett mit Schlusschor auf. «Un dì più felice, bramarsi non lice» - einen glücklicheren Tag darf man sich nicht wünschen.
Der Dirigent William Christie, der die schweizerische Erstaufführung von Händels «Radamisto» leitet, gehört zweifellos zu den Spezialisten - ebenso wie das «Orchestra La Scintilla», das mit seinem Klang und seiner Spielkultur den Reichtum von Händels Musik deutlich macht.
Alles dreht auf der Stelle
Szenisch ist es komplizierter. Historische Erkenntnisse helfen hier nicht weiter. Claus Guth (Regie) und Christian Schmidt (Ausstattung) haben es am Opernhaus auf eine sehr überlegte Weise und mit musikalischem Verständnis versucht - doch sind sie an den Eigenheiten der Barockoper gescheitert. Sie lässt sich nur zum Teil psychologisch interpretieren. In Zürich spielt die Oper in zwei identischen, halbrunden Innenräumen. Trotz Kronleuchter und Tapisserie sind wir im Heute bei einem Familienclan, wie er auch in Fernsehsoaps vorkommen könnte. Die hellen Räume sind die der Macht, und die hat sich Tiridate (Reinhard Mayr singt ihn mit etwas gar viel Schaugepränge als Bösewicht) eben mit Gewalt von seinem Schwiegervater Farasmane (Rolf Haunstein) geholt.
Zwischen den beiden Sälen, wohin die Verfolgten flüchten, liegt ein düsterer Gang - eine starke räumliche Übertragung der Machtverhältnisse. Überzeugend, dass dieser Zwischenraum gleichsam als Spiegel wirken kann. Die Drehbühne ist konstant im Einsatz: Alles dreht und bleibt doch auf der Stelle. Interessanterweise sind nicht die langen Da-Capo-Arien die Partien des Stillstands. Hier bewährt sich Guths Ansatz, die Beziehungen der Personen zu verdeutlichen. Wie wenn sie sich selber zuschauen könnten, wird ihnen die Bühne zum Erinnerungs- und Reflexionsraum. Die Handlung ist dabei angehalten. Musikalischer kann man Händel nicht inszenieren und so gelingen aufschlussreiche musiktheatralische Momente. Vor allem dann, wenn Liliana Nikiteanu als Zenobia, Malin Hartelius als Polissena oder Marjana Mijanovic als bezaubernder Radamisto zu ihren differenzierten Arien ansetzen.
Das ganze Affektspektrum
Schwierig wird es dort, wo Guth nicht darum herumkommt, der Fabel zu folgen und die Seelenzustände auch zu motivieren. Hier flacht die Inszenierung ab, am weitesten dort, wo die beiden Nebenfiguren Fraarte (die frisch und virtuos klingende Elizabeth Rae Magnuson) und Tigrane (Isabel Rey gesundheitlich stark angeschlagen) unnötigerweise zu Buffofiguren gemacht werden, deren Auftritte stilistisch genauso aus dem Rahmen fallen wie der golfspielende Tiridate oder die drehende Sabinerinnen Plastik Giambolognas.
Für den verbindenden Bogen sorgt allein die Musik. Auch wenn die grossen Hit-Arien fehlen ist das ganze Affektspektrum abgedeckt. William Christie am Pult lotet das Spektrum ungemein differenziert aus. Andere Dirigenten gehen mehr in die Extreme, Christie bleibt immer elegant und tänzerisch, mit untrüglichem Sinn für Rhythmen und Farben. Das austarierte, junge und hochklassige Ensemble macht das Hörerlebnis perfekt.
|

16. 3. 2004
Nicht nur darstellerisch überzeugend
Im Opernhaus Zürich wird Händels «Radamisto» aufgeführt
Seine erste Oper für die Royal Academy war einer von Händels grössten Triumphen. In Zürich wiederholte sich dank intelligenter Inszenierung und packender musikalischen Umsetzung die Geschichte.
Von Reinmar Wagner
Bloss ein kurzes Rezitativ braucht Tiridate um vom blutrünstigen Tyrannen zum guten König, ehrlichen Freund und treuen Ehemann zu werden. Sowas glaubt heute keiner mehr, auch nicht Claus Guth, der Regisseur dieser Aufführung von Händels «Radamisto».
Aber eigentlich ist es konsequent: In der italienischen Opera seria entwickeln sich die Handlungsstränge schnell und schnörkellos in den Rezitativen und in den grossen Da-capo-Arien dazwischen werden die Leidenschaften und Emotionen in höchster Koloraturvollendung zelebriert, während die Handlung quasi angehalten wird. Die italienische Barockopern sind so schwierig zu inszenieren, weil moderne Opernregisseure mit diesen Leerräumen szenischer Aktion in der Regel nichts anfangen können.
Verdoppelte Figuren
Anders Guth: Er ging den umgekehrten Weg und hob die Arien aus dem realen Geschehen heraus. Er machte dies zusätzlich deutlich, indem er manchmal die Szene stoppte und die Protagonisten aus dem Handlungsrahmen heraustreten und eine Tour um die ganze Drehbühne absolvieren liess. Die anderen Figuren wurden teilweise mit Tänzern verdoppelt. Dadurch ergeben sich unglaublich starke, suggestive Bilder.
Das zweite Kennzeichen einer Guthschen Inszenierung ist ihre Musikalität. Jede Aktion hat eine musikalische Entsprechung. Und das dritte ist: Er weiss genau, was er welchen Sängern zumuten kann und schafft damit rundum glaubwürdige Figuren, bis hin zum witzigen Auftritt von Elizabeth Rae Magnusonm, die eine ihrer Arien gekonnt als Heavy-Metal-Parodie aufs Parkett legte.
Beeindruckend auch das Bühnenbild von Christian Schmidt: Zweimal dasselbe klassizistische Halbrund in edlem Weiss, montiert auf der Drehbühne, womit sich zwei weitere Räume zwischen diesen repräsentativen Gemächern auftun. Das reicht allerdings noch lange nicht, entscheidend für den hervorragenden Gesamteindruck waren vor allem das gekonnte Timing und die unglaubliche Musikalität, mit welcher die Szenerien wechselten. Endlich einmal eine Produktion, welche die Drehbühne sinnvoll einsetzt und nicht wie sonst einfach endlos Karrussell fährt.
Da war es schon gar keine Überraschung mehr, dass sich am Schluss das Friede-Freude-Eierkuchen-Familienbild im letzten Moment zum Kreislauf rundete: Tiridate kann von Zenobia doch nicht lassen, wir stehen dort, wo wir dreieinhalb Stunden zuvor gestanden haben, und dies obwohl - das einzige Mal an diesem mitreissenden Opernabend - die Musik eine andere Geschichte erzählt. Es war halt bloss ein sehr kurzes Rezitativ ...
Extreme Emotionen
Nicht nur darstellerisch überzeugten die sieben Protagonisten, auch ihrer sängerischen Hauptaufgabe waren sie zufriedenstellend bis berauschend gewachsen. Isabel Rey und Marijana Mijanovic wurden als krank angekündigt. Die Spanierin war wirklich zeitweise am Ende ihrer Kräfte, stand die Partie schliesslich aber durch. Bei der Serbin mit der elektrisierenden Altstimme in der Titelrolle waren keine Schwächen zu hören: ein imposantes Rollenporträt. Dasselbe gilt für Malin Hartelius als Polissena, welche die extremen Emotionen, hin- und hergerissen zwischen der Treue zum untreuen Tyrannen und ihrer Familie, beeindruckend und anrührend zum Ausdruck brachte.
Rolf Haunstein meisterte seine erste Händel-Partie in 40 Jahren Sängerleben achtbar, Reinhard Mayr verlor sich in seinen Koloraturen, bewies aber sonst ebenfalls Gestaltungskraft und Ausstrahlung. Elizabeth Rae Magnuson war als (Ba-)Rocksängerin genauso tadellos wie Liliana Nikiteanu in ihrer ersten Händel-Partie. Sie bot ein prächtiges Beispiel dafür, wie Sänger heute, ohne Barock-Spezialisten zu sein, mit stimmlicher Beweglichkeit und stilistischem Gespür unter der Anleitung einer Koryphäe wie William Christie den sängerischen und technischen Anforderungen einer solchen Partie gerecht werden können.
Horrend schnelle Tempi
Die Barock-Fraktion «La Scintilla» des Zürcher Opernorchesters ist, was Klangfarben und Phrasierungen betrifft, von Christies eigenem Ensemble «Les Arts Florissants» kaum noch zu unterscheiden. Die traumwandlerische Sicherheit in der Umsetzung von Christies durchaus eigenwilligem Dirigierstil geht den Zürchern noch etwas ab, was hin und wieder zu Koordinationsstörungen zwischen Bühne und Orchester führte. Und die teils horrend schnellen Tempi sind bei aller instrumentalen Virtuosität dann doch an den Grenzen der spieltechnischen Fähigkeiten.
|

16. 3. 2004
Die Bühne dreht sich, die Geschichte auch
Das Zürcher Opernhaus zeigt Händels «Radamisto» als Schweizer Erstaufführung: dramatisch musiziert, musikalisch inszeniert.
Von Susanne Kübler
Vorhang auf für das feierliche Firmenessen: Der frühere Patron sitzt in der Mitte und kann nur mit Mühe davon abgehalten werden, eine Rede zu halten, rechts von ihm sitzt sein Sohn und Nachfolger Radamisto mit der Schwiegertochter (lila Seide), links sitzt der Schwiegersohn und ebenfalls Nachfolger Tiridate mit der Tochter (olivgrüne Seide), und eigentlich könnte man sich ans Dessert machen, wenn nicht Tiridate aufstehen würde, um der Schwägerin in den Ausschnitt zu greifen.
Der Auftakt zu Claus Guths Inszenierung von Georg Friedrich Händels Oper «Radamisto» macht schon vieles klar, was in den folgenden dreieinhalb Stunden geschehen wird. Erstens stehen nicht antike Könige, sondern heutige Geschäftsherren im Krieg (wobei man die mafiosen Züge des Tiridate fast ein bisschen bedauert: Oper und Mafia, das hat man inzwischen zu oft gesehen). Zweitens findet dieser Krieg weniger real als psychologisch statt (was zu Händel passt, der die eigentliche Schlacht musikalisch in ein paar Sekunden hinter sich bringt). Und drittens wird die verwickelte Geschichte um den bösen Tiridate und den guten Radamisto, um Besitzgier und Vergebung und die Erniedrigung der Frauen auffallend ruhig erzählt.
Die Musik lässt sich Zeit
Spätestens hier muss nun von der Musik die Rede sein. Nicht nur, weil sie letztlich der einzige Grund ist, weshalb diese Opera seria wieder zur Aufführung kommt; die Geschichte allein könnte man guten Gewissens archivieren. Sondern vor allem, weil sie stärker als in vielen anderen Aufführungen auch die Regie prägt.
William Christie sorgt mit dem operneigenen Barockorchester La Scintilla für theatralische Zuspitzungen, für grossräumige Kontraste zwischen den schnellen, virtuosen Arien und den melancholisch-verzweifelten. Der kräftige, eher trockene Klang mag weniger elastisch sein als jener von Christies eigenem Ensemble Les Arts florissants, aber er trägt ohne Spannungsverlust durch die zweite 1720er-Version der Partitur - und zeigt damit eine der grossen Qualitäten Händels: die Fähigkeit, der Musik Zeit zu lassen, Zeit für weit ausschwingende Melodien, für minutenlang ausformulierte Gefühle, für endlose Da-capo-Arien, während denen inhaltlich rein gar nichts geschieht.
Diese Kombination von viel Musik und wenig Handlung hat schon manchen Regisseur in den Hyperaktivismus getrieben, andere sind resigniert zum Rampensingen zurückgekehrt. Claus Guth aber hat sich von Ausstatter Christian Schmidt eine ideale Bühne bauen lassen: Eine Drehbühne, auf der sich zweimal derselbe ovale, weiss getäferte, variabel möblierbare Raum befindet. Die Personen wechseln über den Gang dazwischen von einem zum anderen, und oft geraten sie dabei von der Realität in den Wunschtraum oder die Erinnerung. Dann erstarren die anderen Figuren, die Zeit bleibt eine Arie lang stehen, und in der Imagination begegnen die Figuren sich selber respektive ihren Doubles: Die ermorden den Belästiger oder zeigen Liebe, wo in der Wirklichkeit keine ist. Neu ist die Idee solcher Doubles nicht, Guth hat sie in Zürich schon für Glucks «Iphigénie en Tauride» gehabt, aber sie schafft auch hier szenische Eindringlichkeit.
Mehr jedenfalls als die komischen Einschübe, denen der Regisseur doch nicht ganz widerstehen konnte. Wenn etwa ein Diener Radamistos gefangene Gattin mit einer Pseudo-Rock-Show und aus der Wand gezauberten Blumen aufheitern will, so ist das ein zwar witziger, aber letztlich doch deplatzierter Stilbruch: Zu ernst, zu geschlossen ist die Aufführung, als dass solche Abstecher ins Comicartige (das bei Händel sonst durchaus passen kann) funktionieren würden.
Guths Stärke ist nicht der Slapstick, sondern die genaue Beobachtung, die psychologische Vertiefung. Und die Musikalität, die sich nicht nur während der Arien, sondern auch zwischen ihnen zeigt: Wenn der letzte Ton verklingt, hat sich die Bühne meist schon zur nächsten Szene weitergedreht; mehr kann man nicht tun, um den Zwischenapplaus zu verhindern, der den schematischen Ablauf des Stücks endgültig betoniert. Das Premierenpublikum mochte seinen Enthusiasmus am Sonntag allerdings dennoch nicht aufsparen und stiftete den Abgangsapplaus damit jeweils als Auftrittsapplaus. Verdient war er in aller Regel so oder so: Die sängerischen Leistungen waren wieder einmal erfreulich.
Das ist nicht selbstverständlich, denn mit Ausnahme des Radamisto wurden alle Rollen mit Ensemblemitgliedern besetzt - und die haben bisher wenig Erfahrung mit Händel sammeln können. Nun hatten zwar einige Stimmen durchaus romantisches Gewicht, und manche Verzierungen wirkten eher akrobatisch als musikalisch. Aber Letzteres wird sich geben, und Ersteres sorgt für eine gar nicht unwillkommene Abwechslung in einem Stück, in dem die hohen Stimmen im Übergewicht sind.
Warme Höhe, männliche Tiefe
So singen etwa beide Diener Sopran, aber Elizabeth Rae Magnusons ungemein leichte Koloraturen klingen ganz anders als die zurückhaltendere, zuweilen etwas flackernde Differenziertheit der als indisponiert angekündigten Isabel Rey. Höchst unterschiedlich wirken auch die beiden Prinzessinnen: Malin Hartelius trauert anrührend und stilsicher um den untreuen Tiridate, Liliana Nikiteanu singt ihm ihren Hass mit vibratoreicher Leidenschaftlichkeit entgegen. Reinhard Mayr entgegnet beiden mit aufbrausendem Bass und fahrig-fiesen Gesten (und hält damit den ausgeglichenen, nicht ganz akzentfreien Bass von Rolf Haunsteins Vaterfigur auf Distanz).
Herausragend war aber die Altistin Marijana Mijanovi, die letztes Jahr im Händel-Oratorium «Il trionfo del tempo e del disinganno» ein begeisterndes Zürcher Debüt gab und nun als Radamisto brillierte: mit unaufdringlicher Virtuosität, mit warmer Höhe und fast männlicher Tiefe, mit androgyner Bühnenpräsenz und einem «Ombra cara», dem man noch viel länger hätte zuhören mögen. Dass Radamistos Umkippen von der Rachlust zur Vergebung am Schluss nicht einleuchtet, liegt nicht an ihr, sondern am Stück, das sozusagen im Zeitraffer zum Happyend kommt.
Immerhin: Musikalisch führt diese abrupte finale Kehrtwendung zu einem prächtigen Sextett, und irgendwie geht die Geschichte dann doch wieder auf, wenn sich nach der Bühne auch das Werk im Kreis gedreht hat (und die Regie ihr berechtigtes Misstrauen an der plötzlichen Idylle anbringen kann): Am Ende sitzen alle wieder am Tisch und besingen den glücklichsten aller Tage, und man könnte sich ans Dessert machen, als Tiridate aufsteht, hinter die Schwägerin tritt - und Guth die Inszenierung ein letztes Mal erstarren lässt. Die Idee mit dem Ende, das der Anfang ist, ist zwar ebenfalls nicht neu, aber auch sie passt hier ausgezeichnet.
|

16. 3. 2004
Trotz Problemen viel Applaus erhalten
Opernhaus Zürich: Premiere von Georg Friedrich Händels Opera seria «Radamisto»
Wie stürzt man einen Tyrannen im Machtrausch? Man versagt ihm ganz einfach die Gefolgschaft und unterstützt dessen Gegner. So jedenfalls erzählt es uns die Geschichte des Radamisto von Georg Friedrich Händel und seinem Librettisten Nicola Francesco Haym. Die dreieinhalbstündige Opera seria hatte am Sonntag am Opernhaus Zürich Premiere. Trotz einiger Längen und sängerischer Probleme gab es begeisterten Applaus. William Christie stand am Dirigentenpult, Claus Guth und Christian Schmidt zeichneten für die spritzige Inszenierung und schlicht-schöne Ausstattung.
Wenig beachtete Oper
Händels «Radamisto» gehört zu den wenig beachteten Opern des Barockmeisters. Diese Opera seria schrieb er kurz nach seiner Übersiedlung nach London für das neu gegründete Londoner King's Theatre Haymarket, um die Engländer mit der Italienischen Oper vertraut zu machen. Sicher spürt man schon in dieser Seria die Raffinesse, mit welcher Händel Trauer und Liebesglück schildert. Die schematischen Formen werden sanft aufgebrochen und der vorherrschenden Stimmung angepasst. Und doch hätte es der Zürcher Produktion nicht geschadet, wenn man diese Oper sanft gestrafft und einzelne Arien, vor allem der ewig leidenden Zenobia, gestrichen hätte.
Die Geschichte des Radamisto ist an sich schnell erzählt. Der alte Herrscher Farasmane hat sein Reich unter seinem Sohn Radamisto und seinem Schwiegersohn Tiridate aufgeteilt. Doch Tiridate, erst einmal an der Macht, will nicht mehr teilen. Er will das ganze Reich für sich, begehrt Zenobia, die Frau Radamistos, und will alle morden, die ihm nicht gehorchen. Zudem verhöhnt und betrügt er seine Frau. Und doch ist es die bei aller Demütigung treue Gattin Polissena, die den Tyrannen schliesslich vor dem Attentat ihres Bruders rettet. Und damit nimmt die Tyrannei ihren Lauf ...
Konzentration auf den psychologischen Aspekt
Claus Guth konzentriert sich in seiner Regie ganz auf das Psychologische dieses Familienzwists, das repräsentative Herrschertum tritt in den Hintergrund. Dementsprechend wird auch kein pompöses Austattungstheater betrieben. Die Figuren sind mit eleganten, schlicht modernisierten Kostümen eingekleidet, und Bühnenbildner Christian Schmidt hat ein funktionales Dreh-Bühnenbild entworfen. Es gliedert die Drehscheibe in zwei spiegelbildliche Räume (Esssaal und Schlafzimmer), und in der Vierteldrehung zeigt sich ein dunkler Korridor, sozusagen der Blick hinter die Fassade. Durch die Drehbewegung wird es möglich, die Protagonisten bei ihren Gängen durch die Räume mitzuverfolgen. Und wenn sie von der Drehbühne in den Vordergrund treten, bleiben sie stehen, während die Szenerie weiterzieht.
Diese Räume sind durch massive Holzwände unterteilt, so dass die Sängerinnen und Sänger bei ihren Gängen ständig die schweren Türen auf- und zuschletzen, ja oft auch zuknallen müssen. Das kann einen mit der Zeit recht nerven. Und doch geht diese Drehbühnenidee voll auf. Szenenwechsel sind ein Kinderspiel, die Drehbewegung bekommt symbolische Kraft - alles dreht sich im Kreis - und die Protagonisten sind auf der Flucht vor dem Tyrannen viel in Bewegung. Um so bedrohlicher wirken dann auch die vermeintlich ruhigen, intimen Szenen im Schlafzimmer.
Gnadenlose Tempovorgabe
Auch William Christie setzt auf Bewegung und Tempo. Das auf historischen Instrumenten spielende hauseigene Orchester «La Scintilla» wurde nicht im Orchestergraben versenkt, sondern hochgefahren. Es reagierte subtil auf die körperbetont heftigen Bewegungen des Dirigenten, spielte im rasenden Tempo leichtfüssig und stringent und formulierte die Soli der Oboe d'amore und anderer Bläser genüsslich aus.
Doch die Koordination mit der Bühne machte einige Schwierigkeiten. Das lag vor allem an Christies gnadenloser Tempovorgabe, die recht unflexibel wirkte und die Sängerinnen gerne im Regen stehen liess. Kein Wunder, hinkten sie manchmal hinten nach, bei so viel Tempo, Bewegung und Spiel.
Kam dazu, dass Intendant Alexander Pereira vor der Premiere die Ankündigung machen musste, dass die beiden Hosenrollen-Sängerinnen, Marijana Mijanovic und Isabel Rey, am Mittag eine schwere Magenverstimmung bekamen. Doch beide hatten sich entschieden, trotz Übelkeit ihre auch physisch fordernden Partien zu singen. Isabel Rey hatte als abtrünniger Getreuer des Tyrannen, der unsterblich in Polissena verliebt ist, denn auch mächtig zu kämpfen, vor allem im ersten Teil. Sie hatte nicht nur deutliche Intonationsschwierigkeiten, sondern fiel einmal sogar fast ganz aus der Rolle. Nach der Pause aber fing sie sich gut auf und hielt bis zum Schluss durch.
Marijana Mijanovic hatte zwar ebenfalls etwas Mühe mit der Spannkraft des Zwerchfells, vermochte aber mit ihrem angerauhten, dunklen Timbre und der schlanken Stimmführung einen eigentümlich androgyn faszinierenden Radamisto zu vermitteln.
Starke Frauenstimmen
Als die betrogene Tyrannen-Gattin Polissena wusste Malin Hartelius den Zwiespalt zwischen Selbstachtung und Hörigkeit mit einer überzeugenden Farbpalette und Stimmkraft darzustellen. Die Szene, in der sie endlich zornentbrannt ihren Koffer packt, gehört in ihrem subtilen Humor zu den Höhepunkten dieser Inszenierung. Als Polissenas Gegenüber ist die Zenobia von Liliana Nikiteanu ein zwar zarteres, aber um so widerspenstigeres Geschöpf. Sie macht aus ihrer Abscheu vor dem gierigen Tyrannen keinen Hehl und wehrt sich mit Händen und Füssen gegen seine besitzergreifende Macht. Auch das ergibt ein quicklebendig schillerndes Frauenbild.
In dieser farbig temperamentvollen weiblichen Umgebung wirkt der Tenor Reinhard Mayr als Bösewicht Tiridate stimmlich nicht ganz so vielschichtig. Darstellerisch weiss er zwar mit ausdrucksstarker Gestik den Tyrannen zu stellen, bleibt sängerisch aber zu gleichförmig. Und Rolf Hauenstein gibt den alten Herrscher Farasmane in seinem kurzen Auftritt mit etwas gar gewaltiger Bassstimme.
Doch weiss Elizabeth Rae Magnuson in der Hosenrolle des zweiten Getreuen Fraarte mit witziger Leichtigkeit und pseudo-machohafter Männlichkeit subtile Komik zu setzen. Ihre Aufheiterungsszene für die vor dem Selbstmord gerettete Zenobia und die brillante Verschwörerszene mit Isabel Rey in der Toilette sind die Highlights dieser dunklen Tyrannen-Geschichte.
Sibylle Ehrismann
|
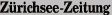
16. 3. 2004
«…Pace - Guerra - Amore…»
Bald dreihundert Jahre nach der Uraufführung kommt Händels «Radamisto» erstmals ans Opernhaus
Das Zürcher Opernhaus, wer hätte es nicht bemerkt und begrüsst, ist in den letzten Jahren zu einer Hochburg der Barockoper geworden. Die jüngste Neuinszenierung, Händels «Radamisto», schliesst da auf höchstem Niveau an: fantastisch intoniertes, fantastisch inszeniertes Musiktheater.
WERNER PFISTER
Die Begeisterung des Publikums zum Schluss, die Applaus-Salven für alle Beteiligten, vor allem aber für den mit viel Bravorufen bedachten Regisseur Claus Guth, für den Bühnen- und Kostümbildner Christian Schmidt sowie für den Dirigenten William Christie, nahmen demonstrative Ausmasse an. Fast hätte man sich an die Uraufführung zurückversetzt wähnen, können, am 27. April 1720 in der Londoner Royal Academy, wo Händel mit dem Posten eines «Master of the Orchestra» betraut war. «Radamisto» nämlich, seine erste Oper, die er hier vorstellte, wurde zu einem seiner grössten Erfolge überhaupt. «Radamistus, a fine opera of Handel's Making», notierte Mary, Countess Cowper, nach der Uraufführung in ihr Tagebuch, und «The King there with his Ladies.» Das ist, wie wenn heute ein Bundesrat samt Gattin die Premiere mit ihrer Anwesenheit beehren würde (und sie taten es in der Tat).
Liebe
In Zürich wurde die zweite Fassung der Oper gespielt, die Händel in seiner zweiten Londoner Saison Ende Dezember 1720 erstmals zur Aufführung brachte - neu eingerichtet für einen Star seiner Zeit, für den Kastraten Francesco Bernardi («Senesino» genannt), um neun Arien erweitert und durch die Transponierung einiger Partien in eine ganz neue Klangwelt gerückt. Trotz der Weiträumigkeit - die Zürcher Aufführung dauert wohl dreieinhalb Stunden -, zeichnet sich das Werk durch eine zügige Straffheit aus; die einzelnen Figuren resp. die Situationen, in denen sie stehen und durch die sie sich hindurch kämpfen müssen, sind musikalisch, souverän charakterisiert.
Thematisch ist dieser «Radamisto» eine ziemlich komplexe Familiengeschichte: komplex deshalb, weil die Liebe hier ihr eigenes Spiel treibt und gewisse Menschen antreibt, sich entsprechende Erfüllung zu verschaffen - koste es, was es wolle; wenn nötig auch einen Krieg. Damit wird, zusätzlich zur rein persönlichen Ebene, zu den glücklichen Paaren und den unglücklich in die Liebe Verstrickten, eine politische Dimension der Handlung geschaffen, und der Krieg zwischen Tiridate, Herrscher von Armenien, und Radamisto, der über Thrakien gebietet, steht denn auch bald vor der Tür.
Bettflasche
Faszinierend ist, wie der Regisseur Claus Guth diese persönliche und politische Ebene miteinander (und gegeneinander) ins Spiel bringt. Die zwielichtigen Politiker resp. politischen Mitläufer verstecken ihr Gesicht hinter Sonnenbrillen, der Herrscher selbst spielt standesgerecht Golf, und wenn er vor lauter Macht- oder Liebesgier ausrastet, greift er nervös zur Zigarette und gleichzeitig zu einem Tranquilizer.
Seine Gattin, von ihm schon lange hintergangen, wird über diesen Sachverhalt der ehelichen Untreue mit einschlägigen Fotos, wie sie ein Privatdetektiv schiesst, aufgeklärt. Und wenn sie dann wirklich genug hat und geht, - eine Szene, die in jeder TV-Soap vorkommen könnte -, dann packt sie während ihrer dramatischen Abschiedsarie «Barbaro, partirò» unmissverständlich den Koffer, und alles muss da rein, vom handlichen CD-Player samt Headset bis zu einer roten Plastik-Bettflasche.
Perspektiven
Eine Inszenierung also ganz aus der heutigen Zeit gedacht und von Christian Schmidt, dem Bühnen- und Kostümbildner" auch in ein heutiges Ambiente gekleidet. Für die Bühne hat er zwei herrschaftliche Räume geschaffen, je in einem Halbrund nach hinten begrenzt, und die stehen sich, die Hinterseite gleichsam gespiegelt, um 180 Grad gegenüber. Wird die (Dreh-)Bühne dann nur um 90 Grad gedreht, sieht man von seitwärts die Hinterseiten beider Räume sowie den Zwischenraum, der ebenso intensiv als Spielraum genutzt wird.
An dieser Raumkonstellation ändert sich grundsätzlich nichts. Das heisst im übertragenen Sinn, dass sich auch die Sachverhalte nicht ändern, sondern alles nur eine Frage der wechselnden Perspektive ist. Manchmal scheint die Zeit still zu stehen; manchmal läuft sie - wie die Drehbühne sich bewegt - von einem Handlungsraum zum nächsten, und die Mitspieler auf der Bühne folgen und hasten durch eine Vielzahl von Türen. Mal haben die Räume ein pompöses Aussenleben, dann wiederum zeigen sie ihr Innenleben, und alle Wände sind dann nur noch Fassade.
Ums Innenleben der Protagonisten ist es auch der Regie zu tun, um die Vielfalt (und Widersprüchlichkeit) psychologischer Perspektiven. Vielleicht am eindrücklichsten, jedenfalls am witzigsten, wird das zu Beginn des dritten Akts gezeigt: Zwei Sopranistinnen, als Herren verkleidet, da sie ja Männerrollen singen, diskutieren im Waschraum eines Herren-WCs. Sie haben definitiv genug vom grausamen Herrscher: «Pace» sprayt die eine mit Rasierschaum auf die Spiegelfront über den Lavabos, «Guerra» sprayt die andere ebenso dezidiert mit Gel, und in beiden Fällen ist letztlich - das dritte gesprayte Schlagwort - «Amore» der Auslöser, die Liebe also, die beflügelnde resp. zerstörerische.
Zum Schluss indes sind, alle wieder in Minne vereint, sitzen an der grossen, weiss gedeckten Festtafel, ein üppiges Gelage, gerade wird das Dessert gereicht, Zigaretten werden angesteckt, die Gläser erneut mit Schampus gefüllt - genau dasselbe Bild übrigens wie zu Beginn der Oper, als der Vorhang bereits während der Ouvertüre hochging: Man darf über den Sinngehalt spekulieren.
Pop-Star-Parodie
Dem ungeheuer vitalen Einfallsreichtum, wie er - optisch und szenisch-interpretatorisch - auf der Bühne waltet, entspricht die musikalische Souveränität dieser Inszenierung. Ein Glücksfall die Sängerbesetzung: Hier stimmt einfach alles; hier gibt es keine Neben-, sondern nur Hauptrollen. Marjana Mijanovic ist ein nobler Radamisto von edler Erscheinung, Mann und Frau in einem, auch stimmlich, wo ein exquisites, wunderbar sonores Alt-Timbre immer wieder mit den Facetten eines männlichen Falsettisten zu spielen scheint. Liliana Nikiteanu hat für die unglückliche Zenobia die perfekte Mischung aus dunkel glühenden und golden glänzenden, aufbegehrerischen Mezzosoprantönen.
Malin Hartelius ist als Polissena ganz grande dame: in ihrem mit stiller Zuversicht ertragenen Ehe-Leid, aber auch in den dramatischen Ausbrüchen, wenn sie einerseits genug hat und wenn sie am Schluss dennoch zu ihrem Gatten, dem Tyrannen, steht. Zudem, einen kostbareren lyrischen Sopran hört man selten. Isabel Rey, die als Sopranistin den Tigrane verkörpert, einen Handlanger und Mitläufer des Tyrannen, bringt metallischen Glanz und auch viel schauspielerische Entschiedenheit in ihre Darstellung. Elizabeth Rae Magnusen schliesslich, die als Sopran den Fraarte singt, also einen Vertrauten des Tigrane, mobilisiert neben einer stupenden Koloraturgeläufigkeit auch eine herrlich komödiantische Begabung: wenn sie die unglückliche Zenobia tröstet und, um gesteigerter Überzeugungskraft willen, vom Dirigenten eine Gitarre verlangt und flugs einen Pop-Star parodiert.
Temperament
Auch Reinhard Mayr geht in seiner Partie des Tyrannen Tiridate vollkommen auf: mit Exaltationen in Spiel und Stimme, ein Mensch, der scheinbar keine Grenzen mehr kennt oder respektiert. Und Rolf Haunstein ist ein würdiger, in seinen wenigen Auftritten sehr präsenter Fatasmane. William Christie ist für die musikalische Leitung verantwortlich, und er tut das mit ungeheurem Temperament, heizt seinen Musikern mit forschen Tempi tüchtig ein und koordiniert das bunte Geschehen auf der Bühne souverän mit den exquisiten Klangfarben im gross besetzten Orchester «La Scintilla» der Oper Zürich, welches auf historischen Originalinstrumenten spielt.
Die Partitur sprüht vor Lebendigkeit, ein Wahrhaft schillerndes Juwel. Immer wieder blitzt ein neues koloristisches Spektrum auf; eine martialische Kriegssinfonie zeigt, wie man nur in 30 Sekunden eine,ganze Bühne voll Menschen massakrieren kann. Und in Radamistos grosser Arie «Ombra cara» (die Händel neben «Cara sposa» aus dem «Rinaldo» für seine beste Arie überhaupt hielt) wird gleichsam schon die Schlüsselszene aus Glücks «Orpheus und Eurydike» im Schattenreich antizipiert. Sinnlich eloquent auch die Rezitative, die von Theorbe, Cello, Kontrabass und Cembalo ungemein «sprechend» begleitet werden. Das sitzt, ist alles wie aus einem Guss, ist fesselnd und abwechsIungsreich und gibt dem Zuschauer, der seinen feinen Spass hat, erst noch das Gefühl, alle Beteiligten hätten ebenso ihren Spass.
|

16. 3. 2004
Händels reine Sinnlichkeit
Helden braucht die Oper: William Christie dirigiert ¸¸Radamisto" in Zürich
Nach über dreieinhalb Stunden haben die Züricher Opernanhänger denn auch ihre Wahl in Sachen Heldentum getroffen und feiern Dirigent William Christie und Regisseur Claus Guth vor allen Sängern wie Götter. Wobei es kaum schwer fällt, die Wahl Christies nachzuvollziehen. Der seit über dreißig Jahren in Paris ansässige Großmeister vokaler Barockmusik hat den Abend von Anfang an als unumschränkter Herrscher im Griff. Er kennt seinen Georg Friedrich Händel bestens, auch wenn dessen ¸¸Radamisto" kaum jemandem geläufig sein dürfte. Was auf keinen Fall an der Qualität der fast vierzig Musiknummern oder des mit einer verwickelten Liebesintrige beschäftigten Librettos liegt.
Händel schrieb das Stück 1720 als Erstling für die im Jahr zuvor gegründete Royal Academy of Music, eine Liebhaberorganisation zur Verbreitung der italienischen Oper in London. Also gab er sich besonders viel Mühe, hatte großen Erfolg, und schaffte mit der im gleichen Jahr gegebenen Zweitfassung, für die er einige der besten Sänger der Zeit einsetzen konnte, noch einmal eine deutliche Verbesserung des Sujets.
Wenn man sieht, wie Christie mit großen Schaufelbewegungen im Orchester wühlt, wie er dämpft, fordert, beschwört, anheizt, Eleganz einklagt und dann die Blechbläser rau dreinschmettern lässt, dann fällt es nicht schwer zu begreifen, warum seit über zehn Jahren der Barock- und Händelopernboom die europäischen Theater fest im Griff hat. Dieser unmittelbar durch rhythmischen Furor überwältigenden Art von Oper ist jedes komplizierte Denken fremd. Jede Arie, und es gibt fast ausschließlich Arien, beschäftigt sich mit einer ganz klar umrissenen Gemütslage. Gerissenheit, Trauer, Wut, Triumph, Rache, Verliebtheit, Lebensüberdruss, Gier, Hass, Unentschlossenheit werden jeweils als isoliertes Einzelerlebnis behandelt und im Verlauf der Oper wie Perlen auf einer Schnur aufgereiht.
So entsteht eine leicht nachvollziehbare, wenn auch für die Librettisten durchaus nicht leicht konstruierbare Dramaturgie, die deshalb so stark wirkt, weil nie Philosophisches, sondern immer nur Gemütszustände rein sinnlich vermittelt werden. Barockoper bedeutet in ihrem klaren Aufbau eine Einfachheit, nach der sich große Teile des Publikums sehnen, nicht zuletzt angesichts der intellektuellen Kompliziertheit neuer Musik.
Doch die Barockoper fordert eigene Musikästhetik. Das haben die traditionellen Orchester und Sänger in den letzten Jahrzehnten lernen müssen. Zürich hat bei diesem Lernprozess nach wie vor die Nase ein wenig vorn. Das beweist die Existenz des auf Originalinstrumenten spielenden Orchesters La Scintilla, in Eigeninitiative der Züricher Opernmusiker gegründet - im ¸¸Radamisto" schlichtweg hinreißend: dunkel im Klang, vielleicht fast schon zu romantisch timbriert, von hoher Virtuosität.
Agilität als Lebenselixier
Seit den siebziger Jahren, seit dem legendären Monteverdi-Zyklus, der in seiner Bedeutung allenfalls noch vergleichbar ist mit dem Bayreuther ¸¸Ring" von Patrice Chéreau, arbeitet man in Zürich mit Nikolaus Harnoncourt zusammen. So hat man eingesehen, dass Barockoper eine Agilität erfordert, die der Musik seither verloren ging. Die plötzliche Attacke, die stets funkelnde, natürliche Rauheit des Orchesterklangs oder das Schwung-statt-Kraft-Prinzip, das mühelos dahinstürmende Allegro als ästhetische Grundlage und das abgrundtiefe, aber nie sentimentale oder unter psychischem Leidensdruck stehende Largo als Gegenentwurf: Diese Dinge sind mit einem modernen Orchester nur unter größten Mühen darstellbar.
Historische Instrumente sind zudem leiser als moderne. Das garantiert die grundsätzliche und für Barockoper unverzichtbare Dominanz der Sänger. Zumal sich in den letzten Jahren ein ganz neuer Typ von Sängern, speziell von Sängerinnen, entwickelt hat. Marijana Mijanovic, der Züricher Radamisto, ist das beste Beispiel dafür: eine hinreißend elegante Erscheinung, groß, schlank, kurze schwarze Haare. Ein androgyner Typ, eine Idealbesetzung für die Titelpartie, für diesen Radamisto, der um seine Frau kämpft, die ihm der Despot Tiridate mit allen Mitteln ausspannen will. Mijanovics Stimme ist nicht groß, vielleicht auch ein wenig zu gleichförmig - aber immer agil und betörend dunkel.
Solche Frauen, gerade Mezzosopranistinnen und Altistinnen, bestimmen heute mehr noch als die - allein schon zahlenmäßig unterlegenen - Countertenöre die Opernszene. Diese Frauen sind meilenweit entfernt von ihren Vorgängerinnen, die oft nicht nur stämmig wirkten, sondern auch stämmig sangen und im Breitwandsound die Opernhäuser beschallten. Heute gilt der Kult des Leisen und des Eleganten.
So dominieren denn auch die Sängerinnen in Zürich. Während die Männer, Reinhard Mayr als Despot Tiridate und Rolf Haunstein als besorgter Vater, eher durch deftige Leidenschaft auffallen. Malin Hartelius als Polissena, die Frau des Despoten, geht so pragmatisch wie tief getroffen damit um, dass ihr Mann auf Radamistos Gattin Zenobia scharf ist. Wobei Liliana Nikiteanu als Zenobia sängerisch umso stärker wird, je zudringlicher der Despot sich gibt. Immer lässt sie die Möglichkeit offen, ob ihr diese Anmache nicht doch gefällt.
Regisseur Claus Guth hat sich von seinem Ausstatter Christian Schmidt zwei ganz in Weiß gehaltene identische Apsidenunterteile auf die Drehbühne bauen lassen, die meist während der Arien in Bewegung kommt. Hierhinein inszeniert er etliche Arien als ein Innehalten in der Zeit, als einen Gedanken, der plötzlich Musik wird und aus der Handlung heraustritt. Claus Guth lässt die langsamen, von Trauer, Verzweiflung und Schmerz geprägten Arien unbehelligt sich entwickeln.
Bei den bewegteren Stücken, die für ein heutiges Publikum oft eine Art unfreiwilliger Komik entwickeln, lässt er diese Komik offen zu. So, wenn die edel gestimmte Isabel Rey und die draufgängerisch freche Elizabeth Rae Magnuson, beide männliche Parteigänger des Despoten, dessen Absetzung auf dem Klo planen. Das ist so harmlos wie nett, denn dem Abend geht es, ganz wie zu Händels Zeiten, ums pure Amusement des Publikums und nicht um intellektuelle Vergegenwärtigung. Aber auch das kann Oper sein, und die Züricher beherrschen diese vergnügliche Spielart recht vorzüglich.
REINHARD J.BREMBECK
|

17. 3. 2004
Gott wohnt in Paris
Barockopern boomen: Großmeister William Christie dirigiert in Zürich furios "Radamisto"
von Manuel Brug
Der Ouvertüren-Auftakt wird gegeben, als stünde da Moses, der die Gesetztafeln erhält. Mit dramatischer Armgebärde links, abgespreizten Fingern rechts, der Mund aufgestülpt, die Augen beschwörend zielgerichtet. Freilich nicht wild michelangelesk, sondern eher in der ausgezierten Manier der französischen Bildhauerkunst à la Houdon oder Pigalle. Trotzdem erklingt unter William Christies heilenden Händen bald Italienisches: Georg Friedrich Händels arienpralles Londoner Frühwerk "Radamisto" von 1720.
Klaus Guth hat am Züricher Opernhaus den orientalischen Familienkuddelmuddel, wo jeder Potentat die falsche Ehefrau liebt und deshalb deren Gatten an die Gurgel will, reichlich schematisch in Denver/Dallas-Manier als zeitgenössische Palastintrige mit Revolver, Straps und Sonnenbrille zwischen die Türen von Christian Schmidts kühle, unaufhörlich kreiselnde Klassizismus-Apsiden gestellt. Mit der bald öden Bilderwelt aus zweiter Regiehand versöhnen - neben Marijana Mijanovics androgyn herbem Titelhelden, neben Liliana Nikiteanu, Reinhard Mayr und Malin Hartelius - vor allem die leidenschaftlich pulsierenden, dabei stets changierenden, zart ausgebreiteten, vom Dirigenten mit seinen plastischen Gebärden so bildhaft vorformulierten Klänge aus dem Orchestergraben.
William Christie geht dieses Mal fremd. Das öffentlich, mit Wonne und immer öfter. Steht er doch mitnichten vor seiner eigentlichen Orchestergattin, der französischen Elitetruppe Les Arts Florissants (oder: Les Arts Flo'), sondern vor der mit Hingabe aufspielenden Barockabteilung des Zürcher Opernorchesters mit dem klingenden Namen La Scintilla. Bereits eine vertraute Geliebte, zum vierten Mal wohnt Christie ihr bei. Nach zweimal Gluck und einmal Rameau heißt die Liebesübung diesmal "Händel-Wippe".
Auch bei den Berliner Philharmonikern war er auf Einladung seines großen Fans und Freundes Simon Rattle bereits untreu - mit bekannt wundervollen Folgen (und ist es nächste Spielzeit wieder). Promisk ist der Amerikaner in Paris zudem mit dem englischen Orchestra of the Age of Enlightment, in Glyndebourne besonders; und sogar mit dem gar nicht so treudeutschen Gewandhausorchester treibt er es barockbunt. Es scheint so, als habe der 59-jährige William Christie augenblicklich den Höhepunkt seiner (künstlerischen) Zeugungskraft erreicht.
So gilt der fragile aber zähe, liebenswürdige, aber auch ausgesprochen arrogant auffahrende Orchesterzuchtmeister längst als einer der Schlüsselfiguren einer Welle, deren Kraft und Fülle keiner je zu ahnen vermochte. Im Herzen der früheren Finsternis, in Paris, wo alle diese Noten unentdeckt in Archiven schlummerten, ist Christie diese Saison gleich an drei Theatern, im Palais Garnier, im Châtelet und im Théâtre du Champs Elysées, präsent. So paaren sich heute auf das Feinste die neue Lust auf Händel, Gluck, Lully, Cavalli und Konsorten, auf klare, unkompliziert emotional fassbare Klänge inmitten einer komplexeren Welt mit den Erkenntnissen moderner Dirigenten, die für ihre Klangkörper auf musikalische Früherziehung durch strenge, aber kommunikative Spezialisten dringen.
Das alles begann für William Christie 1979 im noblen Hofhaus eines der feineren Pariser Bezirke. Hohe, helle Wände, Flügeltüren, blauweißes Porzellan, Zeichnungen mit Männerakten und Stiche, Oberlichter, wenige alte Sitzmöbel, ein reich verzierter Notenständer, ein japanisch bemaltes Cembalo. Hier saß man in den Vorarbeiten für ein neues Projekt seines in acht arbeitsintensiven Pariser Jahren zusammengeführten Orchesters mit dem komplizierten Namen "Ensemble baroque vocal et instrumental de l'Ile de France". Es sollte eine kleine Oper von Charpentier werden, ein "idyll musical" mit dem vieles verheißenden Titel "Les Arts Florissants". Plötzlich war es der Name der eigenen Truppe. "Nichts war Berechnung, es hat sich organisch entwickelt. Wir wussten damals gar nicht, dass wir an der Spitze einer neuen Bewegung standen", erinnert sich Christie mit porzellanhaft durchscheinender Stimme, die am Satzende nie abfällt, das Gesagte in graziösem Schwung schweben lässt. "In Deutschland war in Sachen Alte Musik tote Hose, in Frankreich war es nicht besser, die Zentren waren London und Amsterdam."
Dass er nach Paris kam war Absicht, dass er dort bleibt, Bestimmung. Gebürtig aus Buffalo, hatte Christie seine Studien und erste Lehrzeit in Yale und Harvard verbracht. "Es war Krieg in Vietnam, das geschlossene Uni-Leben ging mit aufs Gemüt. So wollte ich nicht weiter machen, ich wollte in ein lateinisches Land wechseln." Europa lockte, erst mit seine Sabbatical, seit 33 Jahren für immer. "Damals war alles frei, es gab keinen Stil, keine Praxis, nur unbändige Lust auf Neues. Deswegen spielten wir konsequenterweise nur Musik des 17. Jahrhunderts - und Zeitgenossen, wie Bussotti, Berio, Donatoni, Foss, Feldman. Wir machten Musik für den Moment, das gefiel, und so ging es immer weiter. Wir waren gut und wollten besonders das französische Repertoire pflegen. Wir hatten einfach Spaß daran. Konzerte ergaben sich, eine rege Aufnahmetätigkeit begann. So freundeten wir uns langsam mit einem längeren Leben an."
Les Art Florissants unterstützte dieses Streben dann institutionell, Subventionen kamen für das völlig frei arbeitende Unternehmen dazu. Das Orchester aus unabhängigen Musikern und der sublime Chor vergrößerten sich mit den Projekten. Heute arbeiten zwölf Leute in der Verwaltung, organisiert oft die Tourneen selbst, hat eigenes Notenmaterial, eine umfangreiche Bibliothek. "Les Arts Flo' sind nach wie vor ein wunderbares Abenteuer." So mancher heutige Starsänger wie etwa Sandrine Piau hat sich vom Chor bis in die erste Reihe gesungen. Christie hat solche Talente in kaum zählbaren Auditions aufgepickt, unermüdlich Begabung geformt auch in seine Jahren am Pariser Conservatoire von 1982 bis 1995, sie sich treu gehalten: "Ich besitze Künstler nicht, aber ich arbeite gern in kontinuierlichen Beziehungen, so ist über die Jahre unser Sänger- und Instrumentalistenstamm gewachsen." William Christie hat Monteverdi und Händel aufgeführt, sich bis zu Mozart und Haydn entwickelt: "Das war lange vorbereitet, aber weiter will ich nicht vordringen, da würde ich meine Ideale verraten." Doch sein Schwerpunkt ist die Musik der Grande Nation des 17. und frühen 18. Jahrhunderts. "Frankreichs Kultur, Geschmack, Harmonie, Sprache, Form, Disziplin, Ordnung war schon seit meiner Kindheit mein Traum", erzählt Christie zögerlich. Trotzdem gibt es unerfüllte Träume: "Ein kleiner, feiner ,Tristan', so wie in Glyndebourne, so erotisch, farbensatt, sublim. Das habe ich geliebt, ich war richtig eifersüchtig."
Anderes geht vor. Der Name seines jüngsten Vokalprojektes "Jardin des Voix" verrät es, Christie ist auch ein passionierter Gartenliebhaber, natürlich der strengen, die Natur veredelnden französischen Spielart. Bei Nantes liegt das Objekt dieser Begierde. Mehr als 70 Plattenaufnahmen, die fast alle noch in den Katalogen stehen, sind hingegen seine stolz vorgeführten Kinder. Anders als viele Mitstreiter in der Bewegung hat er bis heute nicht die Flamme verloren. Man meint sie wie eine Aureole zu spüren, wenn William Christie in Zürich glückstrahlend und schweißüberglänzt den freudig erregten Beifall entgegennimmt.
|
il giornale della musica
16. 3. 2004
Pantomime haendeliane
Radamisto di G.F. Haendel
All'aprirsi del sipario, sullo sfondo di un arazzo e sotto le luci di un gigantesco lampadario di cristallo, sta cenando una famiglia altoborghese di oggi. L'armonia familiare si sfascia però non appena Tiridate, verso la fine dell'ouverture, si alza per sedurre con passione la cognata Zenobia. Con questa pantomima il regista Claus Guth apre un conflitto che nella partitura di Haendel comincia con il lamento di Polissena, la moglie tradita (una splendida e bravissima Malin Hartelius), e sviluppa un intrigo d'amore e potere, che in ogni caso varca i confini dell'antropologia borghese. Nonostante la splendida scenografia di Christian Schmidt (che consiste in due pareti a forma di mezzaluna poste simmetricamente sul palcoscenico girevole, dove le parti concave danno due interni e quelle convesse due esterni) la messinscena convince poco nel complesso. Guth sembra essere uno di quei registi che hanno paura che il pubblico si annoii se durante le arie non succede nulla sul palcoscenico. Così fa ruotare in continuazione la scena, caricando quasi ogni numero con pantomime che rappresentano le proiezioni psichiche dei personaggi che cantano, o ironizzandoli con momenti di banalità quotidiana che stonano con la stilizzazione dell'insieme (anche se la scena di Polissena che fa la valigia in gran furia cantando "Barbaro partirò" è gustosissima).
Disuguale anche la realizzazione musicale. Se William Christie riesce a tirare il meglio dall'orchestra "La scintilla", non lo stesso si può dire per i cantanti, non tutti i gran forma e talvolta in difficoltà con l'intonazione. L'androgina protagonista Marijana Mijanovic dà, nonostante l'annunciata indisposizione, un bel saggio di vocalità primosettecentesca, ma non lo stesso si può dire di Liliana Nikiteanu, il cui faticoso fraseggio ha appesantito alcune delle più belle arie dell'opera. Del tutto fuori parte Reinhard Mayr, in difficoltà con le asperità del ruolo di Tiridate e legnoso nei recitativi (di cui dovrebbe curare un po' di più la pronuncia), mentre Elisabeth Rae Magnuson se l'è egregiamente cavate nelle ardue arie di Fraarte. Visibilmente indisposta, ma comunque all'altezza del ruolo, Isabel Rey.
Michele Calella
|

