|
Aufführung
|

6. 7. 2003
(Première)
*
Musikalische Leitung: Beat Furrer
Inszenierung: Christoph Marthaler
Bühnenbild: Bettina Meyer
Kostüme: Annabelle Witt
Lichtdesign: Rainer Küng
Regiemitarbeit: Annette Kuss
*
Sopran: Alexandra von der Werth
Schauspielerin: Olivia Grigolli
Schauspieler: Robert Hunger-Bühler
Vokalensemble Zürich
Leitung: Peter Siegwart
Ensemble "opera nova" des Orchesters der Oper Zürich
LIBRETTO
|
|
Rezensionen
|
|
|

8. 7.. 2003
Zürcher Festspiele
Wenn Musik Theater wird
«Invocation» von Beat Furrer in der Schiffbauhalle
Längs, auf ansteigenden Stufen, sitzen wir in der Zürcher Schiffbauhalle. Gegenüber, ebenfalls im ersten Stock, die Spielfläche; sie führt von weit links nach weit rechts - grösste Distanz ist da möglich. Dazwischen schliesslich (und abgesenkt ins Parterre) das Ensemble Opera Nova, das sich aus Mitgliedern des Zürcher Opernorchesters zusammensetzt - und da fallen gleich zwei Dinge auf. Die Musikerinnen und Musiker sind Kellnerinnen und Kellner. Nicht etwa weil sie bedienen, die Sänger begleiten würden; dem Instrumentalen kommt hier vielmehr konstituierende Funktion zu, und das Ensemble macht es unter der Leitung des Komponisten in der schönsten Weise hörbar. Kellnerinnen und Kellner darum, weil «Invocation», die nunmehr vierte Oper von Beat Furrer, die im Rahmen der Zürcher Festspiele zu erfolgreicher Uraufführung gekommen ist, das Handlungsgerüst von «Moderato cantabile» bezieht, einem Roman von Marguerite Duras, der über weite Strecken in einem Café spielt.
Die Geschichte der Fabrikantengattin Anne, die mit einem seltsamen, offenbar aus Liebe begangenen Mord konfrontiert wird, die in der Folge den Vorfall zu ergründen sucht und dabei in den Sog einer ebenso heftigen wie zerstörerischen Begegnung mit einem Unbekannten gerät - diese Geschichte wird zu Beginn in kurzen, hastig hervorgestossenen Sätzen rekapituliert. Denn da ist das andere, was beim Blick ins Ensemble auffällt: Im Rund sitzen auch zwei nahezu gleich aussehende Damen, wasserstoffblond, beiger Regenmantel. Die eine ist die Schauspielerin Olivia Grigolli (Anne), die mit ihrer Sprechkunst und ihrer körperlichen Beweglichkeit den Abend prägt, die andere die Flötistin Maria Goldschmidt, die mit ihren vielgestaltigen Klängen das Alter Ego der Protagonistin abgibt. Bald nämlich greifen die Instrumente in die Sätze der Schauspielerin ein: mit denselben kurzen und hervorgestossenen, zudem ultraleisen und zaghaft vom Geräusch zum Klang findenden Tonfetzen. Plötzlich allerdings kommt es zu einem Ausbruch - womit wir mitten drin wären.
Ins Licht geraten an dieser Stelle die zweimal drei Damen und die zweimal drei Herren des schlechterdings phänomenalen Vokalensembles Zürich (Leitung: Peter Siegwart). Ein extrem dichter, aber bloss geflüsterter, flackernder Satz für vier Stimmen und Streichquartett stellt ein Gedicht von Cesare Pavese vor, das von Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit spricht. In den ursprünglich von Beat Furrer und Ilma Rakusa eingerichteten, für die Uraufführung aber noch einmal veränderten Text von «Moderato cantabile» hat der Komponist Poesie eingelassen, die das Geschehen mit dem Mythischen verbindet und damit ins Grundsätzliche weiterzieht. Die Zeit wird angehalten und geht doch weiter - das ist eine der Quellen, aus denen das Musiktheater von Beat Furrer seine ganz einzigartige Spannung gewinnt.
Dem Regisseur stellt sich hier die schwierige Aufgabe, etwas sichtbar werden zu lassen, ohne banal zu bebildern. Christoph Marthaler und seine Mitarbeiterin Annette Kuss haben einen Weg gefunden, der den Intentionen des Komponisten kongenial entspricht. Während die Kostüme von Annabelle Witt die Damen und Herren als gutbürgerliche Ehepaare im Stil der fünfziger Jahre vorstellen und damit auf den Roman von Duras verweisen, spielt das szenische Geschehen davon unabhängig mit dem Erzeugen der Musik an sich - ein Rückgriff auf die Fundamente wie bei Beat Furrer, für den allein schon das Verklingen eines Tones ein Drama abgibt (vgl. NZZ vom 5. 7. 03). So hantieren die Mitglieder des Chors phantasievoll mit ihren Stimmgabeln, öffnen sie weit den Mund für eine endlich herausgestossene Kurznote und stellen sie sich an die Rampe, um unverrichteter Dinge wieder abzuziehen. Das ist so vergnüglich, wie es wieder jene ganz eigene Menschenliebe erkennen lässt, welche die Theaterarbeit Marthalers kennzeichnet.
Und dann ist es so weit, schlägt die Stunde der Sopranistin Alexandra von der Weth, welche die dritte Verkörperung der Hauptfigur Anne darstellt. Ebenfalls wasserstoffblond, ebenfalls im beigen Regenmantel, sitzt sie ganz aussen auf einer jener vier Bänke, die auf der Spielfläche aufgereiht sind. Auf der anderen Seite die Schauspielerin Olivia Grigolli, die sich stumm, aber beredt in eine Sehnsucht hineinträumt. Die Flötistin Maria Goldschmidt wiederum hat sich aus dem Ensemble entfernt und dialogisiert mit der Sängerin - wobei auch diese Klänge durch das Freiburger Experimentalstudio diskret verstärkt und in den Raum projiziert werden. Ein anonymer spanischer Text aus dem 16. Jahrhundert, er handelt von Himmel und Hölle und der Liebe, findet sich wieder in einer unglaublich virtuosen und zugleich hochexpressiven Folge von gehauchten Tönen, explodierenden Konsonanten und rasend schnellen Wiederholung von Wortfetzen - hinreissend, wie die Sängerin das bewältigt.
Da kommt es nun gefahren, langsam und nahezu geräuschlos: das Haus mit dem kleinen Balkon und den vier offenen Wänden, das die Bühnenbildnerin Bettina Meyer hat erbauen lassen. Es ist zunächst das Haus der Fama, in dem, wie es Ovid in den «Metamorphosen» beschreibt, alle Gerüchte der Welt zusammenkommen. Einen liegenden und zugleich oszillierenden, vor allem aber unglaublich schönen Klang breiten Chor und Ensemble in dieser Szene aus. Wieder ist die Zeit angehalten und geht sie doch voran, wieder geschieht nichts und doch so viel. Ganz kleine Dinge lassen sich beobachten, etwa jenes Paar, das sich gegenübersteht und beharrlich aneinander vorbeischaut, oder die Füsse, die dank einer leisen Clownerie mit dem vorbeifahrenden Fussboden zurechtkommen. Und reiche Anregung gibt es fürs Ohr - sei es, dass man sich der Obertonstudie dieses Liegeklangs hingibt, sei es, dass man in seine Verästelungen hineinhört.
Aber da ist noch einer, ein Mann mit etwas langen Haaren, auch er im Regenmantel. Ganz rechts aussen sitzt er und trommelt mit seinen Händen auf die Beine. Es ist Er, der bei Marguerite Duras Chauvin heisst, bei Beat Furrer aber namenlos bleibt. Ein kurzer, wiederum etwas atemloser Dialog weitet das Stück für einen Moment aus dem Monolog hinaus, aber wie das Instrumentalensemble einfällt, brechen die Sätze wieder ab. Der Mann - Robert Hunger-Bühler macht das grossartig - versinkt wieder in sein Brabbeln; später widmet er sich jener Baguette, deren Berücksichtigung beim reichlichen Genuss des roten Weins sich vielleicht doch empfiehlt. Anne hält sich nicht daran, sie flüchtet in den Rausch.
Schliesslich das zentrale siebte Bild, in dem das bewegliche Haus zur Villa wird; dort findet jenes Diner statt, bei dem der Salm wie in einem Opferritual verschlungen wird und bei dem Anne in aller Öffentlichkeit zu erkennen gibt, dass sie sich aus ihrer Gesellschaft verabschiedet hat. Eine Invokation, eine grosse Anrufung des Gottes Dionysos hat Beat Furrer hier vorgesehen, und die orphische Hymne, die er seiner Musik zugrunde legt, fasst die Spannung zwischen dem Wunsch nach Entgrenzung und deren fatalen Folgen in einer Reihe einfacher Adjektive. Eine orgiastische Klangkaskade, wie sie bei diesem Komponisten noch nie da gewesen scheint, breitet sich in den Raum aus, aber auch hier bleibt die unglaublich bewegte, das Geschehen aus dem Innersten und dem Kleinsten heraus mit Energie erfüllende Handschrift Beat Furrers unverkennbar.
Der Rest ist Unmöglichkeit: eine triste Coda. Zu gross der soziale Abstand zwischen der Fabrikantengattin und dem Arbeitslosen, zu stark die Angst vor der elementaren Kraft des Eros - die vergeblichen Blickwechsel, die abgebrochenen Annäherungsversuche, die sich an den kurzen Gesten der Partitur orientieren, machen es nur zu deutlich. Noch einmal die Sängerin von ganz links aussen, noch einmal das Spanische, Juan de la Cruz diesmal: «De mi amado bebí», «Ich habe von meinem Geliebten getrunken.» Nach neunzig Minuten so unopernhafter wie spannender und bewegender theatralischer Musik, nach einem Beispiel aus Musik geborenen und zu Musik gewordenen Theaters finden wir uns wieder auf den harten Sitzen der Zürcher Schiffbauhalle. Einen erstklassigen Abend hat das Opernhaus in Zusammenarbeit mit dem Schauspielhaus den Zürcher Festspielen da gebracht. Das Stück wie seine Realisierung werden jedenfalls noch manchen Gedanken auslösen.
Peter Hagmann
top
|

8. 7. 2003
Was gegen die Einsamkeit hilft
Beat Furrer komponierte, Christoph Marthaler inszenierte «Invocation»: eine Uraufführung als Koproduktion von Oper und Schauspiel in der Zürcher Schiffbau-Halle.
Von Thomas Meyer
Ein Orchester von Kellnern und Kellnerinnen sitzt vor der dreissig Meter breiten, erhöhten Bühne, aber es dauert ein Weilchen, bis der erste Ton erklingt. Zunächst hören wir Sprachmusik, schnell und fast unabgesetzt vorgetragen von einer Frau mit blonder Perücke und eng gegürtetem kurzem Trenchcoat, die zu Beginn mitten im Ensemble Opera Nova sitzt. Sie stimmt auf die Erzählung ein: «Fang an. Fang noch mal an, hab ich gesagt.»
Nochmals anfangen: «Invocation» ist ein Stück über eine Frau, die aus ihren gesellschaftlichen Bindungen ausbricht - oder besser: ihnen entgleitet. So wie es Marguerite Duras in ihrem Roman «Moderato cantabile» erzählt. Während Anne mit ihrem Kind (das hier nicht auftritt) in der Klavierstunde (von der kein Ton erklingt) sitzt, vernimmt sie einen Schuss (der nicht vorkommt) aus einem Café: Ein Mann hat seine Geliebte getötet, offenbar auf ihr Verlangen.
Anne denkt über die Tote nach und entzieht sich damit ihrer Umgebung, an der sie schon zuvor eher unentschlossen teilhatte. Sie trifft sich in jenem Café mit dem arbeitslosen Chauvin und sinniert trinkend mit ihm in Gedankenschleifen über die Tat und sich selber. Höhepunkt des Buchs ist ein Fest bei Anne zu Hause, bei dem feierlich ein Salm verspeist wird und bei dem sich die Betrunkene übergeben muss. Damit löst sie sich endgültig.
Eine Annäherung, keine Begegnung
Es ist hilfreich, den Roman gelesen zu haben, bevor man sich in den Schiffbau begibt, denn in den Monologen von Olivia Grigolli und in den Dialogen, die sie mit Robert Hunger-Bühler führt, sind nur Bruchstücke daraus zu vernehmen. Einleuchtender wird die Situation durch die Inszenierung von Christoph Marthaler und Annette Kuss.
Die beiden Schauspieler bewegen sich in einer Einsamkeits- und Verzweiflungschoreografie. Dreissig Meter weit auseinander auf Bänken sitzend, sprechen sie miteinander; sie nähern sich im Lauf des Abends an, ohne einander wirklich zu begegnen. Bettina Meyer hat in ihrem Bühnenbild kein Interieur nachgestellt, sondern vielmehr das Quai, an dem das Café liegt. In dessen Weite wird Enge spürbar, Angst. Ihr versucht sich Anne zu entwinden, mal in Trunkenheit, mal in spastischen Verrenkungen. Sie benimmt sich immer mehr ausserhalb der Norm.
Die Erzählung ist freilich nur eine Ebene, denn der Komponist Beat Furrer hat «Invocation» mit weiteren Texten angereichert. So wird diese Oper auch zu einem musikalisch-philosophischen Traktat über die Liebe, über die Verlorenheit, die Religion und übers Weggehen. Dafür wiederum ist es nützlich, vorher das sehr kurze Libretto zu überfliegen. Von der einsamen Hoffnung, die erwartet und ruft, ist in einem Gedicht von Cesare Pavese die Rede, von der Unbedingtheit der Liebe und der Furcht, auch jenseits von Himmel und Hölle, in einem anonymen spanischen Gedicht des 16. Jahrhunderts. Und fünf Verse des spanischen Mystikers Juan de la Cruz sprechen zum Schluss davon, wie ein Ich im Geliebten aufgeht und damit den Kontakt zur Herde, mithin zur Gemeinschaft verliert. Das ist gleichsam die Quintessenz des Abends.
Nur einzelne Worte davon bleiben allerdings in der Musikalisierung verständlich. Diese Texte werden nicht mehr gesprochen, sondern gesungen, zum einen von der Sopranistin (Alexandra von der Weth), die zusammen mit der Flötistin (Maria Goldschmidt) zwei andere Facetten der Anne personifiziert; zum anderen vom Chor, dem hervorragend von Peter Siegwart einstudierten Vokalensemble Zürich. Dieser Chor trägt zur erwähnten Festszene einen antiken orphischen Hymnus vor, eben jene Anrufung - Invocation - des trinkfreudigen Gottes Dionysos, die der Oper ihren Titel gab.
Bei diesen poetischen und musikalischen Kommentaren Furrers nun stellt sich Ratlosigkeit ein, denn sie beruhen auf einem Gedankengebäude, das nur schwer durchschaubar ist. Was müsste man an Vorwissen mitbringen, etwa zu Georges Batailles «Theorie der Religionen», die den Komponisten beschäftigte? Das Festmahl wird in diesem Zusammenhang etwa zum Opferritus, dem sich Anne entzieht. Was das für Konsequenzen für das Werk hat, bleibt letztlich unklar. Ist all das nicht zu viel neben der intensiven Darstellung der Schauspieler und der Subtilität der Musik?
Herumlungern, Herumzappeln
Gewiss verdichtet und übersteigert sich in diesen Texten die Handlung, die als solche wohl kaum musikalisierbar wäre, aber in einzelnen Momenten löst sich diese dabei auch fast ganz auf. Dann wirken die beiden Hauptdarsteller etwas verloren: Hunger-Bühler lungert herum, Grigolli zappelt und schreit quasi stumm wie am Spiess. Und ist es deshalb nicht bezeichnend, dass der Schauspieler am Schluss jenes Festes, dessen Klang - für einmal an diesem Abend - zu überborden droht, eine Geige zerschmettert? Er holt das Stück damit wieder auf den Boden zurück.
«Invocation» erzählt auch von der persönlichen Mythologie des Komponisten. An zentraler Stelle fügt Furrer eine Episode aus den «Metamorphosen» des Ovid ein: Fama, die Göttin des Gerüchts (oder noch schöner: des Hörensagens), hat an der Grenze der dreigeteilten Welt ihr Haus errichtet und hört dort alles, was auf der Welt gesprochen wird. Das verweist auf das Hören, denn «Invocation» ist eine Oper über Musik.
In der Musik steckt eine Möglichkeit zur Befreiung. Zu Beginn hört man aus dem Ensemble, das unter der Leitung des Komponisten spielt, nur dünne, blasse, geräuschhafte, in sich kreisende, verschliffene Klänge, die zwar einen ungemeinen Reichtum an Nuancen enthalten, aber dennoch wie erstickt wirken. Auf solche Subtilitäten soll sich das Ohr einstellen. Marthaler und Kuss finden dafür ein schönes Bild: die Stimmgabeln, die sich die Vokalisten ans Ohr halten, um rein intonieren zu können. Das ist auch ein Rest Witz, den die Regie dem Stoff noch angedeihen lässt.
Immer stärker entwickelt sich aus dieser Intimität ein Hören im Raum, denn die Töne der Sänger und Instrumente werden über Lautsprecher in die Halle zurückgegeben. Diese Klangprojektion, für die einmal mehr das fabelhafte Experimentalstudio der Heinrich-Strobel-Stiftung des Südwestrundfunks Freiburg im Br. verantwortlich ist, verräumlicht und entäussert den Klang: Niemand ist an dem Ort, an dem er erklingt. Die verwirrende Verfremdung birgt auch eine Möglichkeit zur Entfaltung der Musik.
Der Klang gewinnt an Kraft
Allmählich blühen an diesem neunzig Minuten dauernden Abend Klang und Gesang auf. Aus der zunächst fein ziselierten Unruhe entstehen Klanggestalten. Am Schluss singt die Anne nicht mehr in kurzatmigen Gesten, sondern in kantablen Tönen. Da hat sich etwas befreit. Der fragile Klang hat an Kraft gewonnen, er bricht aus der Statik des Anfangs auf, wer weiss, wohin. Die Musik bietet sich nicht als Lösung an, aufs Ende hin bewegt sie sich gleichsam als Trauerkondukt, aber sie hebt das Stück auf eine andere Ebene, trägt über den marthalerschen Gestus hinaus. Sie nimmt dieser Verzweiflungs- und Einsamkeits-Choreografie ein Stück ihrer Leere, sie spendet, wie sie es immer tut, Trost, öffnet den Raum, gibt Hoffnung und verleiht der Verlorenheit zum Schluss einen Anflug von Schönheit.
|
 8. 7. 2003
8. 7. 2003
Zürcher Festspiele: «Invocation»
Doppelbödig
VON LILITH FREY
«Invocation», Musiktheater von Beat Furrer (49), ist ein akustisches Abenteuer. Aber es lohnt sich. Die Uraufführung war am Sonntag im Theater Schiffbau, im Rahmen der Zürcher Festspiele.
«Invocation» heisst Anrufung. Diese setzt sich aus einzelnen Tönen von Musikinstrumenten zusammen und aus sprechenden, singenden und geräuschemachenden Stimmen. Das zusammen ist verflochten wie ein Zopf.
Es flirrt und surrt, es schabt und weht, schmerzt und sucht, es pustet, es explodiert, spitz, rund, gewellt. Sehr fein, sehr klar. Immer in Erwartung. Immer gespannt. Jeder Ton ist ein selbstbewusster Ton. Zwei Mal wird es laut und explosiv, dann hört es sich an, als seien sämtliche Töne gemeinsam in die Bewusstlosigkeit gefallen.
So kann man bei Beat Furrer hören. Er liebt den einzelnen Ton. Diese Liebe überträgt er aufs Publikum. Deshalb überfordert Furrer nicht. «Invocation» dauert nur anderthalb Stunden.
Die Geschichte, die die Töne lautmalen, basiert auf Marguerite Duras' Roman «Moderato Cantabile». Anne, ist mit ihrem Sohn beim Klavierunterricht. Die Lehrerin versucht dem Kind die Spielanweisung «moderato cantabile» (gemässigt singend) beizubringen, da gellt ein Schrei durchs geöffnete Fenster, bricht abrupt ab, ein Mord ist geschehen, Anne will herausfinden warum, täglich trifft sie am Ort des Geschehens einen Mann, sie trinken viel Alkohol, als Anne und ihr Mann ein Nachtessen geben kommt sie betrunken und zu spät. Sie erträgt ihr leeres Leben nicht. Zu Duras kommen Texte von Juan de la Cruz, Ovid, Cesare Pavese.
Anne im beigefarbenen Bluse-Jupe-Ensemble wird drei Mal dargestellt: als Sprechende (Olivia Grigolli), als Sängerin (Alexandra von der Weth) und als Flöte (Maria Goldschmidt). Der Mann im Colombo-Mäntelchen ist Robert Hunger-Bühler, den Chor stellt das Vokalensemble Zürich.
Inszeniert hat Christoph Marthaler. Der Regisseur lässt dem Komponisten den Vortritt. Alles ist Ton. Es marthalert nur ein bisschen, z.Bsp. wenn einzelne Chormitglieder für eine kleine Ewigkeit auf dem Bauch liegen müssen und mit dem Kopf nach unten ins Dunkel gucken. Denn die Bühne ist doppelbödig, sie überbrückt den Orchestergraben und erinnert an eine triste S-Bahn-Station in Ostberlin: Nichts als Bänke und Beton und viel, viel Einsamkeit.
|

8. 7 . 2003
Die Stimmgabel ist auch eine Blume
Das neue Musiktheaterwerk «Invocation» von Beat Furrer in der Inszenierung Christoph Marthalers führt in ein mehrperspektivisches Labyrinth der Fragmente und Motivpartikel. Ein Spiegel der Vexierspielhaftigkeit.
Torbjörn Bergflödt
Hinten die ehemalige Industriehallenmauer. Abgeschabt, verwittert, besetzt von Spuren rätselhafter Einstmals-Technik. Oben wulstet frisches Elektrokabelgedärm. Vor der Wand das «eigentli-
che» Bühnenbild – eine Totalabsage im Cinemascope-Format an eine herkömmliche Guckkastenbühnen-Ästhetik. Lang zieht sich ein Promenadensteg. Parkbänke stehen drauf und ein Häuschen, das, wundersam anzuschaun, hin und her fahren kann. Treppen und Leitern führen zum Boden, wo weitere Bänke stehen. Eine Sopranistin, eine Schauspielerin und eine Flötistin, ein Schauspieler, sechs Choristinnen und sechs Choristen und das auf dem Boden in der Mitte platzierte Instrumentalensemble spielen uns hier ein Musiktheaterstück vor, in dem die Koordinaten des Genres verrückt scheinen bis hin fast zum Rätselspiel.
Mit der linear durcherzählten, narrativ von A bis Z führenden «Oper» jedenfalls hat es kaum noch etwas gemein, das Acht-Bilder-Stück von Beat Furrer mit dem an Rituelles gemahnenden Titel «Invocation». Assistiert von der Übersetzerin und Schriftstellerin Ilma Rakusa, hat Furrer Textfundstücke zusammengestellt auf der Hauptgrundlage von Marguerite Duras' Roman «Moderato cantabile». Zu Duras treten Cesare Pavese, Ovid und, aus Spanien, der Mystiker-Dichter Juan de la Cruz und ein Anonymus des 16. Jahrhunderts. Sowie, in der siebten Szene, eine Orphische Hymne, eine Anrufung in altgriechischer Sprache an Gott Dionysos, die dem Werk auch den Titel gegeben hat.
Im Gerüsttext geht es um die verheiratete Anne, die, nach einem Mord in der Kleinstadt, sich mit einem Arbeitslosen im Café trifft, den Fall vergeblich zu ergründen sucht, dem Wein über die Massen zuspricht, mit der bürgerlichen Welt bricht und am Ende ins Offene entlassen wird. Wichtiger als die Kaum-Handlung ist das Thema der Grenzüberschreitung, der Kräfte, die ein geregeltes Leben aus dem Gleis bringen können. Der Rausch – des Eros, des Sich-Betrinkens – überwindet Grenzen. Zugleich aber bedeutet er gewalthafte Zerstörung.
Leise Klänge
Die Musik wird zum Spiegel solcher Vexierspielhaftigkeit. Von der zwanzigköpfig besetzten Spezialformation «Opera nova» des Orchesters der Oper Zürich in dezenter Kellner- und Kellnerinnenlivree dringen kleinräumige, abwechslungsreich gefilterte leise Klänge und Klangpartikel zur Zuschauertribüne empor. Es sind oft nervös zuckende, flimmernd-flackernde Impulse und Impülschen. Obertonreiches Streichertremolo nahe am Steg, verfremdeter Klavier-Basston, gestopfter Blechbläserklang, vereinzelter Flötenton, handgezeugter Marimba- oder schlegelgezeugter Gong-Klang und so weiter: Unter der Leitung des Komponisten, der ja mit zu den prägenden Dirigenten neuer Musik gehört, wurde die Partitur im Schiffbau wunderbar genau ausgehorcht. Dass solches, unter dem Eindruck szenischer Vergegenwärtigungen, wahrnehmungsphysiologisch auch nivelliert wurde zu einer irisierenden, wispernd-zischelnd-hechelnd-sirrend bewegten Fläche, konnte und durfte sein.
Immer wieder mal klinkte sich da das Ohr ein ins Detail. Und plötzlich konnte es geschehen, dass das Orchester den Innerlichkeitsbezirken Valet sagte und Forte-Ausbrüche wagte. Was, vor der Folie des Leisen, natürlich besonders ins Gewicht fiel.
Die Stimmen der Akteure tasten, von solistisch bis chorisch, verschiedenste Zwischenstufen ab zwischen geräuschhaft verfremdetem Stimmklang, Sprechen und «kultiviertem» Operngesang im Sopranregister, wobei die Flöte (auch) die Rolle einer Mittlerin zum Orchester hin übernimmt. Leitmotivisch wichtig, freilich gleichsam von innen her ausgelotet ist der «Schrei», der zum initialen Mord gehört. – Das Regie-Duo Christoph Marthaler und Annette Kuss bedeutet einen Glücksfall für diese Uraufführungs-Inszenierung in Koproduktion von Opernhaus und Schauspielhaus (im Rahmen der Zürcher Festspiele). Denn einerseits leistet es Deutungsstützen. Und andererseits fächelt es einem Werk Bühnen-Sauerstoff zu, das Furrer im Vorfeld der Aufführung zwar nicht als «Antioper» missverstanden haben wollte, das aber freilich die Gattung immerhin in Randzonen treibt und sich dabei auch in spannungsdramaturgisch dünnere Höhenlüfte emporwagt.
Bettina Meyers Bühne liesse sich sinnfälliger kaum denken für ein prozessuales Gefüge wie dieses Musiktheater. Das offene Haus legitimiert sich dabei mehrfach durch den Text – auch durch die offen stehende Behausung der «Fama» aus Ovids «Metamorphosen» im vierten Bild. Dass die Frau und der Mann nicht zusammenfinden, zeigen Marthaler und Kuss unter anderem, indem sie sie «raumspreizend» positionieren. Der ans klassische griechische Vorbild gemahnende Chor, den die Kostümbildnerin Annabelle Witt in Anzüge und Deux-pièces gesteckt hat, wird zu einem Verbund maskenhafter Spiesser – ohne platte Denunziation und nie gegen die Musik gerichtet, in jener langsam-still-schrulligen Art, wie sie Marthaler-Inszenierungen eignet.
Die Anne von Marguerite Duras erscheint bei Furrer gesplittet in eine Anne selbdritt: Alexandra von der Weth formte mit modulierfähigem Sopran Annes innerseelische Metamorphosen aus; Olivia Grigolli meisterte den heiklen Part der «Anne 2» mit breitbandschauspielerischem Können; Maria Goldschmidt fuhr mit der Flöte vermittelnde Ausdruckslinien aus, deren Atemgeräusche manchmal raumklangbildend vergrössert wurden von der Klangregie des Experimentalstudios der Heinrich-Strobel-Stiftung des Südwestrundfunks (Freiburg im Breisgau). Zu dieser «Sie» gab Robert Hunger-Bühler einen clochardesken «Er» von unüberbietbarer Lakonik samt weltverloren zelebriertem Pariserbrot-Mahl und einigen rascher zufahrenden Momenten mit «Thriller-Suspense». Ein paar Mal scheinen Frau und Mann sich mit Pistolenschüssen aus der Mündung von Zeigefingern zu sieben oder sich wie zurückgespult zu bewegen. Humorige Verbeugungen vor dem Kino, das für die Duras ja so wichtig war? Peter Siegwart hat das Vokalensemble Zürich musikalisch sehr sorgfältig einstudiert, so dass die Silbenklangexperimente, die die Semantik zerlegen, glückten. Köstlich etwa der Regie-Einfall, der Chornachbarin die Stimmgabel zum Riechen anzubieten wie eine fein duftende Blume.
Die Blinden
«Invocation» ist das vierte Werk der Gattung von Beat Furrer, der 1954 in Schaffhausen geboren wurde, 1975 nach Österreich übersiedelte, inzwischen österreichischer Staatsbürger ist und in Kritzendorf bei Wien lebt. Wobei es Themen der Vorgänger «Die Blinden», «Narcissus» und «Begehren» gibt, die sich in «Invocation» weiterziehen – wie Einsamkeit und Sprachfindung. Die Ansprüche ans Publikum sind hoch. Ein Sich-Zurücklehnen geht hier nicht. Als Beitrag zu einem zeitgenössischen und zugleich mythisch geerdeten Musiktheater verdient der Neuling Beachtung.
|

8. 7. 2003
Ein kraftvoll-leises Stück Musiktheater
Zürcher Festspiele: Uraufführung von Beat Furrers Auftragswerk «Invocation» im Schiffbau
Im Zürcher Schiffbau feierte am Sonntagabend als Gemeinschaftsproduktion von Schauspielhaus und Opernhaus Beat Furrers «Invocation» Uraufführung. «Invocation», nach einer Romanvorlage der französischen Schriftstellerin Marguerite Duras ist ein Auftragswerk des Zürcher Opernhauses und die vierte Oper Furrers. Regie führen Christoph Marthaler und Annette Kuss. Die Sehnsucht nach Freiheit und ekstatischer Liebe verliert sich in dem Stück in Trunkenheit und Einsamkeit, was gleich viel wie Tod bedeutet.
In Marguerite Duras Roman «Moderato cantabile», der Beat Furrer als Vorlage für die neue Oper «Invocation» dient, geschieht fast nichts.
Der Schrei als Motiv:
Auch der anonyme Mord aus Leidenschaft, den in einer Bar ein Mann an einer Frau begeht, gibt es nur als Faszinosum, den er auf andere ausübt. Und er löst den Schrei aus, den die im bürgerlichen «moderato» gefangene Anne nicht vergessen kann. Das hintergründige, vielschichtige Auskomponieren dieses «Schreis» war Beat Furrers Vision, welcher er in diesem Auftragswerk des Opernhauses Zürich nachgehen wollte.
Dabei bewegt sich dieser Schweizer Komponist, der seit seinen Studien in Wien lebt, in den Grenzbereichen zwischen Gesang, Sprechen und Instrumentalensemble. Diese drei Ebenen werden in einer Dreiteilung der Figur «Anne» offensichtlich. Sie wird gleichzeitig von einer Schauspielerin (Olivia Grigolli), einer Sängerin (Alexandra von der Weth) und einer Flötistin (Maria Goldschmidt) in demselben Kostüm, einer blonden Perücke und einem beigen Mantel, dargestellt.
Die Stimmen von Anne
Diesen «direkten» Stimmen von Anne ist alles andere untergeordnet. Ein Chor von zwölf Sängerinnen und Sängern ist eine Art Resonanzraum für die Gedanken und die Stimmen von Anne. Und das Instrumentalensemble mit starker Bläserbesetzung, Schlagzeug und Klavier spiegelt gleichfalls eine Art «inneren Zustand» dieser Frauenfigur. Beat Furrers Musik wird von leisen Tönen dominiert, nicht aber von Ruhe.
Dichte Inszenierung
Unerhört, wie expressiv und bewegt diese sparsam und virtuos gesetzten Töne sind, wie eng verwoben Klang und Geräusch, Atem und Geste werden. Das Ensemble «Opera Nova» des Opernhauses Zürich spielte unter der Leitung des Komponisten mit Präzision und engagiertem Ausdruck, in dem auch das Atmosphärische eine wichtige Rolle spielt.
Zu Beginn spult Olivia Grigolli, die im Orchester sitzt, ihren Text in atemlosem Tempo runter: «Fang an. Fang noch mal an, hab ich gesagt. Ich möchte Wein. Immer noch möchte ich welchen ... Ich habe keine Lust, nach Hause zu gehen ... Ich mache mir so meine Gedanken. Man kann die fest eingeteilten Stunden nicht umgehen ...» Später wiederholt sie diesen Text, doch nur in Bruchstücken. Sie kommt ins Stocken, das Orchester spricht an ihrer Stelle, wenn sie schweigt. Eine eindrückliche und wirksame Behandlung des Textes.
Olivia Grigolli spielt diese Anne mit interessantem Tonfall in der Stimme, mit einer Klarheit und einer Verlorenheit, die einem sehr nahe geht. Dazu kommt ihre ins Surreale übersteigerte Bewegungsart, dieses trunkene Gehen, dieses Zittern am ganzen Leib, dieses kurz in Tanzschritte ausbrechende Schweigen, das alles sitzt mit semantischer Kraft und Präzision.
Chor in Gruppen
Überhaupt zeichnet sich die Regie von Christoph Marthaler und Annette Kuss durch choreografisch präzise Personenführung und durch viel sagende Requisitenbehandlung aus. Am interessantesten ist dabei der auch musikalisch in drei Gruppen geführte Chor. Das Vokalensemble Zürich (Einstudierung Peter Siegwart) wird auf drei Sitzbänke verteilt, die in ihrer Distanz zueinander die ganze Breite des «Laufstegs» durchmessen.
Es sind immer zwei Männer und zwei Frauen. Jede ihrer Bewegungen ist in die Musik hinein gedacht: die Männer lehnen sich nach vorne, die Frauen schlagen die Knie übereinander. Die einen versuchen ihre Stimmgabel an allen möglichen Körperstellen zum Klingen zu bringen, und einmal halten die Frauen die Stimmgabeln an die Köpfe der Männer, um wohl diese zum Klingen zu bringen. Die Choristen singen nicht eigentlich. Sie stammeln, hauchen, atmen, summen und geben nur Bruchstücke der Gedichte wieder. Furrer hat dafür Texte von Juan de la Cruz, Ovid, Cesare Pavese und anderen ausgesucht.
Text und Musik in Symbiose
Die einzige Sängerin in diesem Stück kommt nur in den Bildern drei, sechs und acht vor. Die Sopranistin Alexandra von der Weth verleiht der Anne eine betörend sinnliche, weiche und eher melancholische Stimme, die im Dialog mit dem differenzierten Flötenpart von Maria Goldschmidt zu den musikalisch spannendsten Momenten findet.
Hier vermag Furrer die Vermischung von Text und Musik, von Stimme und Instrument am eindrücklichsten zu vollziehen. Ein interessanter Kontrast ist auch, wie sich dieses artifizielle, szenisch ins Surreale überhöhte Stück in einer ganz kahlen, ja kargen Bühnenlandschaft abspielt (Bühnenbild Bettina Meyer). Ein quer in der Halle des Schiffbaus eingebauter roher Bühnensteg mit zwei Aufgängen, dahinter die rohe, schmutzige Betonwand, subtil beleuchtet von Rainer Küng. Auf und unter diesem Steg sitzen und gehen die Figuren, bis sie das bürgerliche «Haus» einholt.
Publikum wird gefordert
Es ist ein weisser Kubus, der ganz langsam über den Steg fährt und dabei die Sitzbänke einholt und wieder verlässt. Eine brillante Idee. So wird «Invocation», die vierte Oper von Beat Furrer, in der Co-Produktion von Opernhaus und Schauspielhaus Zürich zu einem spannend inszenierten, dramaturgisch kraftvollen, leisen Stück, das jedoch an die Interpreten wie ans Publikum hohe Anforderungen stellt.
Sibylle Ehrismann
|
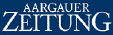
8. 7. 2003
Zürcher Festspiele Beat Furrers Oper «invocation» im Zürcher Schiffbau uraufgeführt
«Sie» und «Er» finden sich nicht
Beat Furrers neues Musiktheaterwerk, inszeniert von Christoph Marthaler, führt in ein mehrperspektivisches Labyrinth der Fragmente und Motivpartikel.
Torbjörn Bergflödt
Hinten die ehemalige Industriehallenmauer. Verwittert, besetzt von Spuren rätselhafter Einstmals-Technik. Oben wulstet frisches Elektrokabelgedärm. Vor der Wand das «eigentliche» Bühnenbild - eine Totalabsage im Cinemascope-Format an eine herkömmliche Guckkastenbühnen-Ästhetik. Lang zieht sich der Promenadensteg. Parkbänke stehen drauf und ein Häuschen, das hin und her fahren kann. Stiegen und Leitern führen zum Boden, wo weitere Bänke stehen. Zusammen mit dem auf dem Boden in der Mitte platzierten Instrumentalensemble wird uns hier ein Musiktheaterstück vorgespielt, in dem die Koordinaten des Genres verrückt scheinen bis hin fast zum Rätselspiel.
Mit der linear durcherzählten, narrativ von A bis Z führenden «Oper» jedenfalls hat es kaum noch etwas gemein, das Acht-Bilder-Stück von Beat Furrer mit dem Titel «invocation». Assistiert von der Übersetzerin und Schriftstellerin Ilma Rakusa, hat Furrer Text-Fundstücke zusammengestellt auf der Hauptgrundlage von Marguerite Duras´ Roman «Moderato cantabile». Im Gerüsttext geht es um die verheiratete Anne, die, nach einem Mord in der Kleinstadt, mit der bürgerlichen Welt bricht und am Ende ins Offene entlassen wird. Wichtiger als die Kaum-Handlung ist das Thema der Grenzüberschreitung, der Kräfte, die ein geregeltes Leben aus der Bahn werfen können. Der Rausch - des Eros, des Sich-Betrinkens - überwindet Grenzen. Zugleich aber bedeutet er Zerstörung.
Die Musik wird zum Spiegel solcher Vexierspielhaftigkeit. Vom 20-köpfig besetzten Orchester «Opera nova» der Oper Zürich dringen kleinräumige, abwechslungsreich gefilterte Klänge und Klangpartikel zur Zuschauertribüne empor. Es sind oft flimmernd-flackernde Impulse und Impülschen. Unter der Leitung des Komponisten wurde die Partitur im Schiffbau wunderbar genau ausgehorcht. Plötzlich konnte es geschehen, dass das Orchester den leisen Innerlichkeitsbezirken Valet sagte und Forte-Ausbrüche wagte. Die Stimmen der Akteure tasteten verschiedenste Zwischenstufen ab zwischen geräuschhaft verfremdetem Stimmklang, Sprechen und «kultiviertem» Operngesang, wobei die Flöte (auch) die Rolle einer Mittlerin zum Orchester hin übernahm.
Das Regie-Duo Christoph Marthaler und Annette Kuss bedeutet einen Glücksfall für dieses Stück. Denn einerseits leistet es Deutungsstützen, und andererseits fächelt es dem Werk Sauerstoff zu. Bettina Meyers Bühne liesse sich sinnfälliger kaum denken für ein prozessuales Gefüge wie dieses Musiktheater. Dass die Frau und der Mann hier nicht zusammenfinden, zeigen Marthaler und Kuss auch etwa, indem sie sie «raumspreizend» positionieren. Der Chor wird zu einem Verbund maskenhafter Spiesser im vollen Dutzend bis zum gestaffelten Einzelauftritt - ohne platte Denunziation und nie gegen die Musik gerichtet, in jener langsam-still-schrulligen Art, wie sie Marthaler-Inszenierungen eignet. Peter Siegwart hat das Vokalensemble Zürich musikalisch sehr sorgfältig einstudiert, sodass die Silbenklangexperimente glücken.
Die Anne von Marguerite Duras erscheint bei Furrer gesplittet in eine Anne selbdritt: Die Sopranistin Alexandra von der Weth, die Schauspielerin Olivia Grigolli und die Flötistin Maria Goldschmidt loteten die Metamorphosen dieser «Sie» mit den je eigenen Mitteln ausdrucksstark aus. Zu dieser «Sie» gab Robert Hunger-Bühler einen clochardesken «Er» von unüberbietbarer Lakonik samt weltverloren zelebriertem Pariserbrot-Mahl und einigen rasch zufahrenden Momenten mit «Thriller-Suspense».
|

8. 7. 2003
Der Schrei der Stille
Uraufführung von Beat Furrers Oper «Invocation» in der Regie von Christoph Marthaler
Mit dem vierten Bühnenwerk des Schweizer Komponisten Beat Furrer haben die Zürcher Festspiele einen Höhepunkt erlebt. Die faszinierende Parabel über Liebe und Tod, Begehren und Rausch entstand zwar im Auftrag des Opernhauses Zürich. Die Uraufführung fand indessen im Schiffbau statt.
HANSPETER RENGGLI
Anne sitzt in der Klavierstunde ihres Sohnes, der eben Diabellis Sonatine spielt, als aus dem nahen Café der Todesschrei einer Frau ertönt, «eine lang anhaltende Klage stieg auf, und so laut, dass das Brausen des Meeres daran zerschellte». Dies ist der Beginn der Geschichte einer Frau, die, durch dieses Ereignis aufgeschreckt und aus dem Alltag gerissen, den Mord an jener Unbekannten zu ergründen sucht. Jener Schrei, Liebe und Tod in einem Augenblick fokussierend, löst bei Anne das Begehren aus, Liebe als erotische Ekstase jenseits der bürgerlichen Moral und ihrer Gesellschaftsregeln zu erfahren. Es ist eine Geschichte über das dünne Eis, das die Welt des kultivierten Bildungsbürgers von den Abgründen einer zerstörerischen Triebhaftigkeit trennt.
Klang gewordene Geschichte(n)
Der Komponist Beat Furrer und seine Librettistin, die Schriftstellerin Ilma Rakusa, haben die acht Kapitel der Vorlage ihrer Oper, Marguerite Duras Roman «Moderato cantabile», in acht Bilder verwandelt. Aus dem Dialog, den im Roman Anne mit einem unbekannten Mann führt, ist nun vor allem ein Monolog der Anne (hoher Sopran) geworden. Wie in den früheren Opern bindet Furrer auch andere Texte ein, u.a. Passagen aus Ovids Metamorphosen, ein Gedicht von Cesare Pavese und einen anonymen spanischen Text aus dem 16. Jahrhundert. Die Texte schaffen unterschiedliche Perspektiven der einen Aussage. Der in Schaffhausen geborene Wahlwiener Beat Furrer, einer der beachtetsten und innovativsten Komponisten innerhalb der unüberschaubaren Masse von Partiturenproduzenten, hat keine Berührungsängste mit der angeblich so bürgerlichen Gattung der Oper. Furrer bewegen die Übergänge in den Ausdrucksmitteln, die Wechsel zwischen Sing- und Sprechstimme, zwischen Stimme und Instrumentalklang. Die hin und wieder zu schreiartigen Konvulsionen ausbrechenden Accelerandi und Crescendi erzeugen eine zerstörerische Wirkung. Furrers Musik zeigt ständig wieder neue Hörperspektiven auf. Sie zwingt zu besonderer Aufmerksamkeit, da in Klanglandschaften im untersten Pianobereich auch kleinste dynamische Bewegungen ins Bewusstsein eindringen. Der Todes- und Lustschrei, den Anne im ersten Bild hört und der sich in unterschiedlichster Form wiederholt, ist der zentrale Akt des ersten Bildes. Es war also eine der Herausforderungen, den Schrei darzustellen, ihm Dauer zu verleihen.
Das Haus der Fama
Der Knackpunkt der Inszenierung bestand darin, Übergänge zwischen den so disparaten klanglich-sprachlichen Bildern zu finden, die Ausdruckswechsel und Bewegungen zu «organisieren», will heissen, sie organisch erscheinen zu lassen. Eine Abstraktion der Figuren und der Bewegung war indessen von Marthaler und seiner Crew nicht zu erwarten. Was Furrer aus verschiedener Perspektive andeutet, wird in Marthalers Regie direkte Geste, wird körperlich. Ist die Körperlichkeit des Begehrens in der Musik auf das Atmen der Stimme reduziert, zeigen sie die Frau und der Mann (die Schauspieler Olivia Grigolli und Robert Hunger-Bühler) in rauschhaften Zuckungen. Artikuliert sich Anne in drei Ausdrucksformen, eben als Schauspielerin, als Sängerin (Alexandra von der Weth) und als Flötistin (Maria Goldschmidt), führt sie die Regie optisch zu einer Erscheinung zusammen. Das Haus der Fama, Sinnbild für alle Geschichten über Frauen und Männer, musikalisch verdichtet in einem zwölfstimmigen Chorsatz, gerät szenisch zum biederen Häuschen, das mehrmals über die gesamte Bühnenrampe des Schiffbaus fährt, alles und alle in sich fassend. Diese Kontraste zwischen artifiziellem Klangtheater und realem Menschenbild haben jedoch der Produktion gut getan.
Bis an die Grenzen
Nicht allein von der Sängerin verlangt Furrer subtilste stimmliche Multifunktionalität. Das Zürcher Vokalensemble (Leitung Peter Siegwart) hatte trotz ständig präsenter Stimmgabel beinahe Unmögliches zu leisten und kam im genannten Fama-Chor auch an seine Grenzen. Das Ensemble Opera Nova des Orchesters der Oper Zürich schliesslich, obschon als Kellnerinnen und Kellner gekleidet (!), tat wesentlich mehr denn dienen: Es bleibt bei Furrer das klangliche Rückgrat. Unter der Leitung des Komponisten spielte es höchst konzentriert. Überspitzt und zugleich vereinfacht gesagt, radikalisiert Furrer das in Wagners «Tristan» erstmals versuchte Prinzip, das innere Drama in ein musikalisches Beziehungsnetz zu verweisen. Jeder Laut, jeder Klang wird zur Geste, gewinnt szenischen Sinn: ein überaus heikles, aber faszinierendes Unterfangen!
|
 8. 7. 2003
8. 7. 2003
Der Schrei nach Unordnung
Hoch emotionales modernes Musiktheater ist Beat Furrers «Invocation». Die Uraufführung des Zürcher Opernhauses überzeugt nicht auf der ganzen Länge, ein spannender Abend ist trotzdem garantiert.
Norbert Graf
Alles dreht sich um den Schrei. Doch geschrien wird auf der Bühne nicht. Den unterdrückten Schrei doch loslassen, sich Luft machen, Platz schaffen, die Ordnung in die unabdingbare Unordnung wenden: Das wäre die verzweifelte Reaktion, wenn man sich der eigenen Umwelt entfremdet. Das Geordnete um sich herum zerbrechen muss die Hauptprotagonistin in Beat Furrers neuem Musiktheater «Invocation», das vom Zürcher Opernhaus im Rahmen der Zürcher Festspiele am Sonntag uraufgeführt wurde.
Normen überschreiten
Furrer, der sein Werk selber leitet, ist 1954 in Schaffhausen geboren und seit 1975 in Wien ansässig. Nach «Die Blinden», «Narzissus» und «Begehren» ist «Invocation» seine vierte Oper. Das Werk geht aus von Marguerite Duras Text «Moderato cantabile», welcher dem Projekt auch den ursprünglichen Titel gab. Damit zielte Furrer auf die Ordnung, die vor dem Schrei kommt, auf das Gemässigte und Singende. Die Bezeichnung «Moderato cantabile» stammt aus einer Sonatine von Anton Diabelli, einem Stück, das sich Klavier spielende Kinder in bürgerlichen Haushalten zu Gemüte führen müssen - etwas, das für die heile Welt einsteht, in der alles wohlgeordnet und überblickbar ist.
Beat Furrers «Invocation» erzählt keine stringente Geschichte. Die Hauptfigur der Anne zerfällt in drei Charaktere, packend dargestellt durch eine Schauspielerin (Olivia Grigolli), eine Sopranistin (Alexandra von der Weth) und eine Flötistin (Maria Goldschmidt). Jede entspricht einem anderen Wesenszug der Hauptfigur.
Anne, in Duras Text durch einen Mord aus ihrem Lebenstrott geschreckt, erkennt die Gräben in der sie umgebenden Welt. Ihr verschüttetes erotisches Verlangen lässt das Gewohnte einstürzen. Sie betrinkt sich. Sie konfrontiert ihr bürgerliches Leben mit der Nacht, dem Duft von Magnolien, dem Wein. Die erotische Kraft zerstört die heile Welt. Anne überschreitet die Regeln der Gesellschaft, lässt die spiessige Welt hinter sich. Am Schluss steht sie alleine da, hat «die Herde verloren», der sie bisher gefolgt war.
Existenzielle Bedrohung
Furrer benennt sein Werk bedeutungsoffen «Invocation». Offen wirkt auch seine Musik. Die existenzielle Bedrohung, das unter der Oberfläche Lauernde, das Angedeutete prägt nicht nur das Dargestellte, es prägt auch die Musik. Furrer schreibt keine plakativen Gesten, aber er findet trotzdem Klänge, die sinnlich direkt erfahrbar sind.
Der stille Lärm der anonymen Masse und der unterdrückte Schrei schlagen sich nieder in einer hoch zerbrechlich wirkenden Musik, die mit Pausen zerklüftet und dynamisch stark zurückgenommen ist. Isolierte Klänge und Geräusche, manchmal fast in der Nähe des Schweigens, mutet Furrer nicht nur den Instrumenten zu, sondern auch den Singstimmen. Das ist Musik, die in ihrer Sparsamkeit hoch emotional wirkt - und gerade dadurch auch schwierig. Denn ständige Hochspannung raubt sich die Energie. Glücklich ist man deshalb um die raren Stellen, in denen das engagiert musizierende, hauseigene Ensemble «Opera Nova» die ständig latente Aggression auch einmal laut gegen aussen stülpt.
Heile Welt
Die Inszenierung von Christoph Marthaler und Annette Kuss steckt die heile Welt in die 50er-Jahre - eine ziemlich klischierte Idee, wenn man auf der Suche nach gesellschaftlicher Doppelmoral und unterdrückten Emotionen ist. Mit den hochgetürmten Frisuren der Damen des Vokalensembles Zürich, die über ein sich bewegendes Hauselement trippeln, gelingt zwar eine Schmunzelnummer, aber damit wird die eigentliche Brutalität der Vorgänge stark auf Distanz gehalten. Heftigeres ergibt sich durch den Kontrast der extremen Breite der Bühne mit der inneren Enge der Figuren, da finden Marthaler und sein Team zu starken und stillen Bildern.
|

8. 7. 2003
Zürcher Festspiele: Uraufführung von Beat Furrers «Invocation»
Zauber des Surrealismus
Beat Furrers vierte Oper bestätigte sich als Ereignis der Zürcher Festspiele. Auch weil Regisseur Marthaler den surrealen Zug des Werks kongenial nach aussen kehrt.
Von urs mattenberger
«Der dumpfe Lärm der Menschen, immer lauter. Es frisst mich auf. Unten einige Schreie. Rufe. Ein Mann, über sie geworfen, rief Liebste du», raspelt die schicke Blondine in nervösem Staccato ihren Text herunter, als wäre es nicht ihr eigener, sondern einfach eine Wortmasse, die sie loswerden muss: «Blut auf dem Mund, sagte sie, und er küsste sie. Aber in dieser Stadt, so klein sie auch sein mag, passiert alle Tage was. Das wissen Sie ja. Ich möchte Wein. Immer noch möchte ich welchen. Ich habe keine Lust, nach Hause zu gehen.»
Das könnte endlos weitergehen, wäre da nicht die Musik, die luftig dazwischen fährt - ein fragil aufgesplitterter Klang, als wäre etwas Zartes zerbrochen, das immer schon da war, auch wenn wir es erst jetzt, wo nur noch Scherben übrig bleiben, wahrnehmen. Das pointilistische Flirren, Kratzen und Schaben, das sich zu expressiven Gesten verdichtet - das Ensemble «Opera nova» mit Streichern, Bläsern und drei Perkussionisten - fragmentarisiert auch die Sprache: Die Syntax mit ihrer Scheinlogik fällt dahin und lässt nur Satzfetzen und Wörter zurück - punktuelle Einblicke in den Bewusstseinstrom, als der dieser anderthalbstündige Abend vorüberzieht.
Blut auf den Lippen
Damit führt der Schweizer Komponist Beat Furrer in seiner vierten Oper den Ansatz weiter, der schon seine früheren Arbeiten für das Musiktheater prägte. Zentral ist auch in «Invocation», am Sonntag im Schiffbau uraufgeführt unter der Leitung des Komponisten, die Absage an eine lineare Erzählform. Was es an Handlung gibt, ist schon in den ersten Sätzen der Frau umrissen: Sie wird Zeugin, wie eine Frau von ihrem Mann getötet wird - auf eigenen Wunsch, wie sie von einem Mann, den sie vor Ort antrifft, erfährt. Die Konfrontation mit dem Grenzen sprengenden Ereignis, in dem Liebe und Tod irritierend verschmelzen, stellt auch ihre eigene Existenz in Frage. Sie führt zum Ausbruch aus der gesellschaftlichen Ordnung, die die existenzielle Einsamkeit - zentrales Motiv des Werks - ohnehin nicht aufzuheben vermag.
In Marguerite Duras' Erzählung «Moderato cantabile», die Furrer mit Texten von Ovid, Cesare Pavese und Juan de la Cruz als Textgrundlage wählte, vollzieht sich das im Rahmen eines gesellschaftlichen Empfangs. In Furrers Oper aber wird der Bruch mit Konvention und Gesellschaft zum einen zurückgenommen in die assoziativ verflochtenen Reflexionen der in drei Figuren aufgespaltenen Protagonistin Anne (die Schauspielerin Olivia Grigoli, die Sängerin Alexandra von der Weth und die Flötistin Maria Goldschmidt). Theatral nach aussen gekehrt wird er zum anderen im Gegensatz zum Kollektiv (das vom Luzerner Peter Siegwart einstudierte Vokalensemble Zürich), das hier mit der Anonymität eines antiken Theaterchors agiert, zugleich aber dem Abend mit expressivem Gesang die «dionysisch» brodelnden Höhepunkte gibt.
Der Graben zwischen mir und dir
Eine unüberbrückbare Kluft zwischen dem Ich und den anderen: Diesen Aspekt akzentuiert in Zürich die Regie von Christoph Marthaler. Ein Wurf ist allein schon die Bühne von Bettina Meyer: Als Spielfläche dient eine lange Brücke, auf der die Darsteller dem Publikum auf Du und Du gegenübersitzen und ihm doch - jenseits des Orchestergrabens - unerreichbar bleiben. Selbst die Sprecherrolle des Mannes, die Marthaler hinzufügte (der ruhige Gegenpol zur nervös gespannten Anne: Robert Hunger-Bühler), akzentuiert noch die Einsamkeit der Frau, weil sie einander ihre trostlosen Vertraulichkeiten über die Distanz dieser Hundertmeter-Bahn hinweg zuraunen (alle Stimmen werden verstärkt).
Der zentrale Gedanke von Furrers Musiktheater, nämlich zu einem gleichzeitigen Ineinander zu verknüpfen, was in der äusseren Realität zeitlich und räumlich auseinanderfällt, wird bei alledem vor allem durch das musikalische Gewebe der filigranen Instrumental- und Vokalstimmen eingelöst. Die Möglichkeiten simultaner Darstellungsformen, mit denen seit Zimmermanns «Soldaten» längst auch experimentiert wurde, spielen dagegen eine geringe Rolle; Sprech- und Gesangspassagen etwa bleiben fein säuberlich getrennt.
Das Hauptverdienst von Marthalers Inszenierung dürfte sein, dass sie diesen surrealen Zug des Werks doch noch theatral und zauberhaft subtil nach aussen kehrt. Denn die Bühnenrampe dient zugleich als Schiene, auf der ein putziges Häuschen - Symbol der bürgerlichen Welt, der Anne sich entfremdet -, von einer Seite zur andern hin und her geschoben wird. Wenn so die Spielebenen - hier Anne allein auf einer der vereinzelt plazierten Sitzbänke, dort die in Lächelposen erstarrte Partygesellschaft im Haus - buchstäblich ineinander- und durcheinander fliessen wie in einer surrealistischen Buñuel-Filmszene, wird das musikalische Fluidum von Furrers Musik auf der Bühne in irritierend starke Bilder übersetzt: Eine traumhaft schöne Produktion, für die der Schiffbau den idealen Rahmen abgab, die man sich aber ebenso gut auch im Luzerner Saal des KKL vorstellen könnte.
|
 8. 7. 2003
8. 7. 2003
Die Sinfonie des Pianissimo
Uraufführung von Beat Furrers «Invocation» an den Zürcher Festspielen
Lange musste auf die Oper des Schweizer Komponisten Beat Furrer gewartet werden. Zu den Zürcher Festspielen nun ist sie fertig geworden und am Sonntag als Koproduktion vom Zürcher Opern- und vom Schauspielhaus uraufgeführt worden.
Von Reinmar Wagner
Um eine Klavierstunde geht es. Um eine Diabelli-Sonate. Und um einen Mord. Oder vor allem um den Schrei, der zum Mord gehört. Um Anne, die ausbricht aus ihrer gutbürgerlichen Existenz. Um erotische Entgrenzung und die Todesnähe der Ekstase. Oder eigentlich auch nicht, denn was in Beat Furrers «Invocation» vom Roman «Moderato cantabile» von der französischen Schriftstellerin Marguerite Duras übrig geblieben ist, tendiert gegen null. Stattdessen fügte Furrer Texte von Cesare Pavese, Ovid und anonymen Spaniern ein, die man allerdings auch versteht, weil sie vom Vokalensemble bis zur Unkenntlichkeit in Silben, Konsonanten und Geräusche zerlegt werden. Ob das Sinn ergibt?
Wie die Acapickels
Handlung jedenfalls gibt es keine. Was es gibt, ist Atmosphäre. Und Bilder. Für die Atmosphäre ist Furrers Musik zuständig. Für die Bilder Christoph Marthaler. Auch wenn der scheidende Schauspielchef einen grossen Teil der Arbeit an seine Co-Regisseurin Annette Kuss delegiert hat, so ist es doch typisch Marthaler geblieben. Das Dutzend Sänger und Sängerinnen des Zürcher Vokalensembles unter Peter Siegwarts Leitung geben ihm mehr als genug Rohmaterial, um seine Normalo-Figuren zu kreieren.
Wie die Acapickels trippeln die Damen auf dem Laufsteg umher, farbenfroh kostümiert und stets züchtig die Knie zusammen, wenn sie zu viert auf den vier Parkbänkchen Platz nehmen. Anne, die Hauptperson, gesplittet in eine Sängerin (Alexandra von der Weth), eine Schauspielerin (Olivia Grigolli) und eine Flötistin (Maria Goldschmidt) fällt allein schon dadurch aus diesem Rahmen, weil sie auch mal die Beine offen hält.
Das Blasgeräusch ist genug
Aber sonst? Atmosphäre wie gesagt. Furrers Musik ist eine Sinfonie des Pianissimo. Über weite Strecken interessiert sich der Komponist nur für die allerleisesten Töne, welche das Ensemble aus den gängigen Streich-, Holz- und Blechblasinstrumenten sowie viel Schlagwerk und Klavier herausbringen kann. Gestrichen wird meist auf dem Steg, geblasen wird ohne dass ein instrumententypischer Klang entsteht, das reine Blasgeräusch ist Furrer schon genug.
Genauso hält er es mit den Gesangsstimmen: Atmen, Flüstern, aspirierte Konsonanten. Das ist alles so leise, dass es verstärkt werden muss, um überhaupt beim Publikum anzukommen. Zum Leisen kommt noch das Kurze. Kaum ist ein Klang entstanden, wird er auch wieder zum Verstummen gebracht. Durch die Partitur, oder notfalls auch durch eine energische Geste des dirigierenden Komponisten.
Das Laute, wenn es denn zugelassen wird, ist ebenfalls auf extrem kurze und scharfe Akzente beschränkt, ausser in den drei Höhepunkten, wo sich die Musik aufschwingen darf, und wo sie nach dem langen Flüstern auch intensiv die Lautstärke erleben lässt.
Zwei grosse Szenen für die Solosopranistin im Duett mit der Flöte, wo von beiden einige Extreme an technischen Möglichkeiten gefordert werden, gehören zu den musikalischen Höhepunkten, aber eigentlich sind das Konzertstücke, und selbst bei Marthaler kommt alle szenische Bewegung zum Erliegen.
In der Sackgasse
Furrer fordert mit seiner «Invocation» die Möglichkeiten und Grenzen des Musiktheaters bis zum Äussersten heraus. Er hatte in Zürich in jeder Beziehung Musiker, die seinen Absichten mit hoher technischer und musikalischer und auch szenischer Präzision entgegenkommen konnten.
Und er muss wohl einsehen, dass sein experimentelles Stück eben Experiment bleiben wird. Es ist nicht abzusehen, wie sich darauf eine Aufführungstradition etablieren könnte. Und wenn doch, dann führt er für das Musiktheater in eine Sackgasse. Oder aber wir irren uns und stehen hilflos vor einem Kunstwerk, das wir (noch) nicht zu erkennen fähig sind.
|

8. 7. 2003
Der sublimierte Schrei
Zürcher Festspiele: Zur Uraufführung der Oper «Invocation» des Schweizer Komponisten Beat Furrer in der Zürcher Schiffbauhalle
Es ist nach Roland Mosers «Avatar» bereits die zweite Oper eines Schweizers, die in diesem Jahr in der Schweiz uraufgeführt wird: In Beat Furrers «Invocation» übernimmt die Musik die Hauptrolle - die Inszenierung aber erweist sich als überflüssig.
Bettina Spoerri
Warum wird ein Musikstück eigentlich inszeniert, mit Schauspielern, Sängerinnen und Sängern, einem Bühnenbild und vielem mehr? Eine naive Gretchenfrage? Eine Inszenierung kann zusätzliche inhaltliche Ebenen schaffen, verdeutlichen, aktualisieren, Kontrapunkte setzen und vieles mehr.
Die grundsätzliche Frage nach dem Sinn von Inszenierungen musikalischer Werke aufzuwerfen, ist angesichts von Marthalers Mise en Scène von «Invocation», bei der ihn Annette Kuss unterstützt hat, berechtigt. Zu sehr scheint der Regisseur in seinem bekannten Trickfundus gewühlt und auf charakteristische Stilmittel seines Theaters zurückgegriffen zu haben, als dass der Eindruck entstehen könnte, er hätte sich wirklich auf die Klang- und Gedankenwelt Beat Furrers eingelassen.
Abstraktes Konzept
Fünf Sitzbänke auf einem Steg, eine Uferpromenade andeutend, und ein sich seitwärts verschiebendes, kubisches Haus bilden das Bühnenbild (Bettina Meyer), stilisierte Gesten prägen das Spiel der Figuren, deren Kleider und Frisuren auf die späten 50er- Jahre verweisen - und damit auf die Entstehungszeit von Marguerite Duras’ «Moderato Cantabile», der zentralen literarischen Vorlage des Librettos (Beat Furrer/ Ilma Rakusa). Marthaler zelebriert einmal mehr die Langsamkeit. Da sind die im Zeitlupentempo Treppen hinauf- und hinabsteigenden, marionettenartigen Figuren, die nie irgendwo ankommen, von spastischen Anfällen Heimgesuchte oder Fusstrippeleien, die von einer Komik sind, die Schiffbaugängerinnen und -gänger vertraut anmutet - hier aber fremd wirkt. Diese Choreografie wirft mehr Fragen auf, als dass sie eine vertiefende oder klärende bildliche Ebene eröffnete. Immerhin ist die szenische Dreidimensionalität so formalistisch reduziert wie die Musik.
Zugegeben: Die Schwierigkeit einer Umsetzung von «Invocation» liegt bereits im abstrakten Konzept der Oper begründet, das wenig «Angriffsfläche» für einen sinnlichen Zugang bietet. Die bei Duras zurückgenommene, kaum vorhandene Handlung wird im Libretto auf einige wenige zentrale Sätze reduziert und mit lateinischen, spanischen, italienischen und altgriechischen Zitaten aus Antike, Mittelalter und Moderne angereichert - von Ovid über Johannes vom Kreuz bis hin zu Cesare Pavese. Eine eklektische Technik, die der Wahl Wiener Beat Furrer bevorzugt anwendet, zuletzt in der Oper «Das Begehren» von Anfang Jahr.
Der Mord an einer Frau und die angedeutete Möglichkeit der Wiederholung der Beziehung zu ihrem Mörder in einer neueren Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau: diese Grundstruktur der Duras-Erzählung hat sich in die musikalische Konstruktion zurückgezogen. Ebenso der Ausbruch der Frau aus den gesellschaftlichen Normen in einem Weinrausch. Die Wiederholungen betreffen jetzt das Tonmaterial, der Rausch wird zu einer Anrufung, einer «Invocation» des Weingottes Dionysos.
Musik als Hauptdarstellerin
Der Schrei des Mordopfers kehrt transformiert wieder als Crescendi, Eruptionen und Töne in höchster Lage. So wird die Musik zur Hauptdarstellerin; sie bewegt sich wie ein sich windender Körper fort und zieht alles in ihren Sog: An die hörbare Oberfläche dringen Vokale, Atemgeräusche, Gemurmel, gehauchte Töne. Trommelfelle werden gerieben, die Holzstäbe der Marimbaphone mit Violinbögen in sanfte Vibration versetzt, die Saiten des Klaviers gezupft oder das Mundstück der Flöte zischend überblasen. Die Komposition, in der kleine Sekunden, Cluster und Glissandi vorherrschen, zuckt, hält inne, schwellt an und ab, bewegt sich nah an der Grenze zum reinen Geräusch und wird noch einmal fragmentiert mittels Projektionen der Klänge durch in der Halle verteilte Lautsprecher.
Souveräne Musiker
Diese zerbrechliche, komplexe Musik, die höchste Anforderungen stellt, interpretiert das Ensemble «Opera Nova» des Orchesters der Oper Zürich - unter dem Dirigat des Komponisten selbst - einfühlsam und präzise. Auch die drei Quartette, welche die Bühne bevölkern - in Wiederholung des Protagonistenpaares Kombinationen von je zwei männlichen und zwei weiblichen Mitgliedern des Vokalensembles Zürich -, singen und spielen souverän. Drei Frauen verkörpern die Protagonistin Anne: die Sopranistin Alexandra van der Weth (Anne 1), die Schauspielerin Olivia Grigolli (Anne 2) und die Bassflötistin Maria Goldschmidt (Anne 3). Während Anne 2 Duras-Zitate emotionslos heruntersagt und von einem «Er» (Robert Hunger-Bühler) verfolgt wird, entspinnt sich zwischen Flöte und Gesangsstimme ein intimes Zwiegespräch. Alexandra van der Weth erweist sich dabei wie Maria Goldschmidt als begabte Interpretin moderner Musik.
Das Publikum wirkte zuletzt erschöpft, applaudierte aber ausgiebig - und machte deutlich, dass seine Begeisterung in erster Linie den musikalischen Leistungen und dem Komponisten galt.
Wörtlich
Schrei und Mord
Sie: Fang an. Fang noch mal an, hab ich gesagt.
Ich möchte Wein. Immer noch möchte ich welchen.
Sie wissen, dass Sie gar nicht mehr anders können, als zu spät zu kommen, Sie wissen es? (...)
Unten einige Schreie. Rufe.
Ein Mann über sie geworfen rief Liebste du.
Da? Warum nicht?
Komm da oder sonst wo. (...)
Blut auf dem Mund sagte sie, und er küsste sie.
Aber in dieser Stadt, so klein sie auch sein mag, passiert alle Tage was. Das wissen Sie ja.
Was Sie da sagten, sind Vermutungen. Ich habe nichts gesagt.
Ich möchte Wein.
Aus dem «Invocation»-Libretto
|

8. 7. 2003
Uraufführung von Beat Furrers «invocation» bei den Zürcher Festspielen
«Das Brausen des Meeres steigt ins Schweigen»
Ungewöhnlich viel abendliches Schwarz und Lang gabs am Sonntagabend in der Zürcher Schiffbauhalle: Die grosse Festspiel-Opernpremiere fand für einmal extra muros in Zürich-West statt, mit Christoph Marthalers Uraufführungsinszenierung von Beat Furrers «invocation», einem Auftragswerk des Opernhauses in Koproduktion mit dem Schauspielhaus. Ungewöhnlich wenig Abendliches dagegen im Orchester, das, seine traditionelle Funktion im Musiktheater ironisch unterstreichend, als Servierpersonal gekleidet war.
Von Andreas Klaeui
Als «Musiktheater in acht Teilen» bezeichnet der in Wien lebende Schweizer Komponist Beat Furrer sein Stück «invocation», es gliedert sich nach Texten von Juan de la Cruz, Ovid, Cesare Pavese und andern, die Hauptvorlage aber ist Marguerite Duras’ Roman «Moderato cantabile». So sollte die Oper ursprünglich auch heissen.
In Duras’ Roman mit dem musikalischen Titel begleitet eine Frau, Anne Desbarèdes, ihren Sohn in die Klavierstunde, eine seltsame Stimmung, «Das Kind rührt sich nicht. Stur. Manchmal glaube ich, ich habe dich erfunden. Fang an. Fang nochmal an, hab ich gesagt. Das Brausen des Meeres stieg ins Schweigen» heisst es in Furrers Libretto, dann ist aus einem Bistro auch ein Schrei zu hören, ein Mord, offenbar aus Liebe, das lässt die Frau nicht mehr los und sie geht von nun an täglich in das Bistro, trinkt Rotwein, verliebt sich in einen Zeugen - es gibt davon eine legendäre Verfilmung von Peter Brook aus dem Jahr 1960, mit Jeanne Moreau und dem jungen Jean-Paul Belmondo.
Hymnische Anrufung
Beat Furrers «invocation» ist aber nicht einfach eine Vertonung des Duras’schen Texts. Schon deshalb nicht, weil Furrer noch andere Texte hinzunimmt, Ovids Fama-Erzählung aus den Metamorphosen, eine hymnische Anrufung des Dionysos (daher der Titel «invocation») in formelhaften Attributen: «Agrion / Areton / Kryphion / Dimorphion - Grausamer, Unaussprechlicher, Verborgener, Zweigestaltiger...» Es ist auch deshalb nicht einfach eine Vertonung des Duras’schen Texts, weil Furrer in seiner Komposition weit mehr als den Worten und der Erzählung der Atmosphäre des Romans folgt.
Es geht um eine Frau, die erstaunt an sich feststellt, dass sie von etwas überwältigt wird, was sie nicht kennt. Die Grenzen überschreitet und ihre Welt verlässt und nicht weiss, wie ihr geschieht. In hypernervösen Sätzen beginnt die Schauspielerin Olivia Grigolli im Orchester sitzend mit Duras’ Text, «Fang an. Fang nochmal an, hab ich gesagt», und: «Der Duft der Magnolien ist so schwer.» Jäh fällt ihr Musik ins Wort. Furrers Musik in «invocation» ist ein tektonisches Flirren, sie wirft sich auf und bricht abrupt ab, eine aus ostinaten Mustern zusammengeschichtete Komposition, die unentwegt wuselnd und etwas hermetisch rotiert.
Doch trifft das mit seinem scharrenden Sichvortasten und sich immer gleich Zurücknehmen erstaunlich genau das Parfum von Duras’ Roman. Furrer hat die Anne-Figur auf drei Interpretinnen aufgeteilt, eine Sopranistin, eine Schauspielerin und eine Flötistin. Orchestrale und chorische Passagen (die äusserst konzentrierten Ensembles Opera Nova und Vokalensemble Zürich unter der Leitung des Komponisten) wechseln sich mit Sprechsequenzen der Schauspieler Olivia Grigolli und Robert Hunger-Bühler ab und mit dem Sopran-Solo im Dialog mit einer Bassflöte. Zu verstehen sind nur die Duras-Passagen bei den Schauspielern. Furrer benutzt auch das Textmaterial als Klangsteinbruch und splittet die Worte in klingende Bruchstücke. Immer wieder lässt er Sätze abbrechen, bleiben Silben in der Luft hängen, verglühen hastig hingeworfene Klangfragmente.
Die Sopranistin Alexandra von der Weth streicht manche Töne nur an (in dem Sinn, wie man ein Glas anstreicht), die Flötistin Maria Goldschmidt überhaucht ihre Töne manchmal nur, die Bewegung findet im Körper manchmal nur in Bruce-Nauman-artigen Zuckungen einen Ausdruck: ein Feld für einen Regisseur wie Christoph Marthaler. Er findet ein überraschendes und einleuchtendes Bild für Beat Furrers Musik: In einem Moment führen die Sänger allesamt Stimmgabeln an die Nase und riechen daran. An den Klängen nur riechen, das trifft schon was von Furrers Musikgestus und von Duras’ «Moderato cantabile».
Surreale Lautlosigkeit
Auf einer langen, schmalen Tribüne, die die ganze Schiffbau-Wand traversiert, zelebrieren Marthaler und Koregisseurin Annette Kuss die bekannten Marthaler-Gruppengänge, das bruchstückhafte Sichvortasten und Straucheln. In surrealer Lautlosigkeit, wie eine De-Chirico-Veranda fährt Famas Haus als Hohlform über die Bühne, das Haus, das bei Ovid die Klänge zurückwirft und wiederholt, was es hört. Doch ist das kein Lärm, sondern «leises Murmeln wie von Meereswellen». Und zu einem breit angelegten Furrer-Meeresmurmelcrescendo windet und verrenkt sich Annes Körper und weiss nicht, wie ihm geschieht.
|
 8. 7. 2003
8. 7. 2003
Ein Mord kann so vieles verändern
Christoph Marthaler macht Beat Furrers "Invocation" zu einem Triumph zeitgenössischen Musiktheaters
von Manuel Brug
Zürich - Es geht also doch! Da begibt man sich Jahr für Jahr auf den steinigen Parcours, der mit der Uraufführung zeitgenössischer Opern gepflastert ist. Man wühlt sich durch literarische Vorlagen samt Subtexten, die meist zu verrätseltem Text samt nichts sagendem Titel gebündelt sind. Man verästelt sich brav mit dem Finger auf der Partiturlinie in kompliziertest polyphone Chöre. Man geht allen vokalen und existenziellen Aufspaltungen meist namenloser Protagonisten nach, die von Einsamsein und Verlorenheit brabbeln. Man hört auf eine kaum wahrnehmbare, verwisperte Musik. Man langweilt sich. Und hakt ein Stück ab, dem man nie wieder begegnen möchte, wohl nie wieder begegnen wird.
Dann kommt irgendwann doch der Abend, wo alle diese zu Klischees geronnenen Bestandteile vorhanden sind - und trotzdem macht es klick, ist es perfekt, bereitet es Spaß, Spannung. Man will das Stück gleich wieder hören - und sehen. Schon um zu überprüfen, was anderen als Christoph Marthaler einfällt, der in einer Zusammenarbeit von Zürcher Oper und Schauspielhaus im dortigen Schiffbau Beat Furrers Musiktheater in acht Bildern "Invocation" wunderfein uraufgeführt hat.
Der 49-jährige Furrer, bester Schweizer Tonsetzer im Wiener Exil, hat in seinem vierten Opus für ein die Oper konsequent weiterentwickelndes Musiktheater ein betörend schlichtes, höchst raffiniertes und sehr schönes Meisterwerk geschaffen. Ursprünglich "Moderato Cantabile", jetzt "Invocation" - "Anrufung" - geheißen, zieht er sein Thema aus der gleichnamigen, 1958 erschienenen Novelle von Marguerite Duras. Den hausfraulichen Existenzialismus der Vorlage, in der eine Fabrikantengattin im Café einen Mord aus Leidenschaft beobachtet und durch Gespräche mit einem unbekannten Mann ihr Leben zu ändern beginnt, geht uns nur durch den bitteren Blick von Jeanne Moreau nach, die durch die Peter-Brook-Verfilmung schlafwandelt.
Furrer reduziert das Geschehen, im Buch durch das vom Schuss gestörte Moderato Cantabile einer Diabelli-Sonate rhythmisiert, auf das Äußerste, verdichtet und erweitert, kommentiert und kontrapunktiert. Ganz leise und minimalistisch, in Furrer-typisch dem Atemhauch abgelauschten, doch spannungsvollen Fetzen setzt das mit einfachem Streicherpulten, aber drei Marimbas besetzte Orchester der 20 Musiker des Ensembles "Opera Nova" ein. Die angstvolle Stimme der Schauspielerin Olivia Grigolli steigt zwischen den als Ober und Saaltöchter gekleideten Spielenden auf. Der Schuss ist längst gefallen das Geschehen nimmt - "moderato" bedeutet "gemäßigt", "cantabile" meint "singend" - seinen Lauf, tragödienhaft, doch still und leise.
Einen 30 Meter langen Holzsteg, die Promenade am Meer, hinter der das Salz auf der Haut der Schiffbau-Wände blüht, hat Bettina Meyer quer in die lange Halle gestellt. Davor sitzt das Publikum ganz nah dran und wird doch auf Distanz gehalten, wenn die Grigolli und Robert Hunger-Bühler als der nüchterne Unbekannte miteinander zu kommunizieren versuchen.
Unmerklich schieben sich in die acht Teile des knapp 90-minütige Rondos einer Verzweifelten - wir wollen sie Anne1 nennen - Fremdkörper. Zum einen als Anne2-Aufspaltung dieser sonst namenlosen Sie die kongenial hysteriegefährdete, dabei hocherotische Sopranistin Alexandra von der Weth. Anne2 singt spanische Barocklyrik, die vom Begehren und Verlieren, schließlich von dionysischer Vereinigung handelt. Als Anne3 und ruhenden Pol gesellt sich - wie schon zu den wahnsinnig werdenden Primadonnen der romantischen Oper - die Flöte, mal Bass, mal Sopran, in Gestalt von Maria Goldschmidt dazu. Alle tragen sie helle Trenchs und blonde Perücken.
In schönste Fifties-Kostüme hat Annabelle Witt den zwölfköpfigen Chor des fabulösen Vokalensembles Zürich gekleidet. In hellen Anzügen und mit Glasperlen bestickten Seidenkleidern sitzen sie erst wie Spaziergänger auf den Bänken, singen ein lichtes Madrigal nach Pavese, dann unisono einen Text aus Ovids Metamorphosen und schließlich eine sie fast verschlingende, nun auch im Fortissimo sich entäußernde Orphische Hymne als akustischen Opfergang. Er und Sie, Ovid und Pavese, Furrer ist den Weg seines "Narcissus" und von "Begehren" weitergegangen. So bildungsbedeutsam das alles klingt, so sinnfällig und leichgewichtig löst es sich in der vom Komponisten dirigierten, schlanken und doch gehaltvollen Partitur, in Marthalers rhythmisch unauffälliger Bewegungsregie. Wahrlich: ein seltener Glücksfall im zeitgenössischen Musiktheater.
|
Wiesbadener

8. 7. 2003
Oper der leisen Töne
Zürich: Beat Furrers "invocation" in Marthalers Regie uraufgeführt
Von dpa-Korrespondentin Gisela Mackensen
Anne, Frau eines reichen Fabrikanten, ist mit ihrem Sohn bei einer Klavierlehrerin in irgendeiner Stadt am Meer. Das Pianospiel des Kindes wird plötzlich von einem Schrei auf der Straße unterbrochen. In einer Kneipe hat ein Mann seine Geliebte erschossen. Anne wird von dem Ort des Verbrechens magisch angezogen. Der Schrei lässt sie nicht mehr los. Fast täglich kehrt sie in das Lokal zurück, wo sie immer wieder mit einem Unbekannten über den Mord aus Leidenschaft spricht. Sie spürt das strenge Korsett ihres bürgerlichen Lebens und sehnt sich nach echten Gefühlen.
Diese fragmentarische Erzählung von Marguerite Duras hat den Schweizer Komponisten Beat Furrer zu seiner Oper "invocation" (deutsch etwa: Anrufung) inspiriert. Das Musiktheater in acht Bildern wurde jetzt in Zürich in der Schiffbauhalle aufgeführt und vom Publikum bejubelt. Es ist die dritte Oper des in Österreich lebenden Musikers nach "Narcissus" (1994) und "Begehren" (2003), die beide in Graz uraufgeführt wurden. Zum Werk des Professors an der Musikhochschule Graz gehören außerdem die Kammeroper "Die Blinden" sowie kammermusikalische Stücke. Furrer geht es um die Einheit von Text und Musik. Dabei erzählt er keine Geschichte, sondern überträgt die Worte in Musik, die zugleich Atmosphäre beschreibt und Raum für Assoziationen bietet. Die Titelfigur Anne erscheint in dreifacher Verkörperung mit platinblonder Perücke und Trenchcoat: als Sopranistin (Alexandra von der Weth), als Schauspielerin (Olivia Grigolli) und als Flötistin (Maria Goldschmidt). Dabei dient dem 1954 in Schaffhausen geborenen Komponisten die Flöte als Scharnier zwischen Sängerin und Schauspielerin, die manchmal nur einzelne Worte oder Satzfetzen herausbringen.
Die Musik, die das Ensemble "Opera Nova" des Orchesters der Oper Zürich meisterhaft spielt, ist leise und zerbrechlich. Begleitet werden die Solisten vom Vokalensemble Zürich, das manchmal nur flüstert und seufzt. Das Publikum spendete den sechs Frauen und sechs Männern im 50er-Jahre-Look - die Damen in pastellfarbenen Cocktail-Kleidern und mit Hochfrisur - besonders herzlichen Applaus.
Regie in dieser ersten Ko-Produktion zwischen Zürcher Oper und Schauspielhaus führt Schauspielhaus-Intendant Christoph Marthaler. In dem als "Meister der Langsamkeit" bekannten Regisseur hat Furrer einen idealen Partner gefunden. Seine Inszenierung ist sparsam und ordnet sich der Musik unter. Anne als Schauspielerin verzichtet aber nicht auf die Marthaler-typischen akrobatischen Verrenkungen, wenn sie sich, vom Wein berauscht, zitternd und zappelnd aus der Starre ihres langweiligen Lebens zu befreien sucht. Annes anonymen Partner in der Kneipe verkörpert der Schauspieler Robert Hunger-Bühler.
|

8. 7. 2003
Das gefesselte Begehren
Christoph Marthaler bringt Beat Furrers Musiktheaterstück "Invocation" in Zürich zur Uraufführung
Man braucht ja so wenig, um Theater zu machen. Ein langer Steg, der sich quer durch die ganze Schiffbauhalle in Zürich zieht, darauf fünf Parkbänke, auf denen sich die Choristen marthalerisch platzieren - paarweise, doch beziehungs- und teilnahmslos, mit leeren Gesichtern starr geradeaus blickend. Und am Ende der Uraufführung von Beat Furrers "Invocation", von Christoph Marthaler und Annette Kuss auf eben jenem Steg inszeniert (Bühne: Bettina Meyer, Kostüme: Anabelle Witt), fragt man sich, warum Musiktheater nicht immer so funktio-niert. Es scheint so leicht, mit so wenigen Mitteln so stimmig zu arbeiten.
Ein begehbarer Würfel ist da noch, mit Ziegeldach und Veranda zum Modell eines südländischen Häuschens stili-siert. Das schiebt sich langsam den Steg entlang, über die Parkbänke hinweg, die es auf der einen Seite in sich aufnimmt und auf der anderen wieder entlässt. Wenn sich in dieser erstarrten Gesellschaft überhaupt etwas bewegt, dann sind es die Wände. Der Rest verharrt in Warteposition. Immerhin: Das wandernde Haus zwingt die Sitzenden, die Füße zu heben und trippelnd auf den Boden zu setzen, der unter ihnen weggezogen wird. Ein kurzer Moment der Komik in einem ansonsten beklemmenden Stück über das gefesselte Begehren.
"Begehren" hieß auch Furrers letzte Arbeit für das Musiktheater und in gewisser Weise scheint es mit "Invocation" seine Fortsetzung zu finden. Der Stoff basiert auf dem Roman "Moderato Cantabile" von Marguerite Duras, der mit Texten von Juan de la Cruz, Ovid und Cesare Pavese interpretierend unterfüttert wird: Anne wird von einem Schrei aus einem nahe gelegenen Café aus den geordneten Bahnen ihres Lebens geworfen. Geschrien hatte eine Frau in dem Moment, als ihr Liebhaber sie erschoss. Die Leidenschaft des Schreis und das Bild des Mannes, der sich auf die verlorene Geliebte wirft, zieht Anne an. Sie verstrickt sich selbst in eine ähnliche Geschichte erotischen Verlangens, sie überschreitet die Grenzen ihres moderato geführten Ehelebens - und vermag doch nicht, ihrem Begehren nachzugeben.
Bei Furrer ist Anne dreigeteilt - eine Art multiple Persönlichkeit, dargestellt von einer Sopranistin (Alexandra von der Weth), einer Schauspielerin (Olivia Grigoli) und einer Flötistin (Maria Goldschmidt). Das führt unweigerlich zu inneren Kämpfen - Marthaler inszeniert sie als Krämpfe, von denen Anne mitten in guter Gesellschaft geschüttelt wird, und Furrer fasst sie in eine Musik der unterdrückten Erregung. Sie bringt uns Annes Zustand nahe als nicht endendes Würgen an einer Leidenschaft, die heraus will und doch immer wieder in die Untiefen des Leibes zurückgezwungen wird. Fantastisch, wie sowohl Alexandra von Weth als auch Olivia Grigolli diesen emotionalen Notstand zusammen mit Robert Hunger-Bühler als "Er" darzustellen wissen.
Furrers Musik verbindet sich ideal mit dem Stoff des Duras-Romans, den er anstatt nachzuerzählen auf eine reflektierende Ebene hebt. Es ist eine leise, diffizile Musik. Aber sie kommt nicht aus der Stille. Vielleicht geht sie dorthin, vielleicht wird sie sogar dazu gezwungen - so wie man hochkochende Gefühle unter eine beschwichtigte Oberfläche zwingt. Leise ist eben nicht dasselbe wie ruhig. Gefühlsverästelungen kennt diese Musik, die der Komponist am Pult des Ensemble Opera Nova von der Zürcher Oper und unterstützt vom Freiburger Experimentalstudio der Heinrich-Strobel-Stiftung zu einem beeindruckenden Psychogramm verdichtet. Auch das ausgezeichnete Vokalensemble Zürich trägt erheblich zu der musikalischen Nuancierungskunst bei. Furrers Handschrift findet nicht nur in Marthalers reduziertem Stil ein passendes Gegenstück, seine Szene ist außerdem so behutsam aus der Musik heraus entwickelt, dass beides zu einer gänzlich stimmigen Einheit verschmilzt - eine Herausforderung für alle kommenden Regisseure.
|
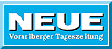
8. 7. 2003
Die Meister der Stille
Viel Applaus für Beat Furrers Musiktheater "Invocation" im Zürcher Schiffbau.
VON KARLHEINZ PICHLER
Orchester, Solisten, Chor und Sprecher waren am Sonntagabend, als Beat Furrers "Invocation" im Zürcher Schiffsbau uraufgeführt wurde, sichtlich konzentriert und motiviert. Sie trugen jedenfalls viel dazu bei, dass Furrer, der selber dirigierte, nur wenig Mühe hatte, sein doch schwieriges Stück exzellent über die Bühne zu bringen. Das Premierenpublikum, das die Schiffsbauhalle bis auf den letzten Platz füllte, quittierte das Auftragswerk des Zürcher Opernhaus nach anfänglichem Verhalten letztlich auch mit viel Applaus.
Das Libretto fusst mehr oder weniger auf der Erzählung "Moderato Cantabile" von Marguerite Dumas: Die Industriellengattin Anne begleitet ihr Kind zur Klavierstunde. Die Lehrerin versucht vergeblich, dem Kind die Spielanweisung "Moderato Cantabile" nahe zu bringen. In einem nahe gelegenen Café fällt ein Schuss, dann ertönt ein Schrei. Anne mischt sich unter die Schaulustigen und sieht eine Tote und deren an sie geschmiegten Geliebten. Fortan besucht sie täglich das Café und versucht, den Hintergründen des Mordes auf die Spur zu kommen.
Innen und außen
Beat Furrer zerlegt diese Geschichte in acht Bilder. Eine Schauspielerin, Eva Grigolli, verkörpert die innere Stimme der Anne, während die Sopranistin Alexandra von der Welth den Part der äußeren einnimmt. Die stark präsente Flöte, die für Furrer als eine Art Resonanzrohr des Inneren fungiert, da sie direkt an Mund und Kehlkopf ansetzt, ist das Bindeglied zum Orchester.
Das Stück entwickelt sich überaus reduziert und leise. Einzig in der vorletzten Szene, die der Anrufung des Dyoniseus gewidmet ist, entfaltet sich der Klangkörper des Ensemble "Opera Nova" zur Gänze, wobei über weite Strecken die drei Schlagzeuger das Kommando übernehmen.
"Invocation" stellt die erste Koproduktion von Oper und Schauspielhaus Zürich dar. Christoph Marthaler, der für die szenische Regie verantwortlich zeichnet und selber als Meister der Stille und der Pausen gilt, mag hier großteils als kongenialer Partner in Erscheinung treten.
An einigen Stellen aber wartet Marthaler mit derart überraschenden Effekten auf, dass man sich wohl nicht zu unrecht fragt, ob es nicht besser wäre, so ein Stück um der Musik willen konzertant aufzuführen.
Viel Applaus gab es in Zürich für Beat Furrers Uraufführung "Invocation" - was ja bei moderner E-Musik nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit ist.
|
Der Tagesspiegel
9. 7. 2003
Somnambule Stolpertänze
Oper Zürich: Beat Furrers "invocation", uraufgeführt von Christoph Marthaler
Von Alfred Schlienger
Vielleicht ist es der Urmythos der Kunst, des Lebens, der Menschheit überhaupt: die Verschmelzung von Liebe und Tod. Marguerite Duras fasst ihn 1957 in ihren kleinen Roman "Moderato cantabile" und schildert darin gleichzeitig einen Ausbruchsversuch aus einer erstarrten bürgerlichen Welt.
Wie jede Woche begleitet die Fabrikantengattin Anne ihren Sohn in die Klavierstunde. In die endlosen Repetitionen von Diabellis Sonatine "Moderato cantabile" fällt ein alles durchdringender Schrei aus dem nahen Arbeiter-Bistro: Ein Mann hat seine Geliebte getötet, offenbar auf ihr Verlangen hin. Er wirft sich über die Tote, " . . . man sah seine Augen. Jeder Ausdruck war aus ihnen gewichen, außer – zerschmettert, unzerstörbar, weltentrückt – dem seiner Leidenschaft."
Anne gerät in den Sog dieses Verbrechens, täglich geht sie von nun an in das Bistro, versucht den Vorfall zu ergründen, verliebt sich in einen unbekannten Zeugen der Tat. Entleert von ihrem "moderaten" Leben, beginnen die Grenzen zwischen dem fremden und dem eigenen Schicksal zu zerfließen. Im Kontakt zu dem arbeitslosen Fremden scheint sich die Beziehung der Toten zu ihrem Mörder wiederholen zu wollen. Doch der soziale Abstand ist zu groß, die Angst vor dem verschlingenden Eros zu stark, es bleibt bei einem in Gedanken vollzogenen Ehebruch. Peter Brook hat den Roman bereits im Jahre 1960 verfilmt, mit Jeanne Moreau und Jean-Paul Belmondo in den Hauptrollen. In Zürich wird er nun zur Oper, als Auftragswerk des Opernhauses an den in Wien lebenden Schweizer Komponisten Beat Furrer und in Koproduktion mit dem Zürcher Schauspielhaus, inszeniert von Noch-Chef Christoph Marthaler persönlich.
Die Bühne von Bettina Meyer ist ein Endlos-Steg in der ganzen Länge der großen Schiffbauhalle. Und wenn die beiden Menschenkinder, die zueinander nicht kommen können, ihre so intimen wie brüchigen Dialogfetzen austauschen, dann sitzen sie in größtmöglicher Entfernung am je äußersten Ende dieses Steges auf sterilen weißen Bänken. Einsamkeit, Verzweiflung, Verlorenheit in jeder Geste, jedem Blick. Olivia Grigolli und Robert Hunger-Bühler gestalten ihre hilflosen Annäherungsversuche zu einem hoffnungslosen Stolpertanz am Abgrund.
Dort unten sitzt das Orchester "Opera Nova", eingekleidet wie das Bistro-Servicepersonal, und spendet unter der Leitung des Komponisten kaum wirklichen Trost. Es fällt den Sprechenden ins Wort, so bruchstückhaft wie das Gesprochene selbst, atemlos, gehetzt, fiebrig. Eher Geräusch als Klang. Die Partitur und das Libretto erzählen nicht die Geschichte, sie verdichten mehr die Atmosphäre in immer neuen Schichten. Beat Furrer hat den Part der Anne verdreifacht, im gleichen beigen Regenmantel, mit der gleichen wasserstoffblonden Perücke wie Olivia Grigolli kommen auch die Sopranistin Alexandra von der Weth und die Flötistin Maria Goldschmidt daher und lassen, ohne dabei ins plump Parodistische abzudriften, einen Hauch von ikonenhafter Monroe-Verlorenheit durch die Halle wehen (Kostüme Annabelle Witt). Sopranistin und Flötistin treten in einen hinreißend virtuosen Klangdialog gehauchter, explodierender, zerfetzter Ton- und Wortsplitter.
Säuseln, Sirren, Schnauben, Stottern
Eine weitere Ebene eröffnet Furrer durch den Einbezug von Texten, die die Überhöhung ins Mythische unterstreichen. Ein spanisches Gedicht aus dem 16. Jahrhundert und ein chorisches Lied von Cesare Pavese treiben die Unbedingtheit der Liebe über jeden Tod hinaus. Und den unendlich selbstvergessenen, ergreifenden Schlussakzent setzt Alexandra von der Weth mit den Verschmelzungsversen des spanischen Mystikers Juan de la Cruz: "Ich habe von meinem Geliebten getrunken..." Den dramaturgischen Höhepunkt aber bildet das zweitletzte Bild, wo das bewegliche und nach allen Seiten offene Haus der Fama, der Göttin des Gerüchts aus Ovids "Metamorphosen", zum Ort des rituellen Festes wird. Hier hebt der Chor zum orphischen Hymnus auf den trinkfreudigen Gott Dionysos an, zu jener Anrufung (Invocation), der die Oper ihren Namen verdankt. Das orgiastische Verschlingen und – im Roman – Erbrechen des Opfer-Salms wird zur symbolischen Entäußerung Annes gegenüber ihrer gesellschaftlichen Herkunft.
Eine Hauptrolle spielt aber auch der hervorragend geführte Chor, das Vokalensemble Zürich, unter der Leitung von Peter Siegwart. Was hier den Sängerinnen und Sängern abverlangt wird an nuancenreichen Klängen und hochkomplexen Rachen- und Gaumenlauten, einschließlich Säuseln, Sirren, Zischen, Zirpen, Schnauben, Hauchen, Stottern, raubt auch dem Zuhörer den Atem. In seinen pastellfarbenen Kostümen und mit den gedrechselten Frisuren wirkt der Chor wie eine Referenz an die fünfziger Jahre, in denen Marguerite Duras Roman entstanden ist. "Moderato bedeutet gemäßigt und cantabile bedeutet singend, das ist leicht", erklärt dort Anne nach der Klavierstunde ihrem eher lustlosen Söhnchen. "Du könntest dir das ein für allemal merken."
Christoph Marthaler (Ko-Regie Annette Kuss) hat es sich nicht leicht gemacht. Seine Inszenierung verzichtet auf alles Auftrumpfende und stellt sich ganz in den Dienst der Verdichtung des Atmosphärischen. Sitzen, stehen, gehen, straucheln. Sonst kaum eine Aktion. Einmal zerschmettert Robert Hunger-Bühler eine Geige. Im Ganzen aber mehr Implosion als Explosion. Wie in der Partitur von Beat Furrer, die nur wenige, dafür aber sehr heftige Ausbrüche aufweist.
Ein besonders sinniges, unaufdringliches Bild: Hin und wieder führen die Choristen ihre Stimmgabeln an die Nase. Ja, diese Stimmung kann man auch riechen! Dem Musikalischen den Vortritt zu lassen, wo Worte nur noch wenig ausrichten könnten, das allerdings ist Christoph Marthaler noch nie schwer gefallen. Schade nur, dass das alles – durch seinen freiwilligen und vorzeitigen Rücktritt von seiner Zürcher Intendanz – in einem Jahr schon wieder vorbei sein soll.
|
Die Tageszeitung
9. 7. 2003
Zerstörte Oberflächen
Ein Räderwerk, das beständig ins Nichts läuft: Der Komponist Beat Furrer und Christoph Marthaler entfalten in Zürich an einem Stoff von Marguerite Duras ihre ganze Kunst der Demontage
von BJÖRN GOTTSTEIN
Ordentlich missraten ist Annes Versuch, ihrem kleinkarierten Leben zu entkommen: Sie hatte sich mit ihrem Geliebten getroffen, was wie immer unter ins Nichts laufenden Fragen verebbte. Jetzt torkelt Anne Desbaresdes, die Gattin eines Fabrikanten, angeschlagen über die weite Bühne der Oper in Zürich. Wenn sie sich schließlich auf einer Parkbank niederlässt, um ihren Rausch auszuschlafen, beginnen zwei Doppelgängerinnen - alle drei tragen hellen Trenchcoat und platinblondes Haar -, ihren Zustand zu reflektieren. Der Sopran wühlt tief in der Psyche der Protagonistin und bedient sich dabei eines todtraurigen Liebesgedichts von Juan de la Cruz. Die Flötistin fasst Annes Verunsicherung in Musik, völlig unvermittelt und ohne die vermeintliche Fassbarkeit der Sprache, als musikalisches Substrat.
Die Szene bringt Beat Furrers Musiktheater auf den Punkt: die Sprache als so eindeutige wie missverständliche Oberfläche, der Gesang als psychologisierendes Moment unterhalb dieser Oberfläche, die Musik als von den Zeichenkonventionen befreite und gerade deshalb besonders wahrhaftige Essenz der Situation.
Für die Musik greift Furrer, Jahrgang 1954, ganz bestimmte Gesten auf: das Ohr auf den Schreibtisch legen. Den Veränderungen des kreiselnden Rauschklangs nachhorchen. Oder: einen Ton auf der Geige spielen. Den Bogen langsam zum Steg führen. Den Ton zum Geräuschklang modulieren. Das sind musikalische Gesten, die einer alltäglichen Handbewegung gleichen. Für sich genommen erzählen diese Gesten nichts. Wo sie aber in einen szenisch-dramatischen Zusammenhang gesetzt werden, entfalten sie ihr narratives Potenzial.
Seine jüngste Oper, "Invocation", die am Sonntag unter der Regie von Christoph Marthaler in Zürich uraufgeführt wurde, lehnt sich an den Roman "Moderato cantabile" von Marguerite Duras an. Da sowohl Furrer als auch Marthaler derzeit zu den wichtigsten Vertretern ihres Fachs gehören, wurden an diese Premiere hohe Erwartungen geknüpft. Die eigentliche Geschichte wird freilich, es gehört zum guten Ton des zeitgenössischen Musiktheaters, nicht erzählt. Stattdessen wird die Situation einer desorientierten Frau, die als Zeugin eines Mordes aus dem Gleichgewicht gerät, aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Furrer hat das Libretto mit Texten von Cesare Pavese, Juan de la Cruz und Ovid angereichert.
Man hat es also mit einem Bilderbogen zu tun. Die Diskontinuität der Narrative wird noch dadurch unterstrichen, dass Furrer einzelne, in sich geschlossene Nummern komponiert: gesprochene Dialoge, Stücke für Sopran und Flöte, Szenen für Chor und Streichquartett. Nur das vorletzte Bild, die komponierte Katastrophe, die zur endgültigen Isolation der Hauptfigur führt, bringt die vielen Fäden der Oper zusammen: der Chor in seiner kalten Maske, die Protagonistin in ihrem haltlosen Ekel, das Ensemble mit seinem stotternden Furioso.
Nun können die vielen weltliterarischen Anleihen den melodramatischen Zug der Vorlage nicht verwischen. Die Geschichte einer Frau, die ihr "moderato" geführtes Leben als hohl entlarvt, wird durch den Verweis auf den Dualismus apollinisch-dionysisch nicht zur Tragödie. Die schwermütige Sentimentalität der Szenen lähmt den Ausdruck. Diesem Dilemma muss sich letztlich auch Marthalers Regie beugen.
Er kann die bürgerliche Tristesse, die sparsam mit den Pastellfarben der Fünfzigerjahre angedeutet wird, nur durch wenige, allerdings großartig gesetzte Pointen durchbrechen: im gruselig-seligen Lächeln erstarrter Gesellschaftsbilder zum Beispiel. Im theatralisch aufgeladenen Gebaren des Chors, der ständig mit den ihn normierenden Stimmgabeln fuchtelt. Oder in einer Kostümfacette: Die Musiker spielen in Kellnerkluft samt Schürze, und sie spielen sich damit an die kulinarische Rolle, die der Musik bis ins 19. Jahrhundert hinein zugewiesen wurde.
Die Oper gewährt Marthaler nicht die Freiheiten, die er sich als Theaterregisseur nehmen kann. Eine Partitur ist ein Korsett: Sie legt den Regisseur auf Klang und zeitliche Gestaltung fest. Trotzdem ist Marthaler der üblichen Musiktheaterregie meilenweit voraus. Er lenkt die Figuren und den Blick des Publikums mit weicher Eleganz und verzichtet auf die zähweilige und bedeutungssüchtige Robert-Wilson-Behäbigkeit, an die man sich beim zeitgenössischen Musiktheater hat gewöhnen müssen.
Furrer und Marthaler ergänzen sich in ihrem ersten gemeinsamen Projekt also nicht schlecht. Die Begründung, warum sie gerade diesen Stoff gewählt haben, bleiben sie allerdings schuldig. Das ist Beat Furrer schwerer anzulasten als Christoph Marthaler, der über das Stück als Regisseur ja nur in zweiter Instanz waltet.
Trotzdem hat man die Reise nach Zürich nicht bereut. Und zwar einfach, weil Furrer zu den größten Komponisten der Gegenwart gehört. Der dichte, von Stammeln und Zischen durchwobene Chorklang, das flüchtig flirrende Ensemble mit seinem beständig ins Nichts laufenden figurativen Räderwerk, die gigantischen Flötenpassagen, die per Live-Elektronik räumlich aufgefächert werden, und die Sopranpartie, die ihren Gesang stets aus zerstörten Sprachgesten entwickelt und zu Gesangsausbrüchen führt - das sind große Momente, hinter denen die zeitgenössische Musik viel zu oft zurückbleibt.
|

9. 7. 2003
Du bist das Leben und der Tod
Christoph Marthaler und Annette Kuss inszenieren die Uraufführung von Beat Furrers "Invocation" in Zürich
Manchen Texten entströmt eine eigene, bisweilen unheimliche Musik. Mehr noch als der Plot, die Charaktere oder die Details bleiben beim Leser die Erinnerungen an diese Textmusik, an ihre Gesten, ihre Intensitäten, ihre Grundierungen, Farben und Tempi hängen. Denn erst diese Musik trägt die Erzählung, macht sie möglich, verleiht ihr Sinn.
So auch in dem von Marguerite Duras im Jahr 1958 publiziertem Kurzroman "Moderato cantabile", der eine gängige Vortragsbezeichnung für ins Sentimentale abgleitende (früh-)romantische Stücke im Titel trägt – eine Chiffre fürs unerfüllte Leben jener Frauen der Bourgeoisie, die nur Zierde sein durften für ihre im kapitalistischen Großkampf stehenden Fabrikbesitzer-, Ärzte- oder Juristenmänner.
Seit Madame Bovary ist das ein beliebtes Thema, einschließlich der damit verbundenen erotischen Eskapaden. Doch Marguerite Duras verwehrt ihrer Anne Desbaresdes die erotische Befreiung einer Lady Chatterley. Statt dessen gibt sie ihr die Musik der Unmöglichkeit mit, der Unmöglichkeit einer Liebe zwischen einer frustrierten Fabrikantengattin und einem (arbeitslosen?) Arbeiter. Eine Musik voll von jenem lastenden Magnolienduft, den der Text so gerne thematisiert, und der nur in den Tod führen kann – gesellschaftlich und/ oder körperlich.
Klänge aus der Höhe
Beat Furrer, Jahrgang 1954 und seit seinem Studium in Wien ansässiger Schweizer Komponist, sieht aus wie ein Strich. Hager, kantig, karg; er hat rote Haare; er gleicht einer Hochlandtanne, die aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz extreme Verhältnisse überstanden hat. Etwas von einer solchen Grenzerfahrung prägt seine Musik. Furrer nimmt das Treiben der Menschen unten im Tal nur aus der Ferne wahr, er empfängt nur die Kratzzeichen und Spuren der heftigsten und wichtigsten Signale. So ist er für Marguerite Duras’ Sprachmusik einfach taub. Sie ist nie bei ihm angekommen. Wohl aber die Geschichte, in der er einen Mythos entdeckt, eine jener Ovid’schen Verwandlungen, die es ihm auch schon in "Narzissus" (1994) und "Begehren" (2003) angetan hatten.
Weil Furrer nur die Spuren einer unmöglichen und deshalb todessüchtigen Liebe vernimmt, entgeht er der Du-ras’schen Musik, die das Abbild einer längst überholten Gesellschaft ist. Furrer gibt der Erzählung seine eigene Musik bei, die in ihrer herben Körnigkeit, in ihren Grenztänzereien an den Abgründen des Schweigens sowie des Zerbrechens dem Ursprünglichen und Existenziellen dieses Textes näher kommt als die Duras’sche Sprache.
Wie Duras im Roman gliedert auch Furrer sein Stück in acht Szenen. Jede Szene kann allein für sich stehen, jede vertritt musikalisch einen eigenen Charakter. Doch nur die Nummern Eins, Fünf und Acht nehmen explizit Bezug auf die Vorlage.
Bei der Uraufführung im Züricher Schiffbau sprach Olivia Grigolli diese Melodramen, die verknappt den Roman in Fragmenten referieren, karg, von Abbrüchen und Verschweigungen gepeinigt – ein Abbild von Furrers Musik. Ansonsten ersetzt der Komponist die Handlungskerne der Nummern durch Lyrikvertonungen. In drei Duos für Sopran und Flöte wird Spanisches aus dem 16. Jahrhundert interpretiert. Der zwölfstimmige Chor setzt Cesare Pavese, Ovid und eine orphische Hymne dagegen. Während sich die beiden duettierenden Frauen – die Sopranistin Alexandra von der Weth und die Flötistin Maria Goldschmidt – immer weiter in ihren Schmerz zurückziehen, artifiziell die Linien zerstückeln und ins Zentrum der Töne ein-dringen, übt das Vokalensemble Zürich die Entgrenzung: noch streng gebunden und nur vom Streichquartett begleitet im Pavese-Stück, dessen berühmtes "Tu sei la vita e la morte/Du bist das Leben und der Tod" das Thema aufreißt; in der Ovid-Episode, in der von der Fama die Rede ist, werden dann Haltetöne gegen aufgeregte Einzelklänge gesetzt; in der orphischen Ode schließlich, die Dionysos feiert, kommt es zu lustschreiartigen Entgrenzungen; sie sind der Höhepunkt des Abends.
Doch Furrer, der Purist, trennt das Dionysische fein säuberlich vom Apollinischen und lässt im Epilog, der in Ent-sprechung zum Anfang den Hörer zau-dernd und stockend entlässt, Sopranis-tin und Flötistin mit Juan de la Cruz antworten: mit einem Vers des Mystikers, der jede Liebeserfahrung mit dem Ausschluss aus der Gesellschaft gleichsetzt. Die Spaltung in das Kollektiv auf der einen und das vereinsamte Individuum auf der anderen Seite ist hier in drastischer Ausschließlichkeit vollzogen und lässt sich als Bild für die Situation des Künstlers in der Welt lesen.
Endlose Promenade
Beat Furrer, der bei der Uraufführung das Ensemble Opera Nova unspektakulär eindringlich dirigierte, hatte sich vor der Premiere dazu entschlossen, das eineinhalbstündige Stück nicht "Moderato cantabile" zu nennen, sondern "Invocation". Anrufung, Beschwörung – das signalisiert die Entfernung zum Text von Marguerite Duras, das umschreibt die Überführung der bürgerlichen Erzählung in einen via Musik vermittelten antiken Mythos.
Christoph Marthaler und Annette Kuss, das Regieteam, verließen sich bei dieser Coproduktion von Zürcher Oper und Zürcher Schauspielhaus für die lokalen Festspiele allerdings eher auf Marguerite Duras. Schon mit dem Raum stellten sie sich eine Falle. Schier unabsehbar lang erstreckt sich die Uferpromenade, an deren beiden Enden Duras ihre Story ansiedelt, durch die Halle des "Schiffbaus". So gerät Furrers Musiktheater, das regelmäßig die Perspektive wechselt zwischen Öffentlichkeit und Intimem, in eine auf Dauer anstrengende Eindimensionalität.
Sparsam in den Bewegungen ziehen Chor und Solisten über den Riesensteg und markieren fragmentarisch den Hergang der – rein vom Plot her gesehen – belanglosen Geschichte. Wer da den Roman nicht parat hat, versteht vermutlich wenig. Andererseits werden durch dieses Schielen nach Duras die ganz anders gearteten Absichten kaum deutlich, sie verlieren sich hier in der Unendlichkeit des Raumes. Die Geschichte von Befreiung und Vereinsamung jedenfalls verläppert in einer hübsch anzuschauenden Belie-bigkeit, ganz im Gegensatz zu der so eigenartigen wie eigenwilligen Musik.
REINHARD J. BREMBECK
|
Offenbach-Post
9. 7. 2003
Musiktheater der leisen Töne
Beat Furrers neue Oper "invocation" bei der Uraufführung in Zürich umjubelt
Anne, Frau eines reichen Fabrikanten, ist mit ihrem Sohn bei einer Klavierlehrerin in irgendeiner Stadt am Meer. Das Pianospiel des Kindes wird plötzlich von einem Schrei auf der Straße unterbrochen. In einer Kneipe hat ein Mann seine Geliebte erschossen. Anne wird von dem Ort des Verbrechens magisch angezogen. Der Schrei lässt sie nicht mehr los. Fast täglich kehrt sie in das Lokal zurück, wo sie immer wieder mit einem Unbekannten über den Mord aus Leidenschaft spricht. Sie spürt das strenge Korsett ihres bürgerlichen Lebens und sehnt sich nach echten Gefühlen.
Diese fragmentarische Erzählung von Marguerite Duras hat den Schweizer Komponisten Beat Furrer zu seiner Oper "invocation" (deutsch etwa: Anrufung) inspiriert. Das Musiktheater in acht Bildern wurde in Zürich in der Schiffbauhalle uraufgeführt und vom Publikum bejubelt. Es ist die dritte Oper des in Österreich lebenden Musikers nach "Narcissus" (1994) und "Begehren" (2003). Zum Werk des Professors an der Musikhochschule Graz gehören außerdem die Kammeroper "Die Blinden" sowie Kammermusik.
Furrer geht es um die Einheit von Text und Musik. Dabei erzählt er keine Geschichte, sondern überträgt Worte in Musik, die zugleich Atmosphäre beschreibt und Raum für Assoziationen bietet. Die Titelfigur Anne erscheint in dreifacher Verkörperung mit platinblonder Perücke und Trenchcoat: als Sopranistin (Alexandra von der Weth), als Schauspielerin (Olivia Grigolli) und als Flötistin (Maria Goldschmidt). Dabei dient dem 1954 in Schaffhausen geborenen Komponisten die Flöte als "Scharnier" zwischen Sängerin und Schauspielerin, die manchmal nur einzelne Worte oder Satzfetzen herausbringen.
Die Musik, vom Ensemble "Opera Nova" des Orchesters der Oper Zürich meisterhaft gespielt, ist leise und zerbrechlich. Begleitet werden die Solisten vom Vokalensemble Zürich, das manchmal nur flüstert und seufzt. Das Publikum spendete den sechs Frauen und sechs Männern im 50er-Jahre-Look - die Damen in pastellfarbenen Cocktail-Kleidern und mit Hochfrisur - besonders herzlichen Beifall.
Regie in dieser ersten KoProduktion zwischen Zürcher Oper und Schauspielhaus führt Schauspielhaus-Intendant Christoph Marthaler. In dem als "Meister der Langsamkeit" bekannten Star-Regisseur hat Furrer einen idealen Partner gefunden. Seine Inszenierung ist sparsam und ordnet sich der Musik unter. Die Titelheldin agiert "moderato". Anne als Schauspielerin verzichtet aber nicht auf die Marthaler-typischen akrobatischen Verrenkungen, wenn sie sich, vom Wein berauscht, zitternd und zappelnd aus der Starre ihres langweiligen Lebens zu befreien sucht.
G. MACKENSEN
|
INTERVIEW

2. 7. 2003
«Keinen Konventionen gefolgt»
Die Oper «Invocation», ein Auftragswerk von Opernhaus und Schauspielhaus Zürich, kommt am Sonntag in Regie von Christoph Marthaler zur Uraufführung. Der Komponist Beat Furrer erzählt von der Arbeit an Sprechen und Singen.
Herr Furrer, worum geht es in Ihrer neuen Oper mit dem Titel «Invocation»?
Beat Furrer: Meine Komposition geht von Marguerite Duras’ Roman «Moderato cantabile» aus (siehe Kasten). Ich war auf der Suche nach einem Klang, einer konzeptuellen Form - und fand sie in der Anlage dieser Erzählung, in der Gleichzeitigkeit, Wiederholung, Variation und die Konfrontation einer geordneten Welt mit einer Welt des Rausches zentrale Momente sind. Die Geschichte wird nicht von einem Punkt zum anderen erzählt, sondern scheint in der Erinnerung an eine andere um sich zu kreisen. Die Klavierstunde steht für die geordnete Welt, während der Schrei die Grenzen dieser Welt überschreitet.
Warum haben Sie im Laufe der letzten Arbeiten den Werktitel von «Moderato cantabile» zu «Invocation» geändert?
Furrer: «Moderato cantabile» ist ein wunderbarer Titel für eine Erzählung, aber musikalisch sehr belastet. In Duras’ Geschichte ist das eine Ausdrucksbezeichnung aus der Diabelli-Sonatine, die ein Kind in seiner Klavierstunde immer wieder spielen muss. Die Bezeichnung wird heute eigentlich nicht mehr verwendet, sie steht für die Hausmusik einer speziellen Schicht. Der neue Titel «Invocation» liegt in Szene 7 der Oper begründet, einem orphischen Hymnus an Dionysos, in der die Protagonistin Anne an einem Festessen, einer Art Opfermahl, betrunken erscheint und im Rausch die Grenzen ihrer Realität überschreitet.
Libretto und Übersetzung des Textes stammen von Ihnen und der Autorin Ilma Rakusa - wie verlief Ihre Zusammenarbeit?
Furrer: Ilma Rakusa hat sich als Übersetzerin und Publizistin intensiv mit Duras auseinander gesetzt. Sie ist aber keine Librettistin - den Beruf gibt es ja heute nicht mehr -, sondern Schriftstellerin. Ich kann aber nicht einen fertigen Text «vertonen»; es entspricht mir mehr, mit etwas Fragmentarischem zu arbeiten. Doch auch Autoren komponieren: in dem Sinne, als sie rhythmisieren, Sprache schöpfen. Ein Komponist greift mit seiner Musik immer in ihre Komposition ein. Mir persönlich ist die Suche nach einem Vokalklang wichtig. Das Endprodukt wird aber ein Gemeinschaftswerk von Ilma Rakusa, mir und Christoph Marthaler sein - er geht ja auch nicht von einem fertigen Text aus, sondern schafft seine Bilder aus Situationen und Klängen heraus.
Wie verhält sich Ihr Stück zur Textvorlage von Duras?
Furrer: Es gibt acht Szenen, so viel wie bei Duras Kapitel. Bei mir gibt es auch die Klavierstunden, aber kein Kind als solches, sondern nur als Kind in Anne, die übrigens durch eine Schauspielerin, eine Sängerin und eine Flöte dargestellt wird. Dies, um die Intimität darzustellen, die wir aus unserem organisierten Leben verdrängen - die aber in bestimmten Momenten zum Vorschein kommt und unserer Individualität entgegengesetzt ist. Wichtig war dabei der perspektivische Blick auf eine Figur. Das Kind ist die Kraft in der Frau; es ist viel näher an der «anderen Welt», der noch nicht zivilisierten Welt.
Welche Funktionen haben die Textzitate von Ovid und Cesare Pavese in Ihrem Stück?
Furrer: Die Erzählung über die Fama in Ovids «Metamorphosen» bildet eine Insel im Ganzen. In Famas Haus kommen die Klänge der Welt zusammen. Fama gibt allen Äusserungen der Kreaturen einen Raum, einen Widerhall, eine Fortsetzung. Dieses Haus ist ein Grundort, ein Topos. Die Themen, die bei Pavese immer wieder aufgegriffen werden, sind Eros und Tod. Sein Text erlaubte aber leichtfüssigere musikalische Teile: ein Madrigal, ein Streichquartett, vier Stimmen.
Gibt es zentrale Themen in Ihrer Oper? Figuriert beispielsweise die Diabelli-Sonatine aus der Klavierstunde als Zitat?
Furrer: Nein; die Frau, die auf dem Klavier ein paar Töne greift, spielt etwas Fragmentarisches von Gesualdo. Ein anderes zentrales musikalisches Thema ist der Schrei. Doch niemand schreit da auf der Bühne. Ein Schrei kann formal unter verschiedenen Aspekten dargestellt werden: als etwas, das einen Umschlag in eine andere Klangqualität bedeutet, ein Sog in eine Richtung oder ein hoher gesungener Ton, der Pianissimo einsetzt und jeden Moment abbrechen könnte - und so eine Intimität spürbar macht von dem Körper, der singt. Eine gesungene Belcanto-Linie könnte solche Schreie nicht wahrnehmbar machen, da er ein historisch beladenes Gebilde ist.
Kann man aber Intimität immer wieder reproduzieren?
Furrer: Bei dem hohen Pianissimo-Klang ist immer ein Risiko spürbar. Die Opernsängerin Maria Callas faszinierte, weil sie diese Gefährdung physisch spürbar und nachvollziehbar machte. Da werden Unsauberkeiten in der Intonation in Kauf genommen; sie sind Ausdrucksmittel. Aber verdinglichte Intimität ist keine Intimität mehr; dann ist sie nur noch Masche. Pop-Sänger spielen damit, das ist die erotische Kraft, die viele von ihnen vermitteln wollen. Mich persönlich bewegt die Stimme der Flamencosängerin Estrella Morente: Ihre Stimme ist von einer Fragilität und gleichzeitig einer unglaublichen Kraft. Das war genau, was ich hier suchte.
Das leistet auch der «Sprechgesang», das prägnante Stilmittel der Wiener Schule, nicht; er ist ein zu enges stilistisches Korsett geworden. Es gibt nichts Schlimmeres, als Konventionen zu folgen, nur weil Oper eine Form ist, die Konventionen erfordert. Mich interessiert der Weg vom Sprechen - und vielleicht habe ich hier etwas Neues gefunden.
Ihre Oper ist sehr vielschichtig und nicht das, was man «narratives Musiktheater» nennt. Welche Struktur - wenn nicht die Handlung - trägt in dem Werk?
Furrer: Narrativ ist das Stück nur insofern nicht, als es nicht eine Geschichte von A bis hin zur Katastrophe erzählt. Aber es geht immer ums Erzählen; ich wehre mich gegen das Vorurteil, dass wir im modernen Musiktheater nicht mehr die Erzählung suchen. Wir suchen die Möglichkeiten, wieder zu erzählen, aber in neuen Strukturen und Formen. Insofern ist auch diese Oper narrativ. Das Konzept von «Invocation» ist eine Vorstellung, die ich in der Instrumentalmusik ausgebildet habe: dass im Prinzip schon am Anfang alles anwesend ist und schon geschehen ist. Darum immer wieder der Rekurs aufs Erinnern - das ist ja auch eine Form des Erzählens.
Auch die Wiederholung interessiert mich sehr, in verschiedenen expressiven Ausprägungen: eine Wiederholung kann etwas Mechanisches, Totes, etwas Insistierendes, Buchstabierendes oder Stotterndes haben. Eine Wiederholung kann Konturen und Strukturen erzeugen, die immer wieder anders gefiltert werden können, in Klangfenstern, in denen die Zeit angehalten wird und die Musik sich räumlich und perspektivisch auffächert.
Ist Ihre Komposition eine Oper, ein Musiktheater - oder welche wäre Ihrer Meinung nach die richtige Bezeichnung?
Furrer: Die Definition interessiert mich nicht. Für mich ist Oper alles, was als Medium verschiedene Medien vereinigt: ein Klang, der mit einem Bewegungsablauf, mit Text in Verbindung gebracht wird, ein Spiel mit Semantik. Wenn ein gesprochener Text über einen Klang montiert wird, nimmt der sofort Besitz vom Klang. Das versuche ich zu vermeiden - nicht, indem ich Sinn vermeide, sondern indem ich das Spiel von Semantik und Klang in der Schwebe halte.
Wie war die Zusammenarbeit mit Christoph Marthaler?
Furrer: Er war immer viel unterwegs, seine Zeit begrenzt, wie auch meine. In Gesprächen versuchte ich ihm zu beschreiben, was da klanglich stattfindet. Er ist ja sehr musikalisch und kann fasziniert sein von einem Klang. Was ich bis jetzt gesehen habe, hat mir sehr gefallen, doch es unterscheidet sich sehr von den abstrakten Räumen, die ich mir während des Komponierens vorgestellt habe. Aber das ist ja gerade das Spannende: in der Zusammenarbeit eröffnen sich ganz andere, neue Dimensionen.
Interview: Bettina Spoerri
Beat Furrer:
«Es ist ein Vorurteil, dass das moderne Musiktheater nicht mehr erzählt.»
«Moderato Cantabile»
Der Roman «Moderato Cantabile» von Marguerite Duras, der 1960 von Peter Brook mit Jeanne Moreau und Jean-Paul Belmondo verfilmt wurde, erzählt folgende «Geschichte»: In einer Stadt am Meer sitzt Anne mit ihrem Jungen bei einer Klavierlehrerin, als sie plötzlich einen Schrei auf der Strasse hören. Vor einem Café hat ein Mann seine Frau erschossen. Anne betritt das Café und kehrt wiederholt zurück; sie unterhält sich, in kurzen Sätzen, mit einem Unbekannten über den Mord. Langsam zerfliessen die Grenzen zwischen dem fremden und ihrem eigenen Schicksal: In ihrer Beziehung zum unbekannten Mann droht sich das Verhältnis der Ermordeten zu ihrem Mörder zu wiederholen. (bsp)
Beat Furrer wurde 1954 in Schaffhausen geboren. 1975 zog er nach Wien, wo er Komposition bei Roman Haubenstock-Ramati und Dirigieren bei Othmar Suitner studierte. Hier gründete er auch das Klangforum Wien. Nach kammermusikalischen Werken folgte 1989 das erste Werk für Musiktheater: «Die Blinden», später «Narcissus» (1994) und «Begehren» (2003). Seit 1991 ist Beat Furrer Professor für Komposition an der Musikhochschule Graz. «Invocation» ist ein Auftragswerk des Zürcher Opernhauses; im Gespräch für Gastspiele sind u. a. die Berliner und Wiener Festwochen. Eine Auswahl neuerer Aufnahmen von Werken: «Narcissus» (Mgb, 1997), «Die Blinden» (Mgb, 1999; Pan, 2000), «Nuun» (Klangforum Wien; Kairos, 2000), «Stimmen» (Kairos, 2001), «Aria» (Kairos, 2002). (bsp)
|


