|
Aufführung
|

7. 12. 2002
(Première)
*
Musikalische Leitung: Marcello Viotti
Inszenierung: Gian-Carlo del Monaco / Grischa Asagaroff
Bühnenbild: Mark Väisänen
Kostüme: Maria-Luise Walek
Lichtgestaltung: Hans-Rudolf Kunz
Chor: Jürg Hämmerli
Elisabetta: Carmen Oprisanu
Maria Stuarda: Angeles Blancas
Leicester: Fabio Sartori
Talbot: László Polgár
Cecil: Carlos Chausson
Anna Kennedy: Melinda Parsons
Chor des Opernhauses Zürich
Statistenverein am Opernhaus Zürich
Orchester der Oper Zürich
|
|
Rezensionen
|
|

9 .12. 2002
Lauter Gefangene
Donizettis «Maria Stuarda» im Zürcher Opernhaus
Die Aufführungsgeschichte von Gaetano Donizettis «Maria Stuarda» hat schlecht begonnen: Kurz vor der Premiere in Neapel wurde das Königinnendrama von der Zensur verboten. Ein neues Libretto mit neuer, in der italienischen Renaissance angesiedelter Handlung musste verfasst und die Musik auf dieses übertragen werden. Und als dann die ursprüngliche Stuart-Oper in einer dritten Fassung 1835 in Mailand zur Uraufführung kam, war die grosse Malibran, die die Titelpartie sang, indisponiert. Dennoch hat sich das Werk schliesslich durchgesetzt und - mit Unterbrechungen - bis heute im Repertoire gehalten.
Auch die Zürcher Neuinszenierung ist zustande gekommen, obwohl die Probenzeit unter einem schlechten Stern stand (NZZ 28. 11. 02): Der Regisseur Gian-Carlo del Monaco fiel aus, weil er sich einer Operation unterziehen musste, kurz darauf erfolgte die Absage von Edita Gruberova, auf die nicht nur «Maria Stuarda», sondern der ganze, 1996/97 mit «Roberto Devereux» begonnene und 1999/2000 mit «Anna Bolena» fortgeführte Zyklus von Donizettis Tudor-Opern ausgerichtet war. Risiko des Starbetriebs, dem das Opernhaus seine Attraktivität und sein gutes wirtschaftliches Betriebsergebnis zu grossen Teilen verdankt.
Grischa Asagaroff, der sich bereit fand, del Monacos Konzept zu realisieren, hat keine dankbare Aufgabe übernommen. Vorgegeben war Mark Väisänens Bühne, jener düstere, kerkerartige Einheitsraum, der die Königinnen in allen drei Stücken als Gefangene ihres Herrscheramtes erscheinen lässt und den Darstellerinnen und Darstellern wenig Aktionsraum bietet, obwohl der Chor in Wandnischen placiert ist und nur sängerisch, mit klanglich differenzierten Kommentaren, in das Geschehen eingreift. Die Schauplätze werden lediglich durch wechselnde Versatzstücke charakterisiert: durch den mächtigen Thron Elisabeths, das Bett, auf dem sie Marias Todesurteil unterzeichnet, ein Gitter und ein blühendes Mohnfeld im Park von Schloss Fotheringhay, wo die zentrale Begegnung der schottischen und der englischen Königin stattfindet, Ketten, Kreuz und Richtblock in der Beicht- und Abschiedsszene Marias. Der Schwarz-Rot-Kontrast von Maria Luise Waleks historisierenden Kostümen und lodernde Flammen setzen dramatische Akzente, während die Spielführung selbst weitgehend statisch bleibt. Del Monacos Hang zu theatralischer Verdeutlichung schlägt auch diesmal durch und treibt in der Schlussszene eine absonderliche Blüte: Obwohl dieses Bild Maria gehört und sie, das Opfer, zur moralischen Siegerin macht, lässt die Regie hier auch Elisabeth auftreten, als stumme, starre Zuschauerin auf dem Thron.
Doch mit dem Anspruch auf ambitioniertes Musiktheater wird man dieser Produktion nicht gerecht, hier ist Oper als Manifestation virtuoser Gesangskunst angesagt, wenn auch ohne Primadonna. Die junge spanische Sopranistin Ángeles Blancas, die nach Edita Gruberovas Absage kurzfristig für die Titelrolle verpflichtet wurde, hat das Premierenpublikum mit ihrem kultivierten Gesang und ihrer subtilen Darstellung zusehends für sich gewonnen. Ihre Stimme ist hell und schlank, im Timbre etwas kühl, in der Ausdrucksskala noch beschränkt; ihre weit gespannten Legato-Kantilenen bezaubern bei aller Kunstfertigkeit durch frische Natürlichkeit. Und als Figur steht Ángeles Blancas' zarte, majestätische Maria in spannungsvollem Kontrast zu Carmen Oprisanus leidenschaftlich impulsiver Elisabetta. Warm und glanzvoll klingt deren Mezzosopran, doch in den deklamatorisch bewegten Passagen oft auch etwas flackrig, und die Linienführung wünschte man sich klarer, präziser.
Doch musikalische Präzision ist generell nicht das Kennzeichen dieser Aufführung. Marcello Viotti erweist sich zwar wiederum als feinhöriger und agiler Begleiter, gibt aber dem Orchester wenig Entfaltungsraum, so dass sich immer wieder Konzentrationsmängel bemerkbar machen. Wenig zu sagen haben in dieser Oper die Männer. Roberto Leicester, der Mann zwischen den zwei um ihn und um die Macht rivalisierenden Königinnen, der mit seinem Eintreten für Maria das Todesurteil der eifersüchtigen Elisabeth recht eigentlich provoziert, ergeht sich in leeren Versprechungen, die Fabio Sartori allerdings mit üppigem tenoralem Schmelz ausstattet. László Polgár plädiert als Talbot mit seinem edlen Bass beredt für Gnade, während Carlos Chausson als Cecil beharrlich Marias Hinrichtung verlangt. - Zu frenetischem Jubel wie nach «Roberto Devereux» und «Anna Bolena» ist es bei dieser Premiere nicht gekommen. Lag es allein am Fehlen Edita Gruberovas und an der allzu schematischen Aufführung? Oder ist vielleicht auch das Gefälle zwischen Schillers Drama und Donizettis konventionell gebauter Opernversion zu gross?
|

9. 12. 2002
Welche ist die wahre Königin?
Eine Frage beschäftigte die Opernfans am Samstag bei der Zürcher Neuinszenierung von Donizettis « Maria Stuarda» vor allem: Wie fimnktioniert das Stück ohne den Star? Es funktioniert durchaus.
Von Thomas Meyer
Ein Stein schien ihr vom Herzen zu fallen, als sie schliesslich als Letzte allein vors kräftig applaudierende Publikum trat. Die Anspannung muss gross gewesen sein für die junge spanische Sopranistin AngeIes Blancas. Immerhin war sie für eine Edita Gruberova eingesprungen, die das neu inszenierte Werk ursprünglich prägen sollte und die am Samstag in einer Mitteilung ihre Absicht bekräftigte, nie merh in Zürich aufzutreten. Nicht wenige im Publikum werden den »Ersatz« deshalb doppelt kritisch angehört haben. Der Applaus rauschte zwar nicht wirklich auf (das tat er überhaupt nie an diesem Abend), war aber weitaus mehr als wohlwollend und für Angeles Blancas am stärksten. Von dieser Sängerin wird man noch mehr hören wollen - und durchaus nicht nur von Gaetano Donizetti, sondern auch von Verdi
Durch ihre Person gabs gewiss auch eine Umwertung des Stücks - nicht unbedingt zu dessen Ungunsten. Mit der Gruberova nämlich hätte man diese »Maria Stuarda« ohne Zweifel auf die Titelfigur zugeschnitten, was dem Abend den Glanz des Startums verliehen hätte. So jedoch wurde klarer auf ein Drama hin fokussiert, in dem verschiedene Personen Gewicht bekommen. Gaetano Donizettis lyrische Tragödie »Maria Stuarda« (nach Friedrich Schiller) aus dem Jahre 1835 ist keine reine Belcanto-Oper mehr, sondern weist bereits auf Verdi voraus. Sie zeigt heftige innere und äussere Konflikte.
Stärke in der Dramatik
Das eben wird deutlich in der Titelfigur und ihrer Darstellerin. Angeles Blancas ist keine Koloratursopranistin. Sie wartet nicht mit vielen Fiorituren und Spitzentönchen auf und gerät gar nicht in Versuchung, solche Kunststücke auf Brillanz hin zu forcieren. Ihre Stärke liegt im Dramatischen, und mit ihrem noch fast jugendlich schlanken Sopran entwickelt sie ein starkes und ernsthaftes Ausdrucksvermögen. Das überzeugt, gerade etwa wenn sie sich in der direkten Konfrontation mit ihrer Konkurrentin Eisabetta von der sich demütig gebenden zur beschimpfenden Frau wandelt oder wenn sie im Gefängnis voller Stolz gegen ihre Rivalin grollt. Stimmlich wie darstellerisch dominiert sie gegenüber der verhalteneren Elisabetta von Carmen Oprisanu, die hier ihre erste grosse Rolle in einer Zürcher Neuinszenierung singt. Ihre Rolle ist auch weitaus diffiziler. Nach ein paar Anfangsschwierigkeiten fühlt sie sich differenziert in die gebrochene Figur hinein, sie weiss sich aber noch nicht voll zu steigern. Vokal hingegen der Hahn im Korb ist Graf Leicester, der von Elisabetta heimlich geliebt wird, sich aber zu Maria hingezogen fühlt. Fabio Sartori, erstmals in Zürich, ist ein für Donizetti genügend leichter Tenor mit einer Strahlkraft, die seine Unbeholfenheit wettmacht. Daneben sind besonders Carlos Chausson als dunkler Hardliner Cecil sowie László Polgár (blasser als gewohnt) als Maria-Vertrauter Talbot und schliesslich Melinda Parsons (vom Internationalen Opernstudio) in der Nebenrolle der Zofe Anna zu hören.
Eingebettet ist das in einen Orchesterklang, den Dirigent Marcello Viotti profiliert führt und dennoch auf die Sänger zuschneidet, das heisst, er unterstützt mii Agilität und leichtem Brio, forciert aber nicht. Dennoch möchte man einmal den Versuch erleben, dass sich ein Dirigent mit der frühen romantischen italienischen Oper so auseinander setzen möge, wie es`Nikolaus Harnoncourt oder John Eliot Gardiner mit deren Zeitgenossen Weber, Berlioz, Mendelssohn oder Schumann getan haben. Wahrscheinlich schlummern da noch weitere Tiefendimensionen.
Klang hinter Masken
Einzig der Chor wirkte etwas verloren an diesem Abend. Er fiel kaum auf und konnte sich selbst bei seinem grossen Einsatz zu Beginn des letzten Bilds nicht angemessen in Szene setzen. Die klangliche Geschlossenheit litt unter den anonymisierenden Masken, die man den Sängern verpasste, sowie an der statischen räumlichen Aufstellung rings ums Handlungsgeschehen. Der Chor wurde buchstäblich an den Rand gedrängt im Raum des Bühnenbildners Mark Väisänen, der hier jene Konzeption weiterverfolgt, die er bereits in den ersten beiden Teilen der Tudor-Trilogie (Donizettis »Roberto Devereux« und »Anna Bolena«) entwickelt hat.
Die Weite dieses Burginnenhofs erlaubt Bewegungsfreiheit und deutet doch auch die gefängnisartige Verbunkerung an; denn beide Königinnen sind eigentlich Gefangene. Für die Inszenierung ergibt sich hiermit ein Spielfeld, das die Darsteller kaum zu Unverständlichkeiten zwingt.
Konzipiert wurde die Regie von Gian Carlo del Monaco, der sich aber bei Probenbeginn einer schweren Operation unterzieher musste. So übernahm der Künstlerische Betriebsdirektor und Hausregisseur Grischa Asagaroff die Umsetzung. Er kennt das Werk, denn er hat »Maria Stuarda« bereits vor achtzehn Jahren in Zürich imzeniert.
Das Ganze wirkt vergleichsweise konventionell und tut den Melomanen gewiss nicht weh, setzt aber klare Farbakzente (Kostüme: Maria-Luise Walek) undd lässt den Sängern Platz zum Singen - zum Charakterisieren nutzen ihn vor allem die Frauen. Die Personenführung ist weitgehend zuverlässig gemacht, ohne Auffälligkeiten. Allerdings gelingt es Asagaroff nicht, die Personenkonstellation in der Schlussszene zu verdichten. Die letzten Minuten vor Marias Gang zum Schafott wirken noch unfertig uad kaum stringent. Und so konnte sich in diesem entscheidenden Moment auch Angeles Blancas nicht voll durchsetzen. Gut möglich, dass sie sich, nachdem die erste grosse Anstrengung hinter ihr liegt, noch freier entfaltet und ihre Stimme weiter an Flexibilität gewinnt. Dann könnte diese Maria Stuarda ihr gehören.
|
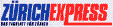
9. 12. 2002
Edita Gruberova sang nicht
Die Donizetti-Premiere «Maria Stuarda» im Opernhaus war eine Nervenprobe für die Beteiligten
Die Oper «Maria Stuarda» - nach Schillers klassischem Drama - hat Donizetti mit schönstem und reichstem Belcanto ausgestattet. So viel lyrischer Wohlklang in Arien, Duetten, Terzetten (musikalischer Höhepunkt ist das wunderschöne Sextett im 2. Akt), aber auch so viel Spannung (szenischer Höhepunkt wäre die Begegnung der Maria Stuart mit ihrer Rivalin Elisabeth I. von England) sind in knapp zweieinhalb Stunden Musiktheater selten zu erleben.
Die Spannung bei der neusten Produktion des Opernhauses fand vor allem vor der Premiere statt. Zunächst musste Regisseur Gian-Carlo del Monaco wegen einer schweren Operation absagen. Dann, bedeutend kurzfristiger, gab Edita Gruberova ihrem Stammhaus einen Korb und annullierte die Titelrolle. (In einem vor der Premiere aufliegenden Flugblatt informierte der Fanklub von Edita Gruberova über die Gründe von deren Absage. Demnach habe die Sopranistin ihre Mitwirkung bei «Maria Stuarda» «sowie allen künftigen Projekten am Opernhaus Zürich unwiderruflich abgesagt». In einem von ihr selbst unterzeichneten Text gibt die Sängerin als Grund gravierende Sicherheitsmängel im Theater an.)
Doch ausser einem schlechten Stern hatte die Premiere zwei Schutzengel. Grischa Asagaroff übernahm die Regie nach del Monacos Konzept. Es setzt die früheren Inszenierungen von Donizettis Trilogie, «Roberto Devereux» und «Anna Bolena», in gleichem Einheitsbühnenbild fort. Und die junge Spanierin Angeles Blancas ersetzte mutig die Belcanto-Königin Gruberova als Titelheldin. Der Premiere war die vorangegangene, hausinterne Zerreissprobe anzumerken. Etwa die relative Spannungslosigkeit der ersten zwei Akte. Besonders auffällig war dies bei der erwähnten Begegnung der beiden Königinnen. Sie wurde nicht zum sonst Üblichen, spannungsgeladenen Schlagabtausch zwischen zwei Rivalinnen respektive zwei Primadonnen. Angeles Blancas versuchte richtigerweise während keiner Sekunde, die Gruberova zu kopieren. Sie erarbeitete ihre eigenständige Rolle: eine forsche, jugendliche, stolze und etwas herbe Stuarda. Mit viel persönlichem Timbre in der Mittellage, aber spürbarer Nervosität in den Höhen rettete sie sich in den letzten Akt. Hier, im Angesicht des Schafotts, berührte die Sängerin dann stimmlich und darstellerisch stark und gewann schliesslich das begeisterte Publikum. Carmen Oprisanus Bild der Elisabeth geriet zunächst unerwartet mild. Mit ihrer schön geführten, warmen Mezzostimme wird sie nur einem Teil des Charakters der machtbewussten Regentin gerecht, und man wünschte sich mehr Facetten, hin zu auch harten, kalten Tönen. Mit glanzvollem, Raum füllendem Belcanto-Tenor, wenn auch im Ausdruck nicht sehr variierend und physisch ziemlich statisch, stand Fabio Sartori zwischen den Königinnen: Er war stimmlich das präsenteste Erlebnis.
Mit charaktervollem Bariton und Spiel war Carlos Chausson ein glaubhaft intriganter Lord Cecil. László Polgár mit gewohnt schön gesungenem, getragenem Bass gestaltete hingegen einen unkämpferischen, etwas hilflosen Lord Talbot. Die Premiere war gerettet. Das Potenzial an Stimmen und Darstellung ist vorhanden, damit alles besser werden wird, wenn sich die Aufregungen gelegt haben.
|

9. 12. 2002
Zwei Königinnen, zwei Primadonnen
Die Rivalität zweier Königinnen ist Thema von Donizettis «Maria Stuarda». Im Opernhaus gaben sich am Schluss vor dem Vorhang zwei junge Sängerinnen Küsschen und freuten sich gemeinsam über ihren Erfolg.
HERBERT BÜTTIKER
Das ist nicht selbstverständlich. In einer Probe vor der Uraufführung in Neapel, 1834, gerieten sich die beiden Darstellerinnen wirklich in die Haare. Allerdings war es dann die Zensur, die weitere Königinnenkämpfe auf der Bühne verhinderte. Die Oper konnte nur in einer Bearbeitung als «Buondelmonte» mit der Rivalität zweier florentinischer Damen aufgeführt werden. Ein Jahr später an der Scala gab es wieder Komplikationen in der Besetzung. Die Interpretin, die neben der berühmten Maria Malibran die Elisabetta hätte singen sollen, gab die Rolle zurück, die ihr mit nur einem Terzett im Schlussakt zu unvorteilhaft ausgestattet schien. Die Premiere musste verschoben werden.
Tatsächlich ist die Dramaturgie der «Maria Stuarda» speziell. Der erste Akt gehört mit einer grossen Auftrittsszene ganz der Königin Elisabeth, die sich so als Primadonna einführt. Im dritten dominiert dann aber, zumal mit der Finalszene, entschieden Maria, und im zweiten (in der Urfassung die zweite Hälfte des ersten) Aktes, in dem es zur berühmten – von Schiller bekanntlich erfundenen – Konfrontation der Königinnen kommt, hat Maria nicht nur ihren ersten, lyrisch breit angelegten Auftritt, sondern im dramatischen Dialog auch den moralischen Sieg der Erniedrigten, wenn sie ihrer Gegnerin ihre Abkunft aus einer für ungültig erklärten Ehe (Heinrichs VIII. und Anna Boleyns) vorwerfen und ein «Vil bastarda» entgegenschleudern kann. Zweifellos ist diese Szene, von Donizetti mit grandiosem Sinn für dramatische Wirkung komponiert, ein Höhepunkt des italienischen Musiktheaters, aber diese Oper ist auch insgesamt, in der strengen Konsequenz, mit der die musikalischen Nummern der dramaturgischen Logik folgen, wie in der Fülle starker Musik, ein Meisterwerk. Es fügt sich auch bestens in eine Donizetti-Reihe, die vom Opernhaus Zürich als Einheit betrachtet wird und, nachdem «Anna Bolena» und «Roberto Devereux» bereits im Repertoire sind, als «Tudor-Trilogie» auch en suite vorgestellt werden soll (unberücksichtigt bleibt die vierte bzw. die erste Oper Donizettis zum selben Stoffkreis: «Il Castello di Kenilworth» von 1829).
Absagen und neue Chancen
In Frage gestellt ist mittlerweile die Absicht, die Einheit der Trias auch personell zu betonen, weil das Opernhaus im Vorfeld dieser Premiere zwei Absagen erhielt. Dem Unternehmen schaden sie jedoch nicht. Die Absage Edita Gruberovas (aus familiären Gründen, heisst es in der Verlautbarung des Opernhauses; ein Zerwürfnis, meinen die Gerüchte) bedeutet auch das Ende einer Primadonnen-Fixierung, über das nicht alle unglücklich sind, und bedeutet neue Chancen. Die Absage des Regisseurs Gian-Carlo del Monaco (aus gesundheitlichen Gründen) ändert insofern wenig, als das Konzept schon mit «Anna Bolena» festgelegt wurde und die Details des Einheitsbühnenbildes und die Kostüme vom selben Team (Mark Väisänen und Maria-Luise Walek) betreut wurden.
Auch hat Grischa Asagaroff als Einspringer auf der opulenten, in der einfachen Symbolik der Farben (Rot und Schwarz) und Requisiten (Thron und Richtblock) etwas plakativ ästhetisierenden Bühne den Figuren in einer prägnanten und von Extratouren freien Personenführung zu einer eindringlichen musikalisch-schauspielerischen Darstellung verholfen. Klares Profil erhalten auch die Nebenpartien: Melinda Parsons als Marias Vertraute unauffällige Präsenz, Carlos Chausson als Elisabeths finsterer Einflüsterer Lord Cecil die eifernde Aufdringlichkeit, László Polgár als Graf Talbot, Cecils Gegenspieler und Freund Marias, die ruhige Ausstrahlung warmherziger Anteilnahme.
Zwei Frauen und ein Mann
Eigengewicht erhalten die politischen Exponenten indessen nur bedingt, wie das politische Parkett des Historiendramas insgesamt nur andeutungsweise bespielt wird. Denn im Zentrum steht der erotische Konflikt, die Rivalität der beiden Frauen um die Gunst eines Mannes. Dieser spielt dabei eine durchaus passive Rolle in seiner Zuneigung zu Maria, und es bleibt ihm sogar verborgen, dass er es ist, der die eifersüchtige Elisabetta dazu treibt, das Todesurteil zu unterzeichnen. Entsprechend ist auch seine Partie angelegt. In Duettszenen mit Talbot, Elisabeth und Maria bekennt er die Leidenschaft und am Ende die Verzweiflung: Fabio Sartoris Tenor verfügt dafür über viel höhensichere Emphase, im Gleichklang des Sentiments aber auch wenig Nuancierung.
Virtuosität und Leidenschaft
Zuletzt konzentriert sich aber die Aufmerksamkeit ohnehin auf die beiden Protagonistinnen, die mit ähnlichen Anforderungen gegeneinander antreten: mit einer in der lyrischen Kantilene auch mezzosopranistische Fülle ansprechenden Sopranpartie Maria, mit einer in der Dramatik in sopranistische Höhen getriebenen Mezzosopranpartie Elisabetta. In der Zürcher Besetzung kontrastieren die beiden Stimmen deutlich. Carmen Oprisanu bringt für die Elisabetta eine bewegliche, über die ganze Skala kernig-ausgeglichene Stimme ins Spiel, die den virtuosen Aspekten wie dem dramatischen Gewicht der Figur ideal entspricht und die in private Leidenschaft verstrickte Regentin zwischen Herrscherallüre und entgleitender Selbstkontrolle glaubhaft macht: ein Rollendebüt, das kaum Wünsche offen lässt – ausser dem nach einer nicht bloss stummen Präsenz im Hintergrund der Finalszene.
Höhen und Grenzen
Diese Szene gehört – welch eine musikalische Palette zwischen quälender Erinnerung, Resignation und religiöser Sammlung – ganz der jungen Spanierin Angeles Blancas, die hier ein beindruckendes, wenn auch nicht in jeder Hinsicht restlos gelöstes Rollendebüt auch beeindruckend zu Ende führte, schön in der Schlichtheit ruhiger Phrasen, in der Intensität der Spannungsbogen, und packend in der schauspielerischen Präsenz. Dass die immensen Anforderungen auch Ermüdungen mit sich brachte, war aber auch spürbar: Nicht ganz kontrolliert und gelöst im Larghetto, gelang die Wendung ins Maggiore; dem Maestoso-Teil fehlte einiger Schwung, und vielen hohen Tönen war das Aufgebot letzter Energien anzuhören. Nein, schlagzeilenträchtige Erwartungen (die Einspringerin als neuer Weltstar) erfüllten sich da nicht, aber für die Aufführung blieben bei weitem genug bewegend erfüllte Momente in der Gesamtheit einer grossen Ensembleleistung.
Für diese wichtig waren auch die Beiträge des (akustisch nicht optimal postierten) Chors und des Orchesters, das, von einigen Unaufmerksamkeiten abgesehen, viel hervorragende, dramatisch sprechende und kolorierende Begleitarbeit zeigte. Marcello Viottis Dirigat kostete die belcantistische Seite von Donizettis Musik flüssiger Eleganz klangschön und formbewusst aus und sorgte eher für Ausgleich als dramatische Überhitzung. Vor dem Vorhang herrschte am Ende, wie erwähnt, pure Eintracht.
|
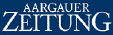
9. 12. 2002
Ein königlicher Mord im Mohnfeld
Kein Starvehikel
Premiere von Gaetano Donizettis «Maria Stuarda» im Opernhaus Zürich
Der Regisseur erkrankt, die Titelfigur abgesprungen - die Vorzeichen standen schlecht für «Maria Stuarda». Umso erfreulicher, dass unter derart widrigen Umständen eine Leistung zustande kam, die an der Premiere mit viel Applaus bedacht wurde.
MARIANNE KOLLER
Mit «Maria Stuarda» ergänzt das Opernhaus Zürich den noch fehlenden Mittelteil von Gaetano Donizettis Tudor-Trilogie, bestehend aus «Anna Bolena», «Maria Stuarda» und «Roberto Devereux». Für alle drei Teile war als Regisseur Gian Carlo del Monaco vorgesehen, der sich jedoch kurz vor dem «Stuarda»-Probenbeginn einer Operation unterziehen musste. So fiel Hausregisseur Grischa Asagaroff die etwas undankbare Aufgabe zu, dessen Intentionen im für alle drei Teile vorgegebenen Einheitsbühnenbild umzusetzen.
Alte Bekannte lassen grüssen
So grüssen der kompakte, verliesartige Bühnenraum mit in die Wände eingelassenen auf- und zufahrbaren Nischen für den maskierten Chor und das Prinzip der für die jeweilige Situation charakteristischen Dekorationsversatzstücke als alte Bekannte. In «Maria Stuarda» kommen Elisabeths Thron, ihr Zepter, ihre Krone und ihr Bett, Blumen, Gefängnisketten, ein Kreuz und ein Richtblock zum Zuge.
Das Kernstück der Oper bildet das in der Realität nie zustande gekommene Zusammentreffen von Maria Stuart, Königin von Schottland, und Elisabeth I., Königin von England, in Fotheringhay, dem nicht ganz freiwilligen Aufenthaltsort von Maria. Diese war zu ihrer Cousine geflüchtet, welche sie aus politischen Überlegungen jahrzehntelang einkerkerte und schliesslich enthaupten liess.
In Donizettis Version, die auf Friedrich Schillers Drama «Maria Stuart» beruht, treten der politische und religiöse Machtkampf in den Hintergrund zugunsten der Macht der Gefühle von Liebe, Hass und Eifersucht. Diese kulminieren in der Begegnung der beiden Königinnen im zweiten Akt, in dieser Inszenierung angesiedelt in einem blühenden Mohnfeld (Bühnenbild Mark Väisänen).
In die Haare geraten
Donizetti legt das Aufeinandertreffen als eine Art Countdown der Primadonnen an, beginnend mit einem Sextett, aus dem sich die beiden Protagonistinnen herausschälen, um sich in das Duett-Duell hineinzusteigern. In diesem Wettkampf verliert die tendenziell kühlere Elisabeth vollständig die Fassung. Bei den Proben zur Uraufführung 1834 soll sich gar eine derart heftige Rauferei zwischen den Primadonnen zugetragen haben, dass Elisabeth ohnmächtig und mit einigen Haaren weniger auf dem Kopf abtransportiert werden musste.
Elisabeths Ausbruch wird mitverursacht durch den Tenorhelden Leicester, der blind ist für Elisabeths Begehren und ihr wahrhaft in den höchsten Tönen von Maria schwärmt. Seine Liebe zu Maria und Marias Beschimpfung von Elisabeth als Bastard (von Heinrich VIII. und Anna Boleyn) besiegeln das Schicksal der Schottin. Elisabeth beschliesst ihre Enthauptung. Sichtbar gemacht und vorweggenommen durch einen kräftigen Schlag von Elisabeth mit der Reitpeitsche auf eine Mohnblume.
In dieser Schlüsselszene, in der alle Beteiligten versammelt sind, werden zudem sämtliche Beziehungen sichtbar: Pro Maria sind Leicester, Talbot (Laszlo Polgar) und die Kammerzofe Anna (Melinda Parsons), kontra Maria sind Elisabeth und ihr Berater Cecil (Carlos Chausson).
Ein neues Gesicht
Anstelle der offiziell aus familiären Gründen absagenden Edita Gruberova singt die junge Spanierin Angeles Blancas die Titelrolle und präsentiert sich mit diesem Rollendebüt erstmals in Zürich. Blancas meistert die anforderungsreiche Partie mit ihrem kräftigen Sopran sowohl in den herrisch auftrumpfenden Momenten als auch in den melancholisch entrückten eindrücklich. Carmen Oprisanu als Elisabeth ist ihr eine gleichwertige Partnerin, auch wenn ihre Kälte und Verbitterung mehr in ihrem Mienenspiel als in ihrem Mezzosopran zum Ausdruck kommen.
Durch die Wahl der beiden jungen Sängerinnen umging man die Gefahr, dass das Stück lediglich ein Starvehikel wurde. Auch die Liebesgeschichte erscheint glaubhafter. Schade nur, dass Fabio Sartori als Leicester die Lautstärke seines höhensicheren, mit Schmelz ausgestatteten Tenors nicht etwas zurückdreht, wozu er durchaus fähig wäre. Dazu müsste ihn Marcello Viotti, der bereits «Roberto Devereux» souverän dirigiert hatte, ermuntern. Denn dadurch ergäbe sich ein noch stimmigerer Gesamteindruck.
|
 9. 12. 2002
9. 12. 2002
Ein unerhörter sängerischer Triumph
Hingebungsvolle Sängerinnen an der Premiere von Donizettis «Maria Stuarda» am Zürcher Opernhaus
Donizettis «Maria Stuarda» konnte sich nie richtig durchsetzen. In der Aufführung am Zürcher Opernhaus wurde der Abschluss der Tudor-Trilogie aber zum sängerischen Triumph.
Alexander Pereira war im Vorfeld dieser Premiere nicht zu beneiden. Mit der «Maria Stuarda» sollte am Opernhaus Zürich die Tudor-Trilogie von Donizetti abgeschlossen werden, nach «Roberto Devereux» und «Anna Bolena».
Doch kurz vor Probebeginn musste Regisseur Gian-Carlo del Monaco wegen einer schweren Operation absagen. Und gleich darauf teilte «Primadonna» Edita Gruberova mit, dass sie wegen eines Krankheitsfalles in der Familie die Titelpartie nicht singen werde.
Das war die Chance der mit viel Vorschusslorbeeren angekündigten jungen spanischen Belcanto-Sängerin Angeles Blancas, während sich Grischa Asagaroff bereit erklärte, die Regie nach dem Konzept von del Monaco zu übernehmen. Marcello Viotti, neuerdings Chefdirigent am Theater in Venedig, hatte die musikalische Leitung inne. Trotz allem war die Premiere vom Samstag, dies sei vorweggenommen, ein sängerischer Triumph.
Die «Maria Stuarda» von Donizetti konnte sich nie richtig durchsetzen und ging im 19. Jahrhundert fast ganz vergessen. Dies mag auch mit dem etwas gar eindimensionalen Libretto zusammenhängen. Der junge Librettist Giuseppe Bardari hat zwar auf Schillers Drama zurückgegriffen, sorgte mit seiner Beschränkung auf die Hauptpersonen aber für eine ausgesprochene Statik.
Einheitskonzept mit symbolträchtigen Versatzstücken
Donizetti seinerseits wies jeder Königin einen Akt zu: Elisabetta den ersten, Maria den dritten, und der mittlere Akt bringt die verhängnisvolle Begegnung der beiden Kontrahentinnen. Alle anderen Figuren jedoch haben kaum mehr dramaturgische Substanz - ausser vielleicht Graf Leicester, der Liebhaber Marias, in den auch die eifersüchtige Elisabetta verliebt ist.
Für die Tudor-Trilogie hat Gian-Carlo del Monaco ein Einheitskonzept erarbeitet. Das Bühnenbild von Mark Väisänen - ein metallener Einheitsgrundbau mit auffahrbaren, logenartigen Nischen für den Chor - bleibt bestehen. Dazu kommen in der «Maria Stuarda» wenige, aber symbolträchtige Dekorationsversatzstücke: der riesige Thron von Elisabetta, daneben Krone und Zepter, die Mohnblumen im Park, ein grosses Bett Elisabeths, das Gefängnis Marias mit Ketten, und im Schlussbild der Richtblock. Rot und Schwarz sind die vieldeutig eingesetzten Grundfarben, auch in den Gewändern der Protagonistinnen.
Diese komprimierte Einheitlichkeit im Bühnenbild kommt den einfach und klar zugeschnittenen Situationsbildern dieser Oper entgegen. In den üppigen historischen Kostümen von Maria-Luise Walek ist ja auch nicht viel Bewegung möglich. Dass zudem aber der Chor szenisch nicht auftritt, sondern hinter Gesichtsmasken verborgen in den Logennischen reglos verharrt und nur musikalisch wirkt, nimmt dem Werk noch die letzte szenische Dynamik und «öffentliche» Dimension.
Anspruchsvolle Monsterpartien der beiden Sängerinnen
In diesem grossen «Kammerspiel» gewinnt das mimisch-gestische Spiel der Sängerinnen und Sänger stark an Bedeutung. Unerhört, was die beiden Heldinnen in dieser gestalterischen Hinsicht an den Tag legten. Die beiden anspruchsvollen Monsterpartien - Elisabetta und Maria sind wechselweise fast ununterbrochen präsent und singen über weite Strecken im Alleingang - wurden mit grossartiger stimmlicher und szenischer Präsenz gemeistert.
Die rumänische Mezzosopranistin Carmen Oprisanu hat die Partie der Elisabetta mit Marcello Viotti bereits konzertant erarbeitet. Das kam ihr jetzt, in der szenischen Umsetzung, sehr entgegen. Mit einer technischen Souveränität ohnegleichen entlockte sie dieser eher hoch gesetzten Mezzopartie eine Vielfarbigkeit und Wärme, die dieser strengen Herrscherin einen menschlichen Touch verlieh.
Ohne zu übertreiben wechselte Oprisanu zwischen Staatsraison und Gefühl, zwischen erhabener Belcanto-Strahlkraft und lyrischer Substanz. Dabei gelang es ihr, mit subtiler, viel sagender Gestik, den sehr natürlich wirkenden Ausdruck differenziert zu unterstreichen.
Angeles Blancas Stimme gewann stetig an Kontur
Gespannt erwartete man danach den Auftritt von Angeles Blancas zu Beginn des zweiten Akts. Maria Stuarda stellt sich lyrisch verhalten vor - eine Seltenheit im Belcanto. Angeles Blancas wirkte anfangs noch etwas breit in der Stimmgebung, ja fast schleppend. Doch mit zunehmender Dramatik gewann sie auch an Kontur und Substanz. Bei aller Jugendlichkeit, die sie für diese anspruchsvolle Partie körperlich und stimmlich mitbrachte, setzte sie sich damit gut von der Elisabetta ab.
Mit lichter Eleganz träumte sie im Mohnfeld von ihrer glücklichen Jugend in Frankreich. Grossartig dann ihr Aufbäumen nach den Demütigungen durch Elisabetta, mit dem sie ihr Todesurteil selber mitverschuldet. Und dann die düstere Kerkerszene, unendlich in der Phrasierung, ein In-sich-Kehren mit stimmlicher Beweglichkeit. Angeles Blancas schaffte diese Stimmungswechsel mit Hingabe und beeindruckender künstlerischer Reife - sie wurde dafür vom Premierenpublikum mit stürmischem Applaus gefeiert.
Dirigent hielt die Spannkraft mit Leidenschaft für Belcanto
Doch auch die männlichen Protagonisten wussten zu überzeugen. Allen voran der heldische Tenor Fabio Sartori als Roberto, der bei aller heldischen Strahlkraft seiner Stimme auch innigen Schmelz vermittelte. Lászlê Polgár gab mit beeindruckender Bühnenpräsenz einen hintergründigen Talbot, während sich Carlos Chausson als Cecil mit baritonalem Glanz behauptete.
Und nicht zuletzt wusste Melinda Parsons in der kleinen Rolle von Marias Vertrauten mit ihrer dunkel timbrierten Sopranstimme einen charakteristischen Farbtupfer zu setzen. In Marcello Viotti hatten alle Sänger einen agilen, subtil auf sie reagierenden Dirigenten. Er dramatisierte nicht unnötig, sondern hielt das Orchester geschickt zurück. Trotzdem hielt er die Spannkraft mit federndem Rhythmus und einer spürbaren Leidenschaft für den Belcanto.
Sibylle Ehrismann
|
 9. 12. 2002
9. 12. 2002
Rampensingen mit Niveau
Aufführung des letzten Teils von Donizettis Tudor-Trilogie am Opernhaus Zürich
Trotz gewichtigen Absagen verlief die Premiere von der Oper «Maria Stuarda» reibungslos.
Edita Gruberova, die Primadonna assoluta des Koloratursoprangesangs, mag nicht mehr am Opernhaus Zürich singen. Auf Handzetteln liess sie die Premierenbesucher wissen, dass sie «alle Projekte am Opernhaus Zürich unwiderruflich abgesagt» habe. Ihre Absage für die Titelrolle in Gaetano Donizettis historischer Tragödie «Maria Stuarda» vor zehn Tagen erreichte das Opernhaus ebenso überraschend wie ihre zahlreichen Fans, die jeweils von weit her pilgerten, um sie in Zürich zu hören.
Die slowakische Starsopranistin wirft dem Opernhaus mangelnde Sicherheitsvorkehrungen vor ihre Tochter, eine Tänzerin, verletzte sich im März 2001 bei einem Sturz. Nun, die Diva scheint etwas überreagiert zu haben doch ein gewichtiger Verlust für das Star-verwöhnte Haus ist sie allemal. Absagen erlebt der Opernbetrieb immer wieder, und manchmal sind sie das Sprungbrett für den Ersatz. Gruberovas Einspringerin ist nur halb so alt, sie kommt aus Spanien, und ist erstmals in der Schweiz zu hören: die Sopranistin Angeles Blancas. Wie alle anderen Solisten singt sie ihre Rolle zum ersten Mal. Im zweiten Akt, ihrem ersten grossen Auftritt, dachte man noch an Groberova, und wie sie es gesungen hätte. Den dritten Akt, in dem sie enthauptet wird, hatte Blancas dann ganz für sich. Sie ist eine zarte, fast zerbrechliche Sängerin, die keine sehr grosse Stimme hat. Aber sie wusste ihre Kräfte für die äusserst anstrengende Partie intelligent einzuteilen, und sie verfügt über ein wunderschönes Piano, mit dem sie das Publikum für sich gewann. Mit Carmen Oprisanu als Elisabetta hat sie eine ebenbürtige Gegenspielerin, die erst noch mit Nervosität zu kämpfen hatte, es dann aber souverän schaffte, mit ihrer ebenfalls sehr kräfteraubenden Rolle zurechtzukommen. Die Tenorpartie war mit Fabio Sartori komfortabel besetzt. Der kleine und rundliche Mann sang mit grosser Perfektion und einer derartigen Selbstverständlichkeit, dass ihm eigentlich die Krone gebührte, um die sich die beiden Königinnen streiten.
Kranker Regisseur
Der Belcanto-Spezialist Marcello Viotti dirigierte routiniert, hatte aber zeitweise Mühe, die Solisten, den Chor und das Orchester partiturgerecht zu koordinieren. Die Absage von Edita Gruberova hatte offenbar ihre Spuren hinterlassen. Dazu kam die krankheits-bedingte Absage von Regisseur Gian-Carlo del Monaco kurz vor Probenbeginn, welche die Produktion zusätzlich in Frage stellte. «Maria Stuarda» gehört zusammen mit «Roberto Devereux» und «Anna Bolena» zur so genannten Tudor-Trilogie von Donizetti, die in Zürich vom gleichen Regieteam erarbeitet wurde. Grischa Asagaroff, der künstlerische Betriebsdirektor am Opernhaus, musste also eine halbfertige Produktion übernehmen. Das Bühnenbild von Mark Väisänen war das gleiche wie in den bereits aufgeführten beiden Teilen der Trilogie, und auch Kostümbildnerin Maria-Luise Walek hielt sich an ihr früheres Konzept. Del Monaco hätte vielleicht mehr aus der vorgegebenen Bühne, einem düsteren Kerker-ähnlichen Einheitsbild, herausholen können, und er hätte den Solisten ihre Rollen präziser zuzuordnen gewusst. Der Tenor könnte mit dem gleichen Gestus so ziemlich jede Belcanto-Rolle spielen, und auch Elisabetta zeigt, etwa beim Unterschreiben des Todesurteils für ihre Cousine, kaum eine Gefühlsregung. Einzig Angeles Blancas in der Titelrolle vermittelt etwas vom Zwiespalt zwischen Verführerin und Märtyrerin, in dem die Königin von Schottland steckt. Aber auch sie flüchtet sich, wie die andern Solisten, zu oft in simples Rampensingen.
|

9. 12. 2002
Umjubelte «Maria Stuarda»
Nach einer turbulenten Vorgeschichte fand am Samstag in Zürich die erfolgreiche Premiere von Gaetano Donizettis «Maria Stuarda» statt.
Erst war Regisseur Gian-Carlo del Monaco erkrankt. Grischa Asagaroff sprang in die Bresche und übernahm das Konzept. Dann hatte sich Edita Gruberova als Maria Stuarda aus familiären Gründen zurück gezogen. An ihrer Stelle singt Angeles Blancas, eine junge Spanierin, die anspruchsvolle Partie. Angeles Blancas ist ein hervorragender Ersatz. Sie ist eine grazile Sängerin mit kristallklarem, geschmeidigem Silbersopran, der auch dramatische Ausbrüche und virtuose Abläufe mühelos meistert.
Trotzdem wirkt die Inszenierung oft wie eine konzertante Aufführung: Königin Elisabeth zeigt zum Beispiel Leicester das Todesurteil für seine geliebte Maria: Kaum eine Regung ist da zu sehen. Wie wenn Regisseur Asagaroff die Dramatik nur der Musik und der Ausstattung mit ihrer schwarz-roten Farbsymbolik überlassen wollte. Die Musik aber überzeugt: Marcello Viotti lässt das Zürcher Opernorchester pulsierend spielen. Das Publikum liess sich diese Aufführung gefallen und belohnte sie mit heftigem Applaus.
|
Stellungnahme von Edita Gruberova zu ihrer Absage
"Beim Unfall meiner Tochter im März 2001 am Opernhaus Zürich handelt es sich um einen Sturz in 2-3 Meter Tiefe auf Beton, aus einer fahrenden und ungesicherten(!) Bodenversenkung. Die Folge waren Verletzungen verschiedenster Art und ein schwerer Schock, den meine Tochter mit fortgesetzter Arbeit als Choreographin zu überwinden versuchte. Da Ausmaß und Folge dieser Katastrophe zu diesem Zeitpunkt noch nicht abzusehen war, habe auch ich aus Pflichtbewußtsein noch zwei weitere Produktionen absolviert. Im September 2001 verschlechterte sich der Zustand meiner Tochter derart, daß sie sich gezwungen sah, jegliche Arbeit niederzulegen. Sie leidet heute an Spätfolgen (Unfalltrauma und starke körperliche Schmerzen), ist zu 100% arbeitsunfähig und auf 46 kg abgemagert! Für mich als MUTTER ist dies ein wohl jedermann verständiger Grund, endlich(!) die Konsequenz zu ziehen, und auf weitere Tätigkeiten am Opernhaus Zürich zu verzichten. Es sei erwähnt, daß eine Kollegin noch heute an den Spätfolgen eines Feuerunfalls zu leiden hat und auch ich selbst vor nicht allzu langer Zeit beinahe Unfallopfer auf Grund eines mangelhaft gesicherten Stufengeländers geworden wäre!"
Edita Gruberova
Quelle: www.gruberova.com
|

