Aufführung
|

14. 11. 2004
(Première)
*
Musikalische Leitung: Franz Welser-Möst
Inszenierung: Sven-Eric Bechtolf
Ausstattung: Marianne und Rolf Glittenberg
Lichtgestaltung: Jürgen Hoffmann
Chor: Jürg Hämmerli
*
Pelléas: Rodney Gilfry
Golaud: Michael Volle
Arkel: László Polgár
Yniold: Eva Liebau
Un médecin / le berger: Guido Götzen
Mélisande: Isabel Rey
Genéviève: Cornelia Kallisch
SYNOPSIS - LIBRETTO - HIGHLIGHTS
|
Rezensionen
|
|
|
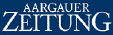
16. 11. 2004
Das Opfer entsteigt seinem Albtraum
Kein Wohlfühlabend: Claude Debussys «Pelléas et Melisande» am Opernhaus Zürich
Für einmal ist am Opernhaus Zürich ein Ensemble anstelle von Stars zu bewundern und ein Interpretations-Sucher anstelle eines als Regisseur getarnten Ausstatters zu beurteilen. Trotzdem - oder deswegen? - gähnten und buhten (zu) viele.
Christian Berzins
Wer Fragen beantwortet, hat das Recht, neue zu stellen. Natürlich wäre es bei Debussys nach Moos und Veilchen riechender Oper «Pelléas et Melisande» für den Regisseur einfach, er beliesse die traumdurchflossene Handlung im Nebel: Er liesse die Menschen wie Elfen zwischen hohen Bäumen und dunklen Teichen umherhuschen und verschwiege, warum alle vor Angst zittern. Doch da beginnt Regisseur Sven-Eric Bechtolf zu fragen, zu beleuchten, zu bebildern, zu interpretieren - und zu verstören.
Diese Oper basiert ja auch auf einer eigenartigen Geschichte, die von Debussy in eine geheimnisvolle Musik gesetzt und 1902 uraufgeführt wurde: Golaud findet Melisande im Wald und heiratet sie. Sein Bruder Pelléas verliebt sich in die Unbekannte, worauf ihn Golaud tötet. Maurice Maeterlink hat diese Handlungsstränge 1893 entworfenen.
Alter Trick, neue Fragen
Bechtolf inszeniert nun nicht erzählend «logisch», sondern er will erklären. Dazu verwendet er einen alten Theatertrick, der neue Fragen aufwirft: Er verdoppelt mit Hilfe von Puppen jede Figur. So erhalten die vereinsamten Schlossmenschen, die aneinander vorbei reden, ein zweites Ich, eine Projektionsfläche, manchmal gar einen Ansprechpartner. Dank dieses Ansatzes voller Zuspitzungen und Fragwürdigkeiten wird aus der lieb gewonnenen Geschichte ein böser Albtraum - überraschenderweise darf ihm Melisande zum Schluss entsteigen. Aber diese Melisande ist bei Bechtolf eben kein zum Sterben und Lieben geborenes Wesen, sondern eine geplagte und deswegen sich wehrende Frau.
Melisande: Wesen und Frau
Golaud trifft anfänglich auf sein wohl schon lange herbeigewünschtes Wesen, auf die Puppe Melisande. «Frau» Melisande tritt kurz darauf auf. Zu ihr findet neben Arkel nur Pelléas Zugang - ohne Puppen als Zwischenebene, denn sie lieben sich. Doch ist es in dieser Welt überhaupt möglich zu fühlen? Ist diese Bühne nicht einfach nur eine surreale mondartige Landschaft, die irgendein Kopf träumt? Bühnenbildner Rolf Glittenberg hat einen schneebedeckten, eiskalten Schreckensort gebaut, kalte graue Mauern machen aus dem Nichts zeitweise Räume. Eine Citroën-Limousine erinnert daran, dass es hier irgendwann aktives Leben gab.
Bewunderung für Debütanten
Dirigent Franz Welser-Möst zieht Bechtolfs Ideen weiter: Er webt einerseits wunderbar ausgestaltete Klangteppiche. Doch so wenig wie die Inszenierung zum Träumen ist, so wenig ist es dieses Dirigat: Welser-Möst betont die dramatischen Seiten, zeichnet präzis, wo es andere oft nur schimmern lassen. Da ihm das Opernhausorchester auf sehr hohem Niveau folgt, behält die Musik ihren Ton, der durchaus französisch zu nennen ist. Zieht man in Betracht, dass auf der Bühne ausnahmslos Rollendebütanten standen, kann man ihre Leistung nicht genügend bewundern: Hervorzuheben ist Michael Volle als Golaud. Rodney Gilfry und Isabel Rey sind ein zueinander passendes Titelpaar, derweil Laszlo Polgar als Arkel wundervolle Ruhe verströmt. Cornelia Kallisch, Eva Liebau und Guido Götzen vervollständigen das geschlossene Ensemble.
13 Jahre lang hat der Intendant gewartet, bis er dieses Schlüsselwerk des 20. Jahrhunderts auf den Spielplan setzte. Auf Wunsch von Franz Welser-Möst ist die Produktion entstanden. Ihm gehört dieser Abend - fraglos.
|

16. 11. 2004
Mélisande im Citroën
Debussys Oper «Pelléas et Mélisande» im Opernhaus Zürich
VERENA NAEGELE
Regisseur Sven-Eric Bechtolf entliess das Premieren-Publikum am Sonntag ratlos und ernüchtert in die kalte Nacht.
Durch die «traumhafte Atmosphäre» des Pelléas-Dramas von Maeterlinck, das «bei weitem mehr Menschlichkeit enthält als all die so genannten lebensechten Stoffe», fühlte sich Claude Debussy zu seiner einzigen Oper inspiriert. Sie lebt vom Andeuten und Verschleiern, vom symbolistischen Vernebeln, bei dem die Musik das Unausdrückbare blühend umspielt. Regisseur Sven-Eric Bechtolf traut dem menschlichen Mysterium nicht, er stellt ihm die totale «Décadence» entgegen.
Zugeschneit. Nichts gedeiht mehr, keine Farben und Natur, Blumen und Wälder, wiewohl von den Protagonisten permanent beredet. Die Bühne (Rolf Glittenberg) wird be-grenzt durch eine Turmfassade, die die entseelten Figuren hoffnungslos gefangen hält. Hebt sich dieser undurchdringliche Wall, gibt er den Blick frei in eine dreigeteilte, weiss überschneite Skulpturenlandschaft. Eine Welt, die sich im Kreis dreht.
Die Regie konterkariert Debussys «Menschlichkeit» und entlarvt sie so als sinnentleert und öde. Jede Figur erhält ein wächsernes Pendant in Lebensgrösse, «Spielzeuge», die anstelle des «Originals» «besungen» und mit denen die symbolhaften Handlungen verdeutlicht werden. Golaud schleudert seine Mélisande-Puppe an den Haaren durch den Raum und reisst in seiner Wut Söhnchen Yniol den Arm ab. Die Puppen gemahnen an Pop Art, ebenso das weiss überzuckerte Citroën-Kultauto, Ort der Begegnung von Pelléas und Mélisande im dritten Akt.
Eingeklemmt. Es ist das stimmigste Bild des Abends, wenn Mélisande, auf dem Autodach liegend, ihr Haar über den «Geliebten» ergiesst und dieser das prächtige schwarze Haar im Türrahmen einklemmt. Sven-Eric Bechtolf gelingen also eindrückliche Szenen, und doch ermüdet der schneeweiss-graue Abend mit zunehmender Dauer, man schliesst die Augen und lässt sich durch das Farbenspiel des Orchesters und das nuancierte Parlandosingen der Sängerinnen und Sänger dem Ende entgegentragen.
Musikalisch ist nämlich nichts von dieser szenischen Erstarrung zu spüren - im Gegenteil. Franz Welser-Möst lotet mit dem Orchester Debussys Traumsprache wunderbar aus und verhilft der kammermusikalischen Faktur mit blitzsauberen Bläsern und weichen Streichern zu Transparenz und Dichte. Ihm gelingt der grossformale Bogen von der emotionslosen, schwebenden Zurückhaltung des ersten Teils in einem lang gezogenen Crescendo hin zum wütenden Ausbruch Golauds. Hervorragend abgestimmt sind die Stimmen, in ihrem melismatischen Parlieren vom Orchester strukturiert getragen.
Fahl und fein ziseliert in der mörderisch hohen Tessitura Rodney Gilfry als Pelléas, der damit den runden Bariton von Michael Volle als Golaud umso gefährlicher zum Tragen kommen lässt. László Polgár mit schwarzem Bass als Arkel und Cornelia Kallisch mit dunklem Timbre als Geneviève illustrieren - meist im Rollstuhl sitzend - das Absterben des Alters. Am schwersten hat es Isabel Rey als naiv-puppenhafte Kindfrau. Mit wunderbar geführter, schlanker Stimme singt sie sich farbenreich durch die eindimensionale Partie. Es spricht für die sorgfältig ausgewählten Stimmen, dass Eva Liebau mit lyrischem Impetus sich als Yniol deutlich absetzt. Kaum zu glauben, dass der Abend für alle ein Rollendebüt war!
|

16. 11. 2004
Eisgekühlt: Pelléas und Mélisande
Mit deutscher Gründlichkeit hat das Regieteam von Sven-Eric Bechtolf, was bei Debussy so leicht im Raum schwebt, in eisigen Realismus gezwängt. «Pelléas et Mélisande» hatte am Sonntag Premiere im Opernhaus Zürich.
Die Dreiecksgeschichte des französischen Symbolisten Maurice Maeterlinck ist simpel: Zwei Männer lieben dieselbe Frau. Der Ehemann bringt aus Eifersucht den Nebenbuhler um, die Frau stirbt an Verzweiflung.
Das tönt nach Menschen aus Fleisch und Blut. Ist aber falsch. Dichter wie Komponist haben Figuren geschaffen, die als Träumer in einer zauberhaft verschleierten Welt leben, in der es keine Erfüllung irdischen Glücks gibt.
Debussy und Maeterlinck schaffen durch Musik und Worte eine warme Atmosphäre. Pelléas und Mélisande möchten zueinander finden, doch Schloss Allemonde mit König und Bewohnern verweigern sich ihrem Traum.
Als sich der Vorhang hebt, sitzt Mélisande in einer eisigen Landschaft. Die Bühnen- und Kostümbildner Rolf und Marianne Glittenberg schufen eine ästhetische Winterlandschaft. Für die Spannung zwischen Schein und Sein sorgen Puppen: Jede Person steht real und als Puppe auf der Bühne. Da wird handfest zu Werke gegangen, wo Text und Musik eine viel sensiblere Geschichte erzählen.
Zum Glück spielt das Orchester unter der feinfühligen Leitung von Franz Welser-Möst einen französischen Debussy. Die stimmungsstarke Musik - es gibt in dieser Oper keine richtigen Arien, kaum mal eine Melodie - schafft die vom Komponisten gewünschte, unbestimmte Atmosphäre, in die der Zuhörer immer stärker eingelullt wird. Wer es wagt, die Augen zu schliessen, erlebt tatsächlich «Pelléas et Mélisande» vom Feinsten. Doch als Gesamtkunstwerk lässt die Aufführung kalt.
Fazit: In der Pause holte mancher Premierengast seinen Mantel an der Garderobe. Nicht, weil ihn das Geschehen auf der Bühne unterkühlt hätte, sondern weil er nach Hause gehen wollte.
Roger Cahn
|

16. 11. 2004
Tiefgekühlter Symbolismus
Die Kälte siegt, die Gemüter sind erhitzt. Das Opernhaus präsentiert Debussys einzige Oper in ungewohntem Klima.
Herbert Büttiker
Auf dem zugefrorenen Teich sitzt Mélisande regungslos im Kahn. Wie sich Golaud ihr nähert und sie anspricht, tritt aus der Eislandschaft im Hintergrund Mélisande hervor, identisch in Gestalt, Gesichtsphysiognomie und Kleidung. Auf die Fragen nach ihrer Herkunft, die er an die Puppe richtet, gibt die Sängerin, von ihm unbeachtet, hinter ihm die scheue Antwort. Bald aber zeigt sich, dass die Marionetten-Figur für die lebendige Mélisande ebenso eine Bezugsperson ist und dass Golaud und alle weiteren Figuren der Oper ebenfalls ihr durchaus verwechselbares Alter Ego haben, oft im Rollstuhl, oft irgendwo hingelegt, oft aber auch integriert in den Dialog, der so eigentlich monologisch bleibt. Das wirkliche von Du zu Du, das unverstellte Zwiegespräch, ist die Ausnahme: unvergesslich das fast gesprochene Liebesgeständnis von Pelléas und Mélisande im vierten Akt – grossartig komponiert im kargen «Je t’aime» und «Je t’aime aussi», zu dem das Orchester schweigt, und wunderbar «ausmusiziert» in der Stille.
Phantasie und Material
Ein komplexes, aber intensives Figurenspiel und die unheimlichen Bilder einer vereisten Welt: Die Inszenierung von Sven Bechtolf, Rolf und Marianne Glittenberg (Bühnenbild und Kostüme) sowie Jürgen Hoffmann (Licht) spart weder Phantasie noch Material. Ein zisternenartig geschlossener Raum im Vordergrund und eine labyrinthische Landschaft auf der Drehbühne im Hintergrund sorgen für einen bewegten szenischen Rhythmus ganz im Geist dieser Oper, deren musikalische Gliederung in Szenen und orchestrale Zwischenspiele vom Bildgeschehen diktiert ist. Nur, das Bildprogramm entfernt sich weit von dem, was der symbolistische Dichter Maurice Maeterlinck vorgibt und Debussy immer wieder auch lautmalerisch komponiert hat.
Ja, auch lautmalerisch. Dass sich diese fliessend webende und doch thematisch strukturierte Musik im Impressionistischen erschöpft, ist damit nicht gesagt. Die Bewunderung gilt aber doch dem Phänomen einer Klangsprache, die Vordergründiges und Hintergründiges überaus schlicht in Übereinstimmung bringt. Im «Naturlaut» des Orchesters und im natürlichen Sprechton der Gesangsstimmen geht zugleich das seelisch Geheimnisvolle, die traumartige Wirklichkeit der Dichtung auf, und die poetischen Bilder, die beides vermitteln, sind nicht weit hergeholt: der Wald, der Brunnen, der Turm, die Grotte, das Meer, der Wind, die Jahres- und Tageszeiten usw.
Die Inszenierung mag das symbolistische Kaleidoskop abstrahieren (wie etwa Beni Montresor in St. Gallen, 1995), sie kann es aussparen beziehungsweise dem Wort und der Musik überlassen und sich konsequent an das bürgerliche Drama halten (wie Pierre Strosser in Lyon, 1988). Aber der Kollisionskurs einer eigenen Bildfindung mit der in Wort und Klang anvisierten? Die gefrorene Landschaft, in der davon die Rede ist, dass man vor Schwülheit selbst im Schatten der Bäume ersticke? Die Citroën DS anstatt eines Turms als Ort des heimlichen Treffens? Gewiss ist da manches von verstörender Eindringlichkeit, vieles souverän umgesetzt. Was Golaud seinem Bruder zur Warnung in den Gewölben unter dem Schloss zeigt, ist Albtraum pur. Mit den handlichen Marionetten lässt sich umspringen, dass es den Zuschauer schmerzt. Aber bedeuten «starke Bilder» per se auch tiefere Einsicht? Wiegen sie den Verlust einer genialen Einheit von Wort, Musik, Bild und Sinn und die Totalität einer Wirkung auf, in der alle Wahrnehmung zusammenfliesst und für die Oper steht? Faszination und Zweifel dürfen sich wie Applaus und Ablehnung des Publikums an der Premiere durchkreuzen.
Diskretion und Ausbruch
Wie auch immer. Sich auf ein «A part» zu konzentrieren gehört jedenfalls zur Höraufgabe an diesem Abend: mit Gewinn, was die sängerische Leistung eines Ensembles betrifft, das mit lauter Rollendebüts aufwartete. Was es heisst, Debussys feingliedrigen Gesang in allen Nuancen und im Zeichen der Stille musikalisch präzis und expressiv zu gestalten, das Parlando mit lyrischer Substanz zu füllen, lässt sich besonders eindrücklich mit Isabel Reys Mélisande erleben: mit blühendem, im Zarten kräftigem Sopran lässt sie die Figur in die Liebesszene hineinwachsen und in die Todesszene wieder eingehen zur Menschenseele, die «très silencieuse» ist.
Auf diesen «diskreten» Ton versteht sich in der Schlussszene ergreifend auch Michael Volle, der mit facettenreichem Bariton zuvor Golauds Gewaltausbrüche heftig in Szene gesetzt und ihn mit allen Zwischentönen der Zerrissenheit zur tragischen Figur gemacht hat. Pelléas, den Dritten im zentralen Dreieck, mit einem Bariton zu besetzen ist nicht unproblematisch. Mit Rodney Gilfry ist allerdings ein über weite Bereiche der Partie ein differenzierter und flexibler Sänger am Werk mit frischem Timbre in der tiefen und mittleren Lage. Aber Grenzen sind doch unüberhörbar, und insgesamt wäre eine tenoral glänzendere, lyrisch blühendere Stimme auch ein gewinnender Kontrast zum virilen Rivalen.
Vehemenz und Feinzeichnung
Unter den weiteren Figuren mag man Cornelia Kallischs Geneviève, Guido Götzens Arzt und Eva Liebaus Yniold – dieser freilich ein Glanzlicht musikalisch und inszenatorisch – als Nebenfiguren bezeichnen. Arkel, obwohl nur fast blinder Zeuge des Dramas, ist in gewissem Sinn die Hauptfigur. Mit der Ahnung um die fatale Zwangsläufigkeit des Geschehens und die Abgründe des Seelischen und mit dem Wissen um die Hinfälligkeit seiner Existenz ist er ein Spiegel des Dichterischen: eine Figur, die László Polgár mit seinem warm-dunklen, ruhig geführten Bass wie auf den Leib geschrieben ist.
Die sorgfältige Sängerarbeit findet im Instrumentalen ihre grandiose Fortsetzung. Der Orchestergraben präsentiert sich als Farbpalette, die allen Zauber offeriert. Franz Welser-Möst setzt jedoch nicht auf klangliche Delikatesse allein, sondern mobilisiert auch erstaunlich viel dramatische Energie und Vehemenz. Da herrscht vom ersten bis zum letzten Ton in der atmosphärischen Feinzeichnung auch Spannung. Wie auch immer man sich in der Inszenierung zurechtfindet, deutlich macht der Abend, dass dieses Schlüsselwerk der Moderne noch immer ein unerhörtes Ereignis ist.
|

16. 11. 2004
Debussy - schwer symbolistisch
«Pelléas et Mélisande» im Opernhaus Zürich
Ganz leise, im Klang tiefer Streicher und eines Fagotts, hebt das Orchester der Oper Zürich an, doch wenn im Takt darauf zwei weitere Fagotte dazukommen, treten diese Bläser plötzlich irritierend heraus. Nun gut, das kann passieren, es gibt ja einen zweiten Anlauf - aber: Das Bild bleibt dasselbe. Da stimmt etwas nicht, da spielen die Bläser zu laut oder die Streicher zu leise, das Geschehen müsste sich ja in einem geschlossenen dynamischen Umfeld entfalten. Ein heikler Beginn, gewiss, und dass er danebengegangen ist, mag der Premierenspannung zuzuschreiben sein. Allein, es ist nicht das Einzige, was bei der neuen Zürcher Produktion von «Pelléas et Mélisande» musikalisch zu wünschen übrig lässt.
Der österreichische Dirigent Franz Welser- Möst scheint den Kontakt zur Oper von Claude Debussy nicht gefunden zu haben. Weder das spezifisch impressionistische Idiom noch der Bezug zu Richard Wagner wird klar herausgearbeitet; weder wird die Linearität beleuchtet noch die rauschhafte Harmonik betont. Auch klangliches Raffinement, Duft gibt es wenig - wobei zu sagen ist, dass dieses Stück in diesem Raum alles andere als einfach zu bewältigen ist. Aber selbst so wirkungsvoll komponierte Stellen wie der Moment, da Mélisande ihren Ehering ins Wasser fallen lässt, und die offene Liebeserklärung von Pelléas geraten blass, weil sie zu absichtsvoll, mit zu wenig Souplesse angegangen werden. Und immer wieder stockt es hier und rennt es dort davon, wo sich die Musik doch als eine ruhige Erzählung entfalten müsste.
Vollkommen unerträglich die Erhitzung des fünften Aktes. Das Ende von «Pelléas et Mélisande» kann sich in die Länge ziehen, das ist bekannt. Das Geschehen derart dramatisch aufzuladen, wie es im Opernhaus Zürich geschieht, ist aber nicht die Lösung. Es führt nur dazu, dass Rodney Gilfry, der mit seinem hellen Bariton einen sympathischen Pelléas abgibt, zu forcieren beginnt und heiser wird. Und dass sich Michael Volle, der den unglücklichen Golaud von Anfang an als noch durchaus jugendlichen Feuerkopf zeichnet, in ein schwer auszuhaltendes Brüllen verirrt - hier wird Debussy mit Puccini verwechselt. Ihre Fassung bewahren Cornelia Kallisch als eine ganz aus der Tiefe ihrer Kehle klingende Geneviève und vor allem László Polgár, der als Arkel meist im Sitzen zu singen hat, aber stimmlich wie darstellerisch zu hinreissender Ausstrahlung findet. Mélisande schliesslich, sie ist bei Isabel Rey, ihrem lieblichen Sopran und ihrer ganz natürlichen Bühnenpräsenz, in besten Händen. Bemerkenswert zudem, dass die Verständlichkeit einen hohen Grad erreicht und dass jetzt auch das Opernhaus Zürich zu der weit verbreiteten Übertitelung greift.
Mag sein, dass die musikalische Realisierung einen Gegensatz zur szenischen Auslegung aufbauen möchte. In der Ausstattung von Rolf und Marianne Glittenberg herrscht nämlich Eiseskälte. Ein Schloss aus abweisendem Granit bildet den Schauplatz von Debussys Oper in Zürich. Die Naturszenen sind durchwegs in Grotten verlegt, die durch Wellblechwände abgeschlossen werden. Und vor allem liegt überall Schnee, der Schnee jener Krankheit, die zum Tode führt. Erstarrung noch und noch, was dadurch unterstrichen wird, dass die Figuren des Dramas nicht nur durch die Darsteller, sondern zusätzlich durch ihnen nachgebildete, in Rollstühlen placierte Puppen personifiziert werden. Stimme und Figur stehen so nebeneinander, was dann noch zugespitzt wird, wenn sich ein Darsteller an eine Puppe wendet, die Antwort aber von einem anderen Darsteller kommt. Das einzige Zeichen des Lebens führt der kleine Yniold (Eva Liebau) mit sich; es ist eine goldene Kugel, die sich Mélisande am Ende aneignet und mit der sie über ihren Tod hinaus spielt.
So gut das klingt, so sehr führt es freilich in die Irre. «Pelléas et Mélisande» ist nicht das Stück hinter Eis und Glas, das uns diese Produktion vorspiegelt, vielmehr ist hier die Rede von Liebe, Mitleid und Hoffnung. Das wird in Zürich ausser acht gelassen. Dafür gefällt sich die Inszenierung in einem späten Anklang ans Regietheater. Der Turm, aus dem Mélisande ihre überlangen Haare auf Pelléas niederfallen lässt, ist hier eine Zitrone, ein Citroën DS - der Gag ist nicht mehr als ein Gag und zudem merklich verbraucht, aber Debussys Oper gilt bekanntlich als ein Meisterwerk des Symbolismus. Im Übrigen übt man sich im Rampensingen und in jener tautologischen Gestik, die ihren Höhepunkt dort findet, wo Mélisande zu der Bemerkung, ihr Kleid sei zerstört, ein Stück Seide zerreisst. Profil finden die Figuren keines, und zu einer interpretatorischen Aussage, die über die dekorative Szenerie hinausreichte, kommt es ebenso wenig. So ist es offenbar, wenn sich der Schauspieler Sven-Eric Bechtolf der Oper zuwendet. An der mässig, nach der Pause noch mässiger besetzten Premiere erhielt er ein Buhkonzert - das nun wieder jedermann in seiner Weise interpretieren kann.
Peter Hagmann
|

16. 11. 2004
Blühende Musik, erstarrte Welt
Debussys «Pelléas et Mélisande» am Opernhaus Zürich
Mit «Pelléas et Mélisande» konnte sich Dirigent Franz Welser-Möst in Zürich einen lang gehegten Wunsch erfüllen. Die Musik blühte denn auch, doch die Bühne war in Eis erstarrt.
VERENA NAEGELE
Claude Debussy fühlte sich nach eigener Aussage durch die «traumhafte Atmosphäre» des Pelléas-Dramas von Maeterlinck, das «bei weitem mehr Menschlichkeit enthält als all die sogenannten lebensechten Stoffe», zu seiner einzigen Oper inspiriert. Sie lebt vom Andeuten und Verschleiern, vom symbolistischen Vernebeln, bei dem die Musik das Unausdrückbare in einem steten Blühen umspielt.
Franz Welser-Möst liegt solche Musik, er lotet mit dem Orchester den musikalischen Duktus dieser Traumsprache wunderbar aus und verhilft der kammermusikalischen Faktur mit blitzsauberen Bläsern und weichen Streichern zu Transparenz und klanglicher Dichte. Ihm gelingt ein grossformaler Bogen von der emotionslosen, schwebenden Zurückhaltung des ersten Teils in einem langgezogenen Crescendo hin zum wütenden Ausbruch des eifersüchtigen Goleaud. Mit dramatischer Verve präsentiert Michael Volle dabei ein faszinierendes Rollenporträt.
Berückendes Ensemble
Die Stimmen sind hervorragend aufeinander abgestimmt, und sie werden in ihrem melismatischen Parlieren vom Orchester strukturiert getragen. Hoch und fahl in der Tessitura Rodney Gilfry als Pelléas. Laszlo Polgar mit schwarzem Bass als Arkel und Cornelia Kallisch mit dunklem Timbre als Geneviève verhörbildlichen das Absterben des Alters. Am schwersten hat es Isabel Rey als naiv-entseelte, puppenhafte Mélisande. Mit schön geführter, schlanker Stimme singt sie sich farbenreich durch die eindimensionale Figur.
Regisseur Sven-Eric Bechtolf traut dem von Debussy heraufbeschworenen menschlichen Mysterium nicht mehr, er stellt die «Décadence absolue» in den Vordergrund seiner Inszenierung. Nichts gedeiht mehr, keine Blumen, keine Farben, wiewohl im Stück permanent beredet. Die Bühne (Rolf Glittenberg) wird nach vorne begrenzt durch eine graue Turmfassade, die die entseelten Figuren gefangen hält. Hebt sich dieser undurchdringliche Wall, gibt er den Blick frei in eine dreigeteilte, überschneite Skulpturenlandschaft.
Puppen-Spiel
Die Regie konterkariert so Debussys «Menschlichkeit», es entsteht eine befremdende Diskrepanz zwischen farbigem Orchester und erstarrtem Geschehen. Jede Figur des Stückes erhält ein wächsernes Pendant in Lebensgrösse, Spielzeuge, die den Platz des «Originals» einnehmen. Goleaud schleudert seine scheinbar abtrünnige Mélisande(-Puppe) an den Haaren durch den Raum oder reisst in seiner Wut Söhnchen Yniol den Arm ab. Die Puppen, eine Meisterleistung der Werkstätten des Opernhauses, gemahnen an Pop Art, ebenso das weiss überzuckerte Citroën-Kultauto.
Es ist wohl das stimmigste Bild des Abends, wenn Mélisande, auf dem Autodach liegend, ihr Haar über den halb im Auto sitzenden «Geliebten» ergiesst und dieser das prächtige schwarze Haar im Türrahmen einklemmt. Wie immer gelingen Sven-Eric Bechtolf eindrückliche, liebevoll ausgespielte Szenen. Und doch ermüdet der schneeweiss-graue Abend auf die Länge, man schliesst die Augen und lässt sich durch das Farbenspiel und Wabern des Orchesters und das nuancierte Parlandosingen der Sängerinnen und Sänger dem Ende entgegentragen. Nicht zu glauben, dass der Abend für alle ein Rollendebüt war.
|

16. 11. 2004
Eine heisse Traumwelt aus Eis
Debussys «Pelléas et Mélisande» provoziert und erfreut gleichermassen das Publikum in Zürich
Das Opernhaus Zürich verwöhnt das Publikum mit Premieren auf hohem Niveau. Und am Sonntag gab es eine Sternstunde, als unter Franz Welser-Möst «Pelléas et Mélisande», Claude Debussys einzige Oper, aufgeführt wurde.
Von Reinmar Wagner
Nicht jeden Geschmack im Publikum traf Bechtolf mit seinen Bildern, dafür traf er andere ins Herz. Der Citroën war doch einigen zu viel des Guten: Die Reihen im Publikum lichteten sich nach der Pause merklich, und am Ende galt der Applaus fast uneingeschränkt den Sängern und ganz besonders dem Dirigenten Franz Welser-Möst und dem Zürcher Opernorchester. Beim Regieteam hingegen waren die Meinungen stark geteilt. Kein Zweifel, diese Inszenierung polarisiert. Eine heftige Buh- und Bravoschlacht entlud sich über Sven-Eric Bechtolf, den Bühnenbildner Rolf Glittenberg und die Kostümschneiderin Marianne Glittenberg.
Berauschende Bilder
Dieser «Pelléas» hat zweifellos nichts Konventionelles. Bechtolf ist zu den symbolistischen Tiefenschichten des Stoffs von Maurice Maeterlinck vorgestossen und hat Debussys Drama von der Unwirklichkeit einer entlegenen Märchenwelt im Wald von Allemonde in die eiskalte Unwirklichkeit eines Traums entrückt. So etwas ist schnell behauptet und als Idee auch durchaus naheliegend und somit für sich selbst kein besonderes Verdienst einer Inszenierung.
Auf die Umsetzung kommt es an, und da zeigt sich in den Details, in der Personenführung, in der Konsequenz der aufgezeigten Ideen, was sich ein Regisseur wirklich überlegt hat und welche Überzeugungskraft er bei den Sängern ins Spiel bringen konnte. All das ist Sven-Eric Bechtolf mit berauschender Meisterschaft gelungen. Da war nicht nur der Citroën, da gelangen starke Bilder, wenn Mélisande triumphierend auf seinem Dach steht, wenn Pelléas ihre Haare mit der Türe verklemmt, wenn Golaud aus dem gleichen Wagen aussteigt, plötzlich da, immer da, wie im Traum. Es braucht keine logischen Abfolgen, im Traum ist alles möglich und so entscheidet die Stärke und Suggestivkraft der Bilder über eine solche Inszenierung: Stark waren sie, die Bilder: Eine kalte, tote Welt, nicht Natur, nicht Wald, sondern Schnee und Eis und die immerwährende Sehnsucht nach Licht und Wärme zieht sich wie ein roter Faden durch diese Eiswelt.
Die Drehbühne wird zum unwirklichen Raum ohne Ausgang und Fluchtmöglichkeit: Jeder Ausbruck führt nur im Kreis herum, eine Aussenwelt gibt es schon gar nicht, so wie ein Traum nur das Aufwachen als Ausflucht kennt. Aber das gibt es nur um den Preis des Lebens: Wer drin ist, bleibt drin, nur Mélisande, das zeigt Bechtolfs Schlussbild wunderschön, gelingt im Tod der Ausbruch, die Befreiung, das Glück.
Das blühende Orchester
Auch sonst pflegt Bechtolf meisterhaft die Details und eine ausgearbeitete, bei aller Traumseligkeit überaus dramatische Personenführung, akzentuiert noch mit einem überaus sinnvollen Kunstgriff: Die Figuren werden durch Puppen verdoppelt, was vielschichtige Beziehungen untereinander verdeutlicht: Wie begegnet man dem eigenen Ich, wie dem anderen Ich des anderen. Ambivalente Emotionen und die inneren Beweggründe der Figuren werden auf diese Weise bezwingend sichtbar gemacht, und da Bechtolf auf der anderen Seite das Drama mit grosser Naturalistik und Dramatik erzählt, die Liebesszenen, die Ängste, die dramatischen Ausbrüche, den Mord und das Sterben Mélisandes drastisch deutlich inszeniert - eine grelle Schärfe, die wir auch aus unseren Träumen kennen -, ergeben sich die vielseitigsten und für das Stück befruchtendsten Spannungen aus dieser Arbeit.
Freilich verlangte Bechtolf damit einiges von den Protagonisten, aber nichts, was diese nicht einzulösen gewusst hätten. Rein sängerisch betrachtet jedoch war nur Michael Volle als Golaud wirklich traumhaft. Einmal mehr sang der deutsche Bariton das packende Porträt eines schwierigen, zerrissenen Charakters und das mit stimmlich reichen, klangfarblich bezaubernden Mitteln und grosser Mühelosigkeit, was Kraft und Ausdauer betrifft. Isabel Rey als Mélisande gelang ebenfalls eine überzeugende, anrührende Darstellung sowohl als Figur wie als Sängerin, ausser, dass ihr die Debussy-Farben nicht so mühelos über die Lippen kamen.
Rodney Gilfry als Pelléas war darstellerisch präsent, sein Singen allerdings litt noch stärker unter einem Mangel an Farben und am Ende auch an Strahlkraft und Intensität und zudem unter Schwierigkeiten mit den hohen Lagen dieser Partie. Nobel, mit leicht störendem Akzent, sang Lászlê Polgár den König Arkel, berückend und vielversprechend die junge Eva Liebau den Yniold.
Was bei den Sängern an Farben teilweise fehlen mochte, das blühte aus dem Orchester dafür umso schöner auf: Welser-Möst führte das Zürcher Opernorchester in dieser überaus schwierigen, von Klippen jeglicher Art durchdrungenen Partitur, wo jedes Detail seinen genau austarierten Platz hat, zu einer schlicht sensationellen Umsetzung. Unglaublich, welchen Reichtum an Details und Klangfarben er aus diesem Kollektiv herauslocken konnte, unglaublich wie subtil und unermüdlich er die dynamischen Feinheiten, die Takt für Takt, Phrase für Phrase ihre genau gewichteten Abstufungen haben, herausarbeitete und auf dieser Basis zu einer suggestiven Umsetzung der Partitur kam, die auf diese Weise selber zum instrumentalen Theater von grösster Spannung, Dramatik und Delikatesse wurde.
|

16. 11. 2004
Vom schwierigen Umgang mit einem Märchen
Nach 29 Jahren zeigt das Zürcher Opernhaus erstmals wieder Claude Debussys Meisterwerk «Pelléas et Mélisande». Als romantische Oper.
Von Susanne Kübler
Es hat jahrelange «leidenschaftliche Pilgerfahrten» nach Bayreuth gebraucht, bis sich Debussy von Wagner lösen konnte, bis er dessen Werk als «Schlussstein» erkannte, als etwas, das nicht weiterzuführen ist. «Folglich sollte man seine Erkundungen jenseits von Wagner treiben und nicht in seinem Schlepptau», schrieb Debussy - und tat 1902 genau das mit dem Drame lyrique «Pelléas et Mélisande», komponiert nach dem gleichnamigen Drama von Maurice Maeterlinck.
Wie viel Wagner sich trotzdem noch in seiner Partitur finden lässt, ist nun in der Zürcher Aufführung nicht zu überhören. Selten werden Debussys Traumklänge so direkt, so körperhaft gespielt; die Musik fliesst nicht dahin, sie wird getrieben, gestaltet, auf ihre Emotionalität hin abgehorcht. Behutsam zwar: Franz Welser-Möst kennt die Bedeutung der Stille in diesem Werk, er nimmt die Partitur in all ihren Details ernst, und das Orchester der Oper verfügt über einen irisierenden Pianoklang. Aber wenn sich die Musik etwa im Vorspiel zum vierten Akt vor lauter Wallen und Schwellen kaum mehr bändigen lässt, dann hört man unweigerlich zurück zu Wagner - und nicht vorwärts zu jener märchenhaften, zutiefst französischen Leichtigkeit, die mit diesem Werk ihren Einzug hielt in die Musikgeschichte.
Handfestes Eifersuchtsdrama
«Pelléas et Mélisande» als romantische Oper: Diese Sichtweise unterstützt auch Regisseur Sven-Eric Bechtolf, der mit Welser-Möst schon diverse Male gut zusammengearbeitet hat. Die nur in Andeutungen erzählte Geschichte der rätselhaften Mélisande, die Golaud heiratet, aber dessen Halbbruder Pelléas liebt, wird bei ihm zum handfesten Eifersuchtsdrama. Zwar hat er sich von Rolf Glittenberg eine zauberhafte Schneelandschaft bauen lassen, in der sich aussen und innen, Natur und Architektur, reale und emotionale Kälte in raffinierter Weise mischen - aber es sind Menschen aus Fleisch und Blut, die sich darin bewegen.
Daran ändern auch die Puppen-Doppelgänger nichts, die sich (auch in diesem Haus) schon in so mancher Inszenierung bewährt haben und einmal mehr dafür sorgen sollen, dass Unausgesprochenes sichtbar und Ausgesprochenes hinterfragt werden kann. Am Anfang läuft der Dialog zwischen den Protagonisten, der ja schon bei Maeterlinck kein wirklicher ist, ausschliesslich über die Puppen; wenn der Regisseur nicht Bechtolf hiesse, könnte man nach dem ersten Akt eine Wette abschliessen, dass es so weitergeht, bis sich die Liebenden Pelléas und Mélisande dann als Einzige «richtig» begegnen.
Ganz so einfach ist es dann doch nicht. Das Spiel mit Nähe und Distanz, das in diesem Werk so zentral ist, wird facettenreich gespielt, und immer wieder erweitern die doppelten Aktionen den Raum der Erzählung. So sind etwa die schlafenden Greise, auf die Pelléas und Mélisande in der Grotte treffen, ihre eigenen Doppelgänger - klarer kann man nicht zeigen, wie unlebbar das Leben auf diesem Schloss ist.
Öfter aber ist der Einsatz der Puppen eher praktisch als Sinn stiftend. Der rasende Golaud kann Mélisande weit textgerechter an den Haaren herumschleudern, wenn sie keine echte Sängerin ist, und der Geruch des Todes sticht Pelléas umso beissender in die Nase, wenn Golaud ihm sein Ebenbild unter einer Gasglocke vorführt. Nur: Ist das wirklich so naturalistisch gemeint? Denn naturalistisch bleiben diese Bilder, trotz ihrer ästhetisch attraktiven Künstlichkeit und manchmal selbst in ihren Symbolen: Das Planeten-Design von Marianne Glittenbergs schönen Kostümen etwa erinnert zumal bei Golaud an die Musterung eines Kampfanzugs.
Der Turm ist auch ein Auto
Auch die Stilbrüche, an sich wirksame Mittel gegen eine Festlegung der Handlung, funktionieren nicht immer. Das zeigte sich bei der Premiere am Sonntag insbesondere in der zentralen Turmszene: Mélisandes Turm ist ein Auto - und das Publikum hat gelacht. Das ist das Schlimmste, was in einer Aufführung dieses Stücks passieren kann. Komik, zumal unfreiwillige, ist das Ende jeder Märchenhaftigkeit, und wenn Pelléas Mélisandes Haare im Autofenster einklemmt, um sie festzuhalten, dann wird noch dem letzten Rest Poesie der Garaus gemacht.
«Pelléas et Mélisande» ist zweifellos eines der schwierigsten Werke für einen Regisseur. Eine reine Abbildung des Geschehens nimmt der Musik jene Freiheit, ohne die sie langweilig wird; Symbole gibt es schon im Text so viele, dass auch eine symbolhaltige Bildersprache scheitern muss; wie in fast jeder Oper geht es auch hier um Liebe und Hass, um Todesangst und Todessehnsucht, aber die Gefühle sollen wirken wie neu. Es gilt, das Geschehen mittels Menschen und Materialien, die den Gesetzen der Schwerkraft gehorchen, in der Schwebe zu halten: Die Fälle, in denen das misslingt, sind weit häufiger als die anderen (zu denen etwa Joachim Schlömers klug choreografierte Basler Inszenierung in der letzten Saison zu zählen wäre).
Lauter Rollendebüts
Dass Bechtolfs Inszenierung trotz aller Schwierigkeiten immer wieder unter die Haut geht, liegt vor allem an der Konsequenz, mit der sie am gleichen Strick zieht wie die Musik; auch wenn das Geheimnis gelegentlich fehlt, es funktioniert doch immerhin das Drama. Dafür sorgen auch die Sängerinnen und Sänger, die allesamt ihr Rollendebüt geben: Isabel Reys Mélisande ist keine rätselhafte «femme fragile», sondern eine gefühlvolle Frau, die weiss, was sie tut, und ihre Antworten mit lyrischem, intensivem Sopran verweigert.
Rodney Gilfry als Pelléas wirkt weniger greifbar, einerseits dank seinem leichten, in der Höhe allerdings hauchigen Bariton, andererseits im Kontrast zu Michael Volles Golaud, der seine tödliche Eifersucht mit geradezu belcantistischer Dramatik heraussingt. László Polgárs Arkel wird mit seinem väterlichen Bass im Lauf der Aufführung zunehmend zum Sympathieträger, Cornelia Kallisch beeindruckt als Geneviève vor allem mit ihrer sonoren Tiefe, und Eva Liebau gibt ihren Einstand im Zürcher Ensemble als Knabe Yniold mit wunderbar reiner, heller Stimme: In ihrer Erzählung von den Schafen gleitet das Stück in jene Sphäre des Irrealen, die Debussy vorgeschwebt hatte.
Ein Teil des Publikums hat das allerdings nicht mehr mitbekommen. Selten gab es nach der Pause so viele leere Plätze wie hier. Zu wenig romantisch sei es, war im Foyer verschiedentlich zu hören - und im Vergleich zu den Werken und Inszenierungen, die sonst auf diese Bühne kommen, stimmt das zweifellos. Es ist alles eine Frage der Perspektive.
|

16. 11. 2004
Liebe und Tod im eisig-kalten Raum
Opernhaus Zürich: Premiere von Debussys «Pelléas et Mélisande» mit Franz Welser-Möst am Dirigentenpult
Die Erwartungen, die man an die Zürcher Neuproduktion von Debussys einziger Oper «Pelléas et Mélisande» hatte, waren hoch. Wenn jemand aus dieser symbolistischen und unterschwelligen «Antioper» etwas herauszuholen vermag, dann Sven-Eric Bechtolf mit seinem Ausstattungsteam.
Zudem war man gespannt, was Franz Welser-Möst mit dieser kammermusikalischen Ausdrucksintensität anfangen würde. Die Premiere am Sonntag offenbarte ein musikalisch und sängerisch grossartiges und geheimnisvoll vielschichtiges Tongemälde, welches die Regie mit «eisigem» Einheitsbühnenbild zu stark unterkühlte.
Gegenpol zu Wagner-Opern
So sehr Debussy Wagners Musikdramen bewunderte, er wollte dazu unbedingt einen Gegenentwurf machen. Dafür lieferte ihm der belgische Dichter Maurice Maeterlinck, der Wortführer der Symbolisten, die ideale Textvorlage. Keine äussere Handlung mehr, keine Leitmotive und kein Aufbrausen des erregten Orchesters. Seelische Regungen sollten verinnerlicht werden, symbolisiert in den Protagonisten und im Wort. Und auch wenn in diesem fünfaktigen Drame-lyrique sich so gut wie nichts entwickelt, zum Schluss gibt es darin doch zwei Tote - natürlich das Liebespaar.
Eigentlich geht es in «Pelléas et Mélisande» um eine banale Dreiecksbeziehung. Mélisande hat sich, verängstigt und verwirrt, im Wald verlaufen. Als sie Golaud, der im Wald auf der Jagd ist, findet, verliebt er sich sogleich in sie. Ihre Herkunft und ihre Identität bleiben rätselhaft, sie ist und bleibt die reine Unschuldsseele.
Eine Dreiecksgeschichte
Als sie Golaud heiratet und auf das uralte und düstere Schloss Allemonde bringt, verliebt sich Mélisande in den jüngeren Halbbruder von Golaud, in Pelléas. Diese Liebe bleibt unausgesprochen, doch ist sie hintergründig in der Musik deutlich spürbar. Auch wenn sich die beiden Liebenden nie intim begegnet sind, steigert sich die Eifersucht von Golaud bis hin zum Mord am Halbbruder.
Die Musik tritt in diesem symbolistisch entrückten Seelengemälde stark in den Vordergrund. Sie wird direkt aus dem Sprachfluss und Sprachklang des Französischen heraus entwickelt und ist kammermusikalisch fein und intensiv. Farbenreiche Bläserpartien wechseln mit dichten und zum Teil stark dissonanten Streicherklängen, die unaufgelöst stehen bleiben. Die Bedeutung der entrückten Traum-Sprache findet hier ihre intensive und sehr genaue Auslotung. Franz Welser-Möst gelang es, die Intimität und die Kraft dieser kammermusikalischen Fraktur bis ins Detail auszudeuten. Die Bläser mischten sich leuchtend und dunkel in allen Farben, und die Dissonanzen wurden dramaturgisch effektvoll zugespitzt.
Am Stück vorbei inszeniert
Regisseur Sven-Eric Bechtolf schien von dieser intensiven Musik gänzlich unberührt. Er schrieb sich in erster Linie die Undramatik, die man Debussy von Beginn weg vorwarf, auf sein Regiebanner. Seine «Pelléas et Méliasande» spielt sich in einem ästhetisch schönen, dreiteiligen Drehbühnenbild von Rolf Glittenberg ab: in grauen Mauern, einengenden Gängen und eisigem Schnee. Nirgends ein Baum, kein Anzeichen von Wald, kein Garten, und auch das Wasser, das erquickende wie das abgrundtiefe, ist eingefroren.
Damit verzichtet Bechtolf gänzlich auf die Natursymbolik, die für Debussys Musikverständnis doch von zentraler Bedeutung war. So modern surreal die von Marianne Glittenberg auf den Kostümen abgebildeten Kraterlandschaften von Planeten wirken, und so reizvoll die alte Citroën-Limousine im Schneegestöber an Stelle des dunklen Gartens ist, die Symbolik ist eine ganz andere.
Regie spielt mit Puppen
Ein dramaturgisch wirkungsvoller Einfall sind jedoch die Puppen, die Bechtolf zu jeder Figur als naturgetreues Abbild anfertigen liess. Mit diesen Doppelgänger-Puppen gelingt ihm eine sinnbildliche Auflösung der Identitäten, und die Erweiterung der statischen Szenerie um eine ganze Spielebene. So hält zum Beispiel Golaud die Mélisande-Puppe im Arm, während Isabel Rey zusammengekauert in einer Ecke die Partie singt. Die schaupielerische Präsenz, die dadurch von allen Protagonisten gefordert wird, ist beträchtlich.
Zu diesem «Schauspiel» passt der Parlando-Gesang, in welchem sich die Sängerinnen und Sänger entfalten. Dabei bot ihnen die Musik aus dem Orchestergraben eine eng am Wort orientierte Stütze. Dieses Ineinander von Instrumentalem und Vokalem gelang mit Bravour. Eine grossartige Leistung vollbrachte Michael Volle als abgründiger Golaud. Seine Bühnenpräsenz und schauspielerische Ausdruckskraft stand seiner stimmlichen Grösse und Intensität in nichts nach. Als sinnbildlicher Kontrapunkt dazu ist die mörderisch hoch gesetzte Baritonpartie des Pelléas gedacht, mit welcher Rodney Gilfry dem düsteren Geschehen - trotz vereinzelter Schwierigkeiten im Grenzbereich - eine lichte Note verlieh.
Rollenbesetzung überzeugte
Isabel Rey hatte die undankbare Aufgabe, die kindliche und doch geheimnisvolle Unschuldsseele der Mélisande zu verkörpern. Sie tat dies mit sinnlicher Farbgebung und schlanker Stimmführung. Dazu setzte Cornelia Kallisch mit dunkel abgerundeter Altstimme eine erdige Mutter Geneviève. Der helle und glockenreine Sopran von Eva Liebau, die den Knaben Yniold mit betörender Naivität sang, passte ausgezeichnet dazu. Von besonderer Klarheit und markanter Männlichkeit war die Basspartie von Lászlê Polgár, der dem König Arkel eine berührende Menschlichkeit verlieh.
Wie subtil sich die Sänger, die allesamt ihr Rollendebüt gaben, mit dem Orchester im Zwiegespräch entfalteten, das war die grossartige Seite dieses szenisch zu unterkühlten Abends, der vor allem im zweiten Teil einfach kein Ende nehmen wollte.
Sibylle Ehrismann
|
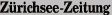
16. 11. 2004
Vereiste Seelen in Gefrierräumen
Am Opernhaus inszenierte Sven-Eric Bechtolf Debussys einzige Oper «Pelléas et Mélisande»
Alles ist Symbol: die Bühnenräume, die Menschen, ihre Gefühle und Stimmungen. Traumhaft und gleichzeitig derart lebenswahr, dass sich im Publikum viele provoziert fühlten, die Aufführung in der Pause verliessen oder sie zurn Schluss verärgert verbuhten. Ein Missverständnis: Diese Inszenierung setzt neue Richtlinien in der Rezeption des Werks.
WERNER PFISTER
Es scheint, dass Missverständnisse seit eh dazu gehören. Zwei Wochen vor der Uraufführung seiner Oper «Pelléas et Mélisande» (im April 1902) hiess es in der Pariser Presse, Claude Debussy habe Selbstmord begangen. Dabei hatte er nur eine Duellforderung abgelehnt - allerdings eine Duellforderung ausgerechnet seines Librettisten Maurice Maeterlinck. Der Grund: eine Frau. Genauer: die Sängerin der Mélisande. Maeterlinck wollte seine Gefährtin Georgette Leblanc durchsetzen, Debussy war dagegen, worauf Maeterlinck in «Le Figaro» einen offenen Brief an den Komponisten veröffentlichte, der mit den absurden Worten schloss: «Ich wünsche dem Werk einen vollständigen Misserfolg.»
Das war das erste einer Reihe von Missverständnissen, welche seither Debussys einzige vollendete Oper verfolgen (er versuchte sich insgesamt an über vierzig Opernprojekten). Das zweite war die negative Reaktion auf die durch Zwischenrufe und andere Missfallenskundgebungen mutwillig gestörte Uraufführung. «Kränklich und ohne Rückgrat» las man tags darauf in der kritischen Tagespresse. Was in der Sache halbwegs richtig, in ihrer Wertung aber völlig falsch ist.
Nervenkunst
Richtig ist, dass dem Drama Maeterlincks das herkömmliche Rückgrat fehlt, nämlich eine Handlung. Was sonst essentiell äusserliches Geschehen ist, verlegte der Dichter ganz ins Innere seiner Figuren, was durchaus dem impressionistischen Lebensgefühl der damaligen Jahrhundertwende entsprach: Die Welt wird nicht als Ausdruck, als objektivierbares Gegenüber erfahren, sondern ausschliesslich als Eindruck und somit als Teil der eigenen Subjektivität. Man hat in diesem Zusammenhang treffend von «neu-romantischer» Kunst gesprochen, könnte noch treffender von «neuro-mantischer» Kunst reden, von Nervenkunst also - eine Begriffsbildung freilich, «von der zum Ruf nach dem Nervenarzt und der Einweisung in die Irrenanstalt der Schritt nicht mehr allzu gross ist». (Peter Szondi)
Das hat Folgen für die Oper Debussys. Maeterlincks Gestalten sind keiner psychologischen Entwicklung unterworfen und haben keinerlei Einsicht ins schicksalhafte Weltgeschehen; sie agieren nicht, sondern reagieren nur auf Gegebenes, gefangene Seelen alle. Zum Ausdruck kommt das in Maeterlincks Sprache, poetisch derart dicht und trunken von atmosphärischen Klängen, dass sie das eigentliche Drama darin gleichsam ertränkt. Dazu hat Debussy eine «musique de silence» erfunden, hat die Pause, das Schweigen, als Gestaltungsmittel entdeckt, und er lässt die Musik nur dort wirklich eingreifen, wo es um Unaussprechliches geht, wo Worte versagen.
Lebenswinter
Wie aber visualisiert man eine Welt, die sich derart konsequent der Objektivität verschliesst und sich ganz ins Subjektive zurückzieht? Bühnenbildner Rolf Glittenberg gibt darauf Antwort ganz aus dem Zeitgefühl der Entstehungszeit der Oper heraus: mit symbolischen Räumen nämlich, die nicht das Gegenständliche dessen meinen, was sie darstellen (oder eingrenzen, umschliessen resp. offen lassen), sondern darüber hinausweisen. Es sind subjektive Räume, reine Gefühlswelten - allerdings eine Welt gefrorener Gefühle. Lebenswinter sozusagen.
Eine mächtige Mauer wächst in endlose Höhe und begrenzt die Bühne nach hinten in einem Halbrund. Gleichzeitig lässt sie durch eine Bogenöffnung, abermals im Halbrund, einen Blick nach hinten frei in die (räumliche) Tiefe, wo erneut durch zwei im Halbrund geformte Mauern je eigene Raum- oder Gefühls- oder Bewusstseinsbezirke eingegrenzt werden. Diese sind auf einer Drehbühne aufgebaut, was den vielen Szenenwechseln in dieser Oper (bei offenem Vorhang) ideal entgegenkommt.
Licht gibt es vor allem als Hell-Dunkel-Kontraste; die weisse Schneelandschaft reflektiert und blendet. Und nur selten mischt sich ein Farbton dazu: ein tiefblauer beim Gang in die Grotte, beim Heruntersteigen in die Schlossgewölbe (ins unterirdische Bewusstsein), ein blutroter in der Szene im vierten Akt, wo Yniold abends den vorbeiziehenden Schafen nachblickt, die alle den falschen Weg gehen: nicht zum Stall zurück nämlich, also wohl zur Schlachtbank.
Endzeitgesellschaft
Solche Räume veranschaulichen das Ausgesetztsein der hier ihr Leben fristenden Menschen auf beklemmende Weise. Gefangene Seelen sind sie alle, eingekerkert in ihrer eigenen Subjektivität und also nicht fähig zur Kommunikation mit einem Gegenüber. Mit wem sie auch sprechen - sie erreichen nie den andern, sondern kommunizieren (gleichsam im Selbstgespräch) nur mit der je eigenen Vorstellung dieses Anderen.
Regisseur Sven-Eric Bechtolf visualisiert diese egomanische Befindlichkeit in Form einer Endzeitgesellschaft, die bereits in Rollstühlen sitzt, bald am Ende ihrer Welt-Träumereien ist und damit das Ende dieser Welt auch schon ahnen Iässt. Und er visualisiert es durch ein subtil inszeniertes Spiel mit Puppen. Das mag, auf den ersten Blick, unsere herkömmliche Optik verstören: Wenn Pelléas zu Beginn der Oper Mélisande trifft, die, mit dem Rücken zum Publikum, auf einem Schiff sitzt, und er mit ihr zu sprechen beginnt, tritt gleichzeitig die «Iebendige» Mélisande auf. Denn Pelléas spricht zu einer Puppe auf dem Schiff - nämlich zu seiner Projektion einer Mélisande.
Ausgellefertsein
Mit solchen subjektiven Projektionen ist die Bühne voll, und mit ihnen, den «Doppelgängern», und den lebendigen, den «eigentliche» Menschen, spielt Bechtolf nun ein faszinierendes, ungemein suggestives Spiel ums Vorhanden- und Nichtvorhandensein von Realität, um die psychologisch so komplexen Beziehungen zwischen Traumverlorenheit und Lebenswahrheit, um das Ausgeliefertsein dem eigenen Unbewussten und dessen Projektionen gegenüber. Und er spielt dieses Spiel, das sei besonders betont, mit einer derart behutsamen Liebe zu den Figuren (anders vermöchte ich es nicht zu nennen), dass diese gerade dort, wo sie den Mitmenschen nicht erreichen, so ungemein menschlich - und darin verletzlich - wirken.
Szenisch umgesetzt wird das von den Sängerinnen und Sängern in einer derart kongruenten Weise, dass selbst der musikalische Eindruck kaum mehr vom szenischen ablösbar ist. So exzellent, wie sie alle ihre Rollen resp. die Innerlichkeit ihrer Rollenbefindlichkeiten ausspielen, so exzellent wirken sie auch als singende Darsteller. Und so fälIt es, eigenartiger Befund, überhaupt nicht ins Gewicht, wenn rein sängerisch ein paar Abstriche gemacht werden müssen.
Bei Rodney Gilfry etwa, dem die Partie des Pelléas zu hoch liegt und der mit seiner markigen Baritonstimme sowohl in der Diktion wie im Timbre kaum über die Geschmeidigkeit eines «Baryton-Martin» verfügt. Isabel Rey tönt als Mélisande - anfänglich mit nur knapp kontrolliertem Vibrato - zu entschieden, zu diesseitig, zu geheimnislos, und dennoch verleiht sie dieser Figur Züge einer anrührenden, mädchenhaften Traumverlorenheit.
Ereignishaft
Einen grossen Abend hat Michael Volle als Golaud, weil er nicht nur mit kräftigem Bariton auftrumpft, sondern gleichzeitig seine Verletzlichkeit, seinen weichen inneren Kern, gleichsam auf der Stimme trägt. Famos. Laszlo Polgar singt den abgeklärten, halbblinden Arkel mit balsamischem Bass: fast ein Vorecho auf eine Zeit, wo alles gestorben sein wird und friedlich ruht. Ebenso eindringlich agieren Cornelia Kallisch als Geneviève und Eva Liebau als Yniold. Für sämtliche Sängerinnen und Sänger übrigens ein Rollendebüt.
Und einen ganz grossen Abend hatte Franz Welser-Möst und mit ihm das Orchester der Oper Zürich. Wann je hat man Töne von solch fein ziselierter Fragilität gehört, immerr näher am Verstummen als am Aufbauschen? Dass weniger in der Tat mehr ist, dass Debussys Musik gleichsam die luzid transparente Sprache einer fein linearen Anspielung spricht und nicht mit kräftig geführtem Pinsel abmalt, was eh auf der Bühne vor sich geht, das wird in dieser Aufführung ereignishaft deutlich und zeigt die zukunftsweisende Bedeutung dieser Musik - und überhaupt dieser Oper - in hellstem Licht. Wie gesagt, diese Neuinszenierung setzt neue Richtlinien in der Rezeption des Werks.
|
 16. 11. 2004
16. 11. 2004
Mélisandes Winterreise
VON WILHELM SINKOVICZ
Wiens künftiges "Ring"-Team produzierte in der Zürcher Oper Debussys "Pelléas". Eine Sensation.
Pelléas und Mélisande" ist eines jener Werke, für die cum grano salis gilt, was Lessing augenzwinkernd über Klopstock geäußert hat. Das Stück wird gern analysiert und in seiner musikhistorischen Bedeutung gewürdigt. Sir Rudolf Bing, der legendäre Manager der Metropolitan Opera, brachte jedoch die Einstellung des Publikums auf den Punkt: In der Pause von Debussys Oper gingen die Leute etwas trinken und kämen zum zweiten Teil nicht wieder.
Seit Sonntag ist alles anders. Für diese Generation hat das Zürcher Opernhaus "Pelléas und Mélisande" gerettet. Dem künftigen Wiener Team für Wagners "Ring des Nibelungen", Dirigent Franz Welser Möst, Regisseur Sven-Eric Bechtolf und dem Ausstatterpaar Glittenberg, gelang die Umwertung aller Werte. "Pelléas" ist, das weiß man jetzt, das spannendste aller musiktheatralischen Psychodramen. Man muss nur die Partitur genau lesen und den Text in seiner Vielschichtigkeit plausibel machen.
Beides ist in Zürich geschehen. Vor allem die musikalische Leistung ist stupend. Vom ersten Ton an wird klar, dass Welser-Möst und das Zürcher Orchester nicht daran denken, sich in jene liebliche Pastell-Welten zu flüchten, mit denen vordergründig aus dieser heiklen Partitur so hübsche Effekte geschlagen werden können. Hier verschwimmt nichts, hier werden die immer neuen, erstaunlich modernen Klang-Experimente Debussys penibel realisiert, auch dort, wo statt eitel Wohlklang scharfe Kontraste, grelle, ätzende, keuchende, schneidende Bilder entstehen, um Schlaglichter auf die Befindlichkeit der handelnden Personen zu werfen.
Jede Phrase, jeder Ton ist mit Energie, mit Ausdruck aufgeladen. Die Musiker formen immer neue, intensive Steigerungswellen, am intensivsten dort, wo es ganz leise zugeht, wo die Emotionen sich subkutan entfalten; unterdrückte, doch immense Leidenschaften. Immer wieder reden die Personen in Maeterlincks Drama aneinander vorbei, jeder für sich, ein Gegenüber meinend, das real nicht existiert.
Da verknüpfen sich oft zwangsläufig mehrere voneinander unabhängige musikalische Entwicklungen zu komplizierten Klanggeflechten. Debussy wechselt die Beleuchtungen, nimmt Entwicklungen, die jäh unterbrochen schienen, zuweilen wieder auf, als wären sie im Stillen weitergewachsen und brächen mit unvermittelter Intensität plötzlich wieder hervor.
Die Szenerie vermittelt die Paradoxa des Werks, die klingend so unausweichlich erfahrbar werden, mit einer kongenialen Bildsprache. Rolf Glittenberg stellt die Handlung in eine neue Eiszeit, das Schloss ein kahler, grauer Bunker, die Natur von Schnee bedeckt, gefroren - freilich, wie in Schuberts Winterreise schwellen die Fluten unter dem Eis glutvoll.
Regisseur Bechtolf zeigt uns die Beziehungslosigkeit, indem er die Figuren mit Puppen verdoppelt. In der Regel spricht mit einer leblosen Kopie, wer zum andern zu reden scheint. Autismus. Seltene Momente direkter Dialoge werden zu schmerzvollen Erfahrungen. Kaum je war die Doppelbödigkeit von Maeterlincks Text so unmittelbar erfahrbar, wurde die Brutalität Golos gegenüber der unglücklichen schweigsamen Frau so ungeschminkt sichtbar. Selten auch hat ein Bühnen-Blick solche emotionale Kraft wie jener zwischen Pelléas und Mélisande, wenn die Musik im entscheidenden Moment völlig verstummt: "Ich liebe dich auch", flüstert Mélisande tonlos. Und was im Orchester immer unausweichlicher zu werden drohte, je leiser die Klänge wurden, wird in der absoluten Stille zum Orkan der Emotionen.
Debussy markiert hier den Gegenpol zur Klimax von Wagners "Tristan"-Duett; und in Zürich lernt man, dass der ebenso aufregend, ja existenziell ist. Ein Wunder, auch weil die Sängerbesetzung beinahe ohne Fehl und Tadel Musik wie Szene zu erfüllen vermag. Gewiss hat Rodney Gilfry, gesundheitlich ein wenig angeschlagen, Mühe mit den höchsten Tönen des Pelléas, ist vielleicht musikalisch eine riskante Besetzung, weil dem Komponisten für seinen Titelhelden eher ein tiefer Tenor als ein Bassbariton vorgeschwebt sein mag. Doch gibt Gilfry den liebenden, zärtlichen, sensiblen Mélisanden-Bruder im Geiste so überzeugend, dass manche ungerade Töne kaum ins Gewicht fallen.
Isabel Rey ist eine warm timbrierte Mélisande, die ihre Emotionen optisch wie akustisch hermetisch abzuriegeln weiß. Wir ahnen beständig, wie hoch es in dieser Seele hergehen mag, doch erreichen uns nur zarte, behutsame artikulierte melodische Schwingungen davon. Sie treiben den drängenden Golo von Michael Volle zur Verzweiflung: Der Bariton setzt gegen die in seinen Szenen oft mächtig anschwellenden Orchesterwellen ebenso mächtige ariose Entfaltungen, die stärksten Vokalmomente der Aufführung jedenfalls.
Laszlo Polgar (Arkel) und Cornelia Kallisch (Geneviève) runden das Ensemble ebenso wie Eva Liebau als kleiner Yniold mit feinfühligen Schattierungen ab. So feierte "Pelléas" seine Wiederauferstehung. Endlich kann man hören und sehen, dass Debussy hier tatsächlich ein Schlüsselwerk der Musikgeschichte geschaffen hat.
|

1. 12. 2004
Debussy und seine Doubles
In Zürich wuchsen Dirigent Franz Welser-Möst und Regisseur Sven-Eric Bechtolf zu einem der wichtigsten Duos des Musiktheaters
von Manuel Brug
Eine ferne Operngalaxie, grauweiß und eiskalt. Hinter einem ausgeschnittenen Halbkreis bogenförmiges Wellblech und eine Kanzel im Kunstschnee. Auf die Anzüge der Männer sind Oberflächenschraffuren von Planeten gedruckt. Stoff, aus dem frösteln machende Märchen sind. So wie das von Pelléas, der Mélisande, die seltsame Frau seines Halbbruders Golaud, liebt. Debussys symbolistisches Meisterwerk scheint gegenwärtig im konjunkturellen Auf: Sven-Eric Bechtolf hat es eben an Zürichs Oper als kühl konzentrierte Kunstübung inszeniert. Und Franz Welser-Möst dirigiert es in diesem Geist.
Ein so kunstvoller wie knapper, sich dem einfachen Genuß verweigernder Abend, erstellt von einem der augenblicklich international interessantesten Musiktheater-Duos neben Peter Konwitschny und Ingo Metzmacher, Jürgen Flimm und Nikolaus Harnoncourt, Peter Mussbach und Kent Nagano, Marc Minkowsky und Laurent Pelly. Die beiden haben sich an der Oper Zürich gefunden, in Alexander Pereiras großem Gemischtwarenladen, der mit dieser Kuppelei endlich einmal eigenes Profil entwickelt hat.
Nach dem Überraschungserfolg mit Bergs "Lulu" als sadomasochistischer Zuchtübung im Jahr 2000 (auch schon mit Puppe) ging Bechtolf - zusammen mit seinem Ausstatterduo Marianne und Rolf Glittenberg, das nach Bondy ebenfalls einen neuen Regisseur gefunden und zur Oper verführt hatte - nur einmal fremd - und griff an der Deutschen Oper Berlin mit den komplexen "Hoffmanns Erzählungen" 2002 voll daneben. Heute sieht er das auch so.
Ein Arroganter, ein Schwieriger, der freilich viel Unsicherheit hinter solchen halbstark-zurückweisenden Gesten verbirgt, ein Unzufriedener auf der Suche nach dem vollkommenen Theaterglück, das es nie geben kann: Das ist der 1957 in Darmstadt geborene, in Hamburg aufgewachsene Bankierssohn Sven-Eric Bechtolf. Als Schauspieler kam er über Zürich, Bochum, zehn Jahre Thalia Theater Hamburg nach ganz oben. Seit 1998 spielt er am Burgtheater Wien. Seine Regisseure hießen Breth, Besson, Berghaus, Bondy, Kriegenburg, Stein, Wilson.
Aber bloß keine Identifikation. Regisseur Bechtolf hält sein Gegenüber auf Abstand. Und sucht den auch in seinen Musiktheater-Figuren. Die zeitweilig im Rollstuhl ihre Seinsverkrüppelungen vorführenden Debussy-Protagonisten sollen in ihrer Traumwelt des Unterbewußten auf Distanz gehalten werden. Auch mit Hilfe Puppen, auf die alle Gefühle projiziert werden zwischen Liebe und Haß, Geburt und Tod - Dummies im emotionalen Crashtest. Debussy und seine Doubles. Zwischen wenigen Requisiten, leeren Aquarien, einem mal weiß, mal schwarz bezogenen Bett, bleibt alles im Frage- und Schwebezustand, wird zeichenhaft, wenn die berühmte, von Golaud belauschte Szene im Turm in und auf einem zugefrorenen Citroen lokalisiert ist. Ein fragil-sprödes Beziehungsgefüge fordert höchste Aufmerksamkeit. Die auch der Schauspieler Bechtolf fordert. Er war oft der Außenseiter, der rebellierend Schwierige. Oder - zuletzt als Fiesco, Philipp II. und Schnitzlers Fabrikant Hofreiter, als Prinz in "Emilia Galotti und, wunderbar boulevardesk, in Jasmina Rezas "Dreimal Leben" - der gebrochene Machtmensch, der verwundete Potentat.
Und er wurde doch zum Wertkonservativen, zum enttäuschten Umstürzler, der kraftvoll ablästerte über den "Qualm, der am Stadttheater aus den Dramaturgien quillt", über "abartige Gedankengebilde", "biedermeierliche Sozialliberale", "Meinungsmüll, dahingelallte Zustandsbeschreibungen", der "Respekt, Geduld, Bildung, Analyse, gesunden Menschenverstand" einfordert.
Ein Waidwunder, Verletzter, in seiner Liebe Verschmähter. Der es, nach ersten Theaterregien in Hamburg und Wien seit 1994, mit Marivaux' "Der Streit" zum Theatertreffen schaffte und - seit 1996 in der Leitung des Thalia Theaters - sich sogar Hoffnung auf die Flimm-Nachfolge machen durfte; doch daraus wurde nichts. In Wien hat Bechtolf zuletzt 2001 mit mäßigem Erfolg Büchners "Leonce und Lena" inszeniert, im letzten Jahr gab es peinsam dramatisierte Lyrik des Pianisten Tzimon Barto in Frankfurt. Jetzt will er am Theater nur noch spielen - und erfährt Regiegenuß in der Oper.
Wahrscheinlich kam die Zürcher Anfrage in einem glücklichen Moment. Für beide Seiten. Hier fand Bechtolf "echte Profis, die etwas können und das auch zeigen wollen", nicht nur "Kleinkunst" mit Akteuren, die höchstens "Dialekte nachmachen und Witze erzählen können". Und wagte das für ihn zunächst Unmögliche. Auch mit dem 44-jährigen Dirigenten Franz Welser-Möst - eben auf dem Absprung nach Cleveland -, der sich in der Schweiz glänzend vom überforderten Orchesterzuchtmeister zum gesuchten Operndirigenten gewandelt hatte, machte es gleich Klick. Zusammen mit dem Szenaristen-Ehepaar Glittenberg, das Bechtolf ins Quartett mit einbrachte, besetzt man eine rare Inszenierungsposition im internationalen, besonders in Deutschland gern auf die Spitze getriebenen Operngewerbe: intelligent, aber nicht umstürzlerisch, eigensinnig und überraschend, aber nicht verbiestert querdenkend, modern, aber trotzdem dem kunstvollen Zauber des Theaters verpflichtet.
"Ich bin ein altmodischer Jockel, ein Reaktionär ohne Antworten und sehe mit einigem Entsetzen, was Mode ist", kommentiert Bechtolf kettenrauchend den Ist-Zustand. Dem er mit Verdis "Otello", Korngolds "Toter Stadt" und dem "Rosenkavalier" in der Schweiz schönste Gegenbeispiele entgegengesetzt hat. Zürich muß ihn sich künftig freilich mit Wien teilen, den Welser-Möst erfährt endlich, von Salzburg bis zur Wiener Staatsoper, in Österreich plötzliche Liebesaufwallung. In der nächsten Saison bringt das Duo an der Donau die "Arabella" von Strauss heraus, ab 2007 startet dort mit der "Walküre" ein neuer "Ring", ganz "ohne Diplomatenkoffer und Großraumbüros". Inzwischen fühlt er sich offenbar wagnersicher, vor zwei Jahren sagte er noch: "Das traue ich mir nicht zu, das erschlägt mich". Die Schweiz wird zwischendurch mit einem neuen Mozart/da Ponte-Zyklus beglückt.
Am Schluß der Zürcher Debussy-Oper trippelt Mélisande übrigens lachend in lila Robe mit einem goldenen Ball davon, ihr totes Double zurücklassend. Eine der vielen Untoten, überlegenen Fantasmagorieren in Sven-Eric Bechtolfs Musiktheaterreich.
|