|
Aufführung
|

22. 6. 2002
(Première)
*
Musikalische Leitung: Michel Plasson
Inszenierung: Peter Mussbach
Bühnenbild: Erich Wonder
Kostüme: Andrea Schmidt-Futterer
Lichtgestaltung: Franz Peter David
Chor: Ernst Raffelsberger
*
Carmen: Luciana d'Intino
Micaela: Elena Prokina
Don José: Julian Gavin
Escamillo: Michele Pertusi
Frasquita: Martina Jankova*
Mercedes: Irène Friedli
Zuniga: Jacob Will
Remendado: Martin Zysset
Dancairo: Peter Kálmán
Morales: Valeriy Murga
*
Statistenverein am Opernhaus Zürich
Chor, Zusatz- und Kinderchor des Opernhauses Zürich,
Orchester der Oper Zürich
|
|
Rezensionen
|
|

24 .6. 2002
Wenn es kalt ist in Sevilla
Festspielpremiere im Opernhaus Zürich: Bizets «Carmen»
«Carmen»: Das war für Zürich zwei Jahrzehnte lang die bilder- und farbenreiche, minuziös realistische Ponnelle-Inszenierung aus der Spielzeit 1981/82. Jetzt ist sie Geschichte. Peter Mussbach (Regie), Erich Wonder (Bühnenbild) und Andrea Schmidt-Futterer (Kostüme) vermitteln eine völlig andere Sicht von Georges Bizets Oper. Bei ihnen gibt es keine Spanien- und Zigeunerfolklore, keine historische Fixierung, keine mediterrane Sonne, keine pittoresken Bilder, auch keine Massenaufzüge (der Chor erscheint nur dort auf der Bühne, wo er direkt in die Handlung eingreift, singt aber auch aus dem «Off» klanglich kompakt und nuanciert). Für Mussbach ist «Carmen» ein zeitloses Liebesdrama in einer gesellschaftlichen Randgruppe - Zigeuner, Schmuggler - und in einem Klima von Depression und Entfremdung, in dem Lähmung unvermittelt in eruptive Emotionalität umschlägt.
Der Zwischenvorhang zeigt in ödem Niemandsland zwischen Leitungsmasten Wohnwagen, die halb im Wasser versunken sind. Die Bühne ist in allen vier Akten ein hallen- oder bunkerartiger Raum, der nur durch die Verschiebung eines schwarzen Gasometers modifiziert wird. Auf dem Boden liegen unter einer dünnen Schneeschicht Wohnwagenwracks, zwischen denen - entbehrliche Zutat - vor dem zweiten und vierten Akt zwei Schäferhunde streunen. Die Soldaten und Zigeuner sind in dicke schwarze Kleider gehüllt, nur Micaëla erscheint als hellblaue «Lichtgestalt». Es ist kalt in Erich Wonders Sevilla. Umso mehr suchen die Menschen körperliche Nähe. Brutal packen die Soldaten die randalierenden Tabakarbeiterinnen. Mit knappen, präzisen Strichen wird hier das soziale Umfeld des Dramas skizziert, der Geschichte von Carmen und Don José.
Mussbach hat seine Inszenierung ganz auf dieses Paar fokussiert, wobei die eigentliche Hauptfigur Don José ist, der einst zum Priester bestimmte Sergeant, der sich aus Liebe zur Zigeunerin Carmen degradieren und einsperren lässt und schliesslich zum Mörder wird. Er ist bei Mussbach ein verklemmter, linkischer, fast kindlicher junger Mann, aus dem bei der Begegnung mit Carmen plötzlich die unterdrückte, aufgestaute Sexualität hervorbricht. Wie er zu tanzen beginnt und frei wird, als ihm Carmen ein Wiedersehen in der Schenke von Lillas Pastia verspricht, wie er dort seinen Oberkörper entblösst und seine Sexualangst zu überwinden versucht, dann aber zurückschreckt, und wie sich diese Szene am Schluss wiederholt und unausweichlich in die Tötung der verlorenen Geliebten mündet, das hat Mussbach mit dem jungen australischen Tenor Julian Gavin wunderbar subtil erarbeitet, und man versteht die Entscheidung des Opernhauses, in der Premiere nicht den wegen einer Operation verspätet zu den Proben gekommenen Star Neil Shicoff einzusetzen, sondern den unbekannten Nachwuchssänger. Zumal dieser auch vorzüglich singt. Sein Tenor verfügt über ein kräftiges Fundament und eine mühelose, strahlende Höhe. Dass er in den Registerübergängen gelegentlich etwas ungeschliffen klingt, passt zum Rollenbild, wie es Mussbach zeichnet. Unvergesslich die Blumenarie, sonst meist ein sängerisches Paradestück, hier ein Liebesgeständnis aus tiefster Seele, nicht weniger ergreifend die Schlussszene. Das Publikum zeigte sich offen und honorierte Gavins Leistung mit enthusiastischem Beifall, während dem Regieteam ein Schwall von Buhrufen entgegenschlug.
Auch mit der Carmen-Darstellerin haben Mussbach und der Dirigent Michel Plasson intensiv gearbeitet. Nach ihrer Zürcher Santuzza hätte man Luciana D'Intino so kontrollierte, differenzierte Töne und solch intensives Gestalten kaum zugetraut. Ihre Carmen ist der Inbegriff von Weiblichkeit und Eros, aber sie stellt diese nicht lasziv zur Schau, sondern setzt auf kleine, signifikante Gesten. D'Intinos Sopran klingt in der unteren und mittleren Lage füllig und warm, in der Höhe allerdings ein wenig glanzlos. Neben dem Protagonistenpaar stehen die übrigen Figuren buchstäblich im Schatten, selbst Escamillo. Im zweiten Akt tritt er - in das traditionelle Toreador-Kostüm gekleidet - wie eine Spukerscheinung auf, eine Wunschprojektion Carmens, umrahmt von zischend aus dem Boden schiessenden Flammen. Unfassbar, eindimensional bleibt er auch in den folgenden Szenen, ein Escamillo ohne theatralische Sieger- und Heldenpose. Dem entspricht der Charakter von Michele Pertusis sattem, straff geführtem Bariton. Mehr Gewicht hat Micaëla: als Kontrastfigur zu Carmen, der sie mit ihrem roten Haar äusserlich angenähert ist. Elena Prokinas ausdrucksvoller, in der Höhe etwas unstabiler Sopran tut ein Übriges, das Klischeebild der faden blondzopfigen Naiven zu korrigieren. Unter den Nebenfiguren profilieren sich besonders Martina Jankovás Frasquita und Irène Friedlis Mercédès.
Nicht nur das szenische, auch das klangliche Erscheinungsbild dieser neuen «Carmen» ist anders als bei den Zürcher Aufführungen der letzten Jahre, heller, facettenreicher, französischer. Das ist das Verdienst Michel Plassons, der das musikalische Geschehen in spannungsvollem Fluss hält, den Orchesterpart auflichtet und nach den mit aller Schärfe intonierten dramatischen Kulminationspunkten die Lautstärke sofort wieder zurücknimmt. Dass Plasson sich für die Fassung mit den von Ernest Guiraud nachkomponierten Rezitativen entschieden hat, begründet er mit den Intentionen des Komponisten und den für nichtfrankophone Sänger schier unüberwindlichen sprachlichen Schwierigkeiten der Dialogfassung. Es liesse sich ergänzen, dass die Guiraud-Fassung überdies die Geschlossenheit des Handlungsablaufs steigert. - Der Spielplan des Opernhauses hat mit dieser Festspielproduktion einen markanten neuen Akzent erhalten. Ein Makel allerdings bleibt: Im sechsten Jahr der neuen Zürcher Festspiele hätte sich endlich die Chance einer übergreifenden Thematik geboten: Schostakowitsch. Doch dessen Musik erklingt ausschliesslich in der Tonhalle, als Opernkomponist existiert er im Festspielprogramm nicht.
|

22. 6. 2002
Zigeuner in Lack und Leder
Applaus, ja Bravos für die Musiker, Buhs für die Regie. Muss das denn immer so schwarzweiss geraten? Die neue Zürcher «Carmen» macht da keine Ausnahme.
Von Thomas Meyer
Erwarte niemand Zigeunerromantik, spanische Folklore und verführerische Erotik! Georges Bizets Opéra comique «Carmen» entspricht in Zürichs neuer Inszenierung höchstens in Details noch diesem Bild. Aber wer hatte derlei im Ernst noch erwartet, gerade von einem Regisseur wie Peter Mussbach? Und wer hatte nicht sogar darauf gehofft, dass zur bunten und oft auch nicht besonders anregenden Opernstaffagerie ein Gegenentwurf folgt? Problematisch ist das nur, weil man Bizets Stück weniger einen solchen Neuansatz zutraut, weil die Musik es auch weniger nötig hat als die Wagners und weil sich eben auch vieles darin gegen eine ungewöhnliche Lesart zu sträuben scheint. Tatsächlich tut sich in Zürich zuweilen eine Diskrepanz auf zwischen der leichten Musik (die, wie Nietzsche meinte, eben nicht schwitzt) und der kruden Moderne, auf die Regisseur Peter Mussbach die Story herunterfährt.
Aber eine Diskrepanz kann auch Spannung erzeugen. Und die gibts durchaus in der Zürcher Inszenierung. Gerade dort, wo die Menschen aufeinander prallen, wo die Erotik handfest wird, wo sich die Eifersucht auflädt, da entsteht aus der Personenführung heraus eine unerlöste Begierde, die sich mit Gewaltbereitschaft und dunkler Leidenschaft paart. Diese Umwelt ist rau. Erich Wonder hat einen tiefen, grauen Raum dazu geschaffen, der in der Anlage fasziniert, vieles leider etwas zu wenig erhellt, sodass man szenenweise kaum der Mimik der Darsteller folgen kann. Die Figuren werden so zu dunklen Schemen. In diese Trostlosigkeit stellt Wonder ein turmhohes Ölsilo, mit dem sich je nach Handlung auch ein Gebirge oder eine Stierkampfarena vorstellen liesse. Die Assoziationen sind offen, einsichtig werden sie nicht ganz. Andrea Schmidt-Futterer hat dazu die Menschen in Lack und Leder gesteckt. Die Sado-maso-Anspielung ist etwas gar offensichtlich und auch modisch, aber es entspricht dieser Darstellungsweise, die hartan den Mann bzw. die Frau geht. Wir erleben wirklich kriminelle Gestalten und nicht nette Ganoven, das ist äusserlich wahrscheinlich der grösste Affront, aber es ergibt ein zwingendes Ambiente für dieses Drama, das sich immer wieder zu steigern vermag und das gerade in der Schlussszene unter die Haut geht.
Daneben aber fransen die Bilder in Ungereimtheiten aus. Einige Bilder wirken unmotiviert, ja lächerlich. Am schlimmsten trifft es Escamillo. Der Toreador mit seinem Hütchen muss wie der Gehörnte auftreten, Flammen lodern um ihn auf, aber das gibt der Figur keinen Zunder. Diese Stier-Satan-Assoziation wirkt verwackelt. Oft ist das Bühnenbild auch einfach umständlich: Der Boden ist mit knapp herausragenden Wohnwagendächern bedeckt. Der schöne Proszeniumsvorhang gibt uns eine Ahnung davon, dass wir uns hier die in einem Hochwasser versoffenen Wohnwagen heutiger Sinti vorstellen sollen. Aber auch das wird nur momentweise schlüssig - und verleitet die Darsteller dafür allzu oft zum Klettern und Hüpfen.
Kraftvoll und ohne Forciertheit
Die Diskrepanz, die das Szenische durchzieht, greift auch auf die gesangliche Leistung über. Wirklich stark sind die Sänger dort, wo es um dramatische Emotionen geht. Carmen (Luciana d’Intino) ist eine starke Frau, bei der man nie weiss, ob sie aus echter Passion oder aus Berechnung handelt - nichts von Liebeständelei also. Und Julian Gavin, der an Stelle von Neil Shicoff die Premiere sang, gibt einen oft jähzornigen, seinen Gefühlen gegenüber fast hilflosen Don José. Gerade seine Höhepunkte strahlen kraftvoll und ohne Forciertheit. In solchen Momenten kann man sich musikalisch mitreissen lassen. Wo aber eine strömende Linie gefragt ist, wo das lang gezogene, sich auch einschmeichelnde Melos Bizets fliessen müsste, da wirkt vieles zu kurz phrasiert - abgerissen oft bei Gavin, ohne vokales Eros bei der Carmen und vor allem auch beim Escamillo von Michele Pertusi. Am überzeugendsten würden diese Melodien bei der Micaela von Elena Prokina klingen, hätte sie nicht die Eigenart, die hohen Töne entweder zu tief zu intonieren oder sie mit einem starken Tremolo anzureichern. So wird der Gesang zu einem Spiegelbild der Inszenierung. Das Atmosphärische findet sich an diesem Abend eher bei den Nebenrollen, etwa Frasquita und Mercedes (Martina Janková und Irène Friedli). Dabei ist es im Orchester durchaus vorhanden. Michel Plasson leuchtet die Partitur aufs Hellste aus, arbeitet die reichlich vorhandenen solistischen Instrumentalpartien heraus, ist immer für die Sänger da und schafft es dennoch, das Stück schwungvoll durchzuziehen. Einige Unsicherheiten in der Koordination, einige Unsauberkeiten dürften sich mit der Zeit legen.
Ein zwiespältiger Eindruck also insgesamt, der umso verwirrender erscheint, weil Mussbach mit aller Ernsthaftigkeit etwas anderes gewagt hat. Die Inszenierung krankt daran, dass sie nicht ganz zu Ende gedacht wirkt, dass sie, um die alten «Carmen»-Klischees zu vermeiden, ihrerseits stellenweise ins Lack-und-Leder-Klischee abrutscht. Es scheint leider, als habe es sich das Zürcher Publikum zur Mode gemacht, jede etwas anrüchige und modernistische Inszenierung undifferenziert zu verdammen. Dazu ist hier kein Anlass.
|
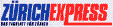
24. 6. 2002
Kaputte Welt, kaputte Carmen
Nix España folclórica, nix Sevilla, nix Arena, Bodega oder Zigeuner. Zürichs neue Carmen kommt ohne Klischees aus. Das bleibt aber schon die einzige Ambition von Regisseur Peter Mussbach. Sänger und Chor führt er auf höchst biederem Niveau. Er streicht auch jede Atmosphäre, jede Ausstrahlung der Figuren. Und die Musik ignoriert er. Die darf, Georges Bizet dankts, im Original erklingen, spanisch-französisch eben. Oder was Dirigent Michel Plasson davon übrig lässt. Er haut martialisch aufs Orchester ein, schnaubt und stöhnt, dass es bis in die letzte Reihe stört.
Die Bühne ist eine dunkle Betonkatakombe mit Oberlichtern, vielleicht auch eine leere Tiefgarage: eine kaputte Welt. Dank undefinierbaren Betonpodesten lenken die Sänger ab von dem, was sie singen. Ein Ungetüm von schwarzem Gaskessel oder Öltank fährt hie und da unmotiviert von rechts nach links und zurück. Weil zuweilen der Chor darin versteckt ist, haben wir es wohl mit einem singenden Gaskessel zu tun.
Ponelle bleibt auf der Strecke
Alle Kostüme sind schwarz: Escamillo (Michele Pertusi) trägt eine Art Torrerokostüm. Lächerlich und feuerbegleitet wie ein Pseudo-Mephisto. Unvorteilhaft wie eine Puffmutter gekleidet, führt Luciana d'Intino vor allem ihr erstaunliches Vokalorgan vor, vorwiegend mit Bruststimme. Keine Carmen! Elena Prokina gibt der Michaela die Stimme einer Tosca. Überzeugend: Martina Jankova und Irène Friedli als Frasquita und Mercedes und die Herren Will, Zysset, Kalman und Murga. Highlight der Premiere war Julian Gavins José, berührend, kraftund schmelzvoll. Er ersetzte den erkrankten Neil Shicoff, der ab der zweiten Vorstellung singen will. Hoffentlich gibt es keine ...
Auf der Strecke bleibt der geniale Regisseur Jean-Pierre Ponnelle. Er hat in den 70er-Jahren, mit Mozart, Monteverdi und Carmen, den Weltruhm der Zürcher Oper mitbegründet. Hier wird er definitiv und vorsätzlich umgebracht.
|

28. 6. 2002
Eine entrümpelte «Carmen»
Peter Mussbach hat Bizets «Carmen» radikal entrümpelt - so radikal, dass so ziemlich alles auf der Strecke bleibt, was den Zauber und die Faszination dieser Oper ausmacht.
Nach einer gewissen Durststrecke ist Georges Bizets «Carmen», die meistgespielte Oper überhaupt, wieder sehr en vogue. Sowohl Zürich (zwanzig Jahre nach der viel gerühmten Ponnelle-Inszenierung) als auch Luzern (in der kommenden Saison) haben sie auf den Spielplan gesetzt, Zürich als eine der beiden Neuinszenierungen im Rahmen der Zürcher Festspiele (neben «Rigoletto», dessen Premiere am 12. Juli folgt). Wer in diese «Carmen» mit der Erwartung geht, ein Spanien der Zigeuner, des Flamencos, der Stierkampf-Romantik und der prickelnden Erotik zu erleben, wird enttäuscht sein. Doch enttäuscht wird auch, wer an deren Stelle etwas «Echteres», Authentischeres, weniger Klischeehaftes erwartet.
Keine Spanien-Folklore
Der Vorhang zeigt Wohnwagen, die halb im Wasser versunken sind. Auf den Dächern halb kaputter Wohnwagen spielt auch die erste Szene (und im Endeffekt die ganze Oper, denn Erich Wonder hat ein Einheitsbühnenbild mit einem täuschend nach hinten verlängerten, hallenartigen Raum geschaffen) vor der Zigarettenfabrik in Sevilla. Doch was heisst hier Zigarettenfabrik, was Sevilla? Auf der linken Seite erstreckt sich eine Art Säulenwand, aus deren Luken spärliches Licht auf die fast ganz in Dunkel getauchte und von einheitlich schwarz gekleideten (Kostüme: Andrea Schmidt-Futterer) Soldaten und Passanten fällt. Einzig Micaela, die bereits anwesend ist, hebt sich durch ihr blaues Kleid und die Turnschuhe etwas von der grauen Umgebung ab. Rechts ein riesiger verschiebbarer Gastank, der im weiteren Verlauf allmählich stärker in den Mittelpunkt rückt und sich am Ende als die zusammengezogene Form einer Arena entpuppt, vor der das Drama zwischen Carmen und Don José tödlich endet. Auf die beiden Hunde, die laut Premierenberichten zwischen den Wohnwagenwracks vor dem zweiten und vierten Akt streunten, wurde in der ersten Wiederholung am Mittwoch verzichtet, wohl mit gutem Grund. Die Zigarettenarbeiterinnen singen aus dem «Off», erscheinen erst, als es zur Konfrontation zwischen ihnen und den Soldaten kommt. Die Absicht ist klar: Peter Mussbach will uns ein Drama am Rande der Gesellschaft, in der Kälte (daher die dicken Mäntel), in einem gewaltbereiten Milieu der Schmuggler und Dirnen zeigen. Gut so, aber warum dermassen unspanisch, eindimensional und ohne eine Spur von Charme, von Temperament und von Zwischentönen, wie sie aus der Partitur Georges Bizets in so reichem Masse klingen?
Musikalisch enttäuschend
Das ist vielleicht die grösste Enttäuschung: dass sich diese Mise en scène auf Musik und Sänger abfärbt. Anstatt Gegensteuer zu geben, klingt das Orchester schon beim Vorspiel reichlich pauschal, breitet die Farben mit viel zu breitem Pinsel aus. Dass es zudem immer wieder zu Koordinationsproblemen zwischen Orchestergraben und Bühne kommt, erstaunt nicht angesichts des Umstands, dass der Chor meist unsichtbar aus dem Hintergrund singt oder - wie der Kinderchor des Opernhauses im ersten Akt - zu hektischer Bewegung genötigt wird. Dabei steht mit Michel Plasson ein Mann am Pult, der gemeinhin als Garant für stilsicheres französisches Musizieren, für Leichtigkeit, Eleganz und Durchsichtigkeit gilt. Aber schon indem sich Plasson für die Rezitativfassung an Stelle der originalen Dialogfassung entschied, schuf er nicht die optimalen Voraussetzungen für eine stilechte «Carmen».
Grosskalibrig
Da kann es nicht einmal mehr überraschen, dass er auch die Hauptrollen mit grosskalibrigen Stimmen besetzte, die sich zwar gegen das oft zu laut und zu massiv spielende Orchester durchsetzen, aber um den Preis der Schlankheit und der Zwischenfarben. Bei Luciana d'Intino dominieren die satten, brünstigen Alttöne. Wie diese als Mannweib aufgemachte Carmen die in Don José aufgestaute Sexualität zum Erwachen zu bringen vermag, bleibt rätselhaft. Neil Shicoff setzt bereits im Liebesduett mit Micaela (und später auch in der Blumenarie) auf kraftvolle, gefestigte Töne, wird seinem Starstatus mit wachsender Dramatik des Geschehens aber gerecht. Elena Prokinas Micaela neigt, im Bestreben, nicht eine Unschuld vom Lande, sondern eine selbstbewusste junge Frau zu zeichnen, zum Forcieren. Geradlinig-straff, wie es dem Toreador Escamillo entspricht, Michele Pertusi. Am ehesten etwas von der federnden Leichtigkeit der «Carmen»-Musik verraten noch Martina Jankovas Frasquita und Irène Friedlis Mercédès. Erster und zweiter Akt und, nach der Pause, dritter und vierter Akt (bei den Chören stark gekürzt) werden jeweils ohne Unterbrechung straff durchgespielt - wenn dadurch die dramatische Zielrichtung unterstrichen werden sollte, war der Preis dafür entschieden zu hoch.
VON FRITZ SCHAUB
|

