|
Aufführung
|

20. 10. 2002
(Première)
*
Musikalische Leitung: John Eliot Gardiner
Inszenierung: David Pountney
Ausstattung: Richard Hudson
Lichtgestaltung: Jürgen Hoffmann
Chor: Ernst Raffelsberger / Frank Meiswinkel
Choreographie: Elaine Tyler-Hall
*
Teresa: Chiara Taigi
Ascanio: Liliana Nikiteanu
Benvenuto Cellini: Gregory Kunde
Giacomo Balducci: Alfred Muff
Fieramosca: Thomas Mohr
Papst Clemens VII: Nicolai Ghiaurov
Francesco: Boguslav Bidzinski
Bernardino: Reinhard Mayr
Pompeo: Kenneth Robertson
Cabaretier: MartinZysset
Chor des Opernhauses Zürich
Orchester der Oper Zürich
|
|
Rezensionen
|
|

22 .10. 2002
Geniekult ohne Pathos
«Benvenuto Cellini» von Berlioz im Zürcher Opernhaus
Nach dem eher flauen Saisonbeginn wirkt die jüngste Premiere des Zürcher Opernhauses wie ein Fanfarenstoss: ein grandioser Stoff, eine faszinierende Musik, eine fulminante Inszenierung. Die Wiederaufführung von Hector Berlioz' «Benvenuto Cellini» - neunzig Jahre nach der bisher wohl einzigen Zürcher Einstudierung, zwölf Jahre nach der letzten Berlioz-Grosstat des Opernhauses, «Les Troyens» - ist weit mehr als musikhistorisch verdienstvolle Raritätenpflege. Obwohl nur die historische Perspektive ermessen lässt, was an diesem 1838 uraufgeführten Werk revolutionär und zukunftsträchtig ist.
Bei der Titelfigur handelt es sich um den Goldschmied und Bildhauer Benvenuto Cellini, dessen Autobiographie Berlioz und seine Textdichter de Wailly und Barbier Episoden entnommen haben, welche sich zu einem Künstlerdrama der Renaissancezeit fügen, aber auch Berlioz' Selbstverständnis spiegeln. Cellini: Das ist das Genie, das trinkt, rauft und mordet und seinem päpstlichen Auftraggeber mit der Zerstörung der bestellten Perseus-Skulptur droht, das ist der Künstler, der sich und sein Werk absolut setzt und am Schluss alles gewinnt, Absolution, Ruhm und die Hand seiner Geliebten, Teresa. Doch anders als spätere Künstleropern - Kontrastbeispiele sind etwa Pfitzners «Palestrina» oder Hindemiths «Cardillac» - bewegt sich «Benvenuto Cellini» nicht in metaphysischen Dimensionen, hier geht es um pure Schöpferkraft und Lebenslust. Umso bemerkenswerter ist, wie Berlioz mit den revoltierenden Giessereiarbeitern auch ein sozialkritisches Element einbringt. Eigenartig wirkt die Vermischung von heroischen und komödiantischen Szenen, von romantischem Gefühl und buffoneskem Humor. Damit nimmt «Benvenuto Cellini» eine eigentümliche Zwischenstellung zwischen den Epochen und Gattungen, zwischen Opéra comique und grosser Oper ein, während Berlioz' Kompositionsstil Generationen von Nachfolgern inspirierte (einen direkten «Cellini»-Nachhall vernimmt man sowohl in Bizets «Carmen» wie in Verdis «Rigoletto»).
All diese inhaltlichen und formalen Elemente bergen ein enormes szenisches und dramatisches Potenzial. David Pountney, seit seinen Bregenzer Seebühnenproduktionen auf Spektakuläres spezialisiert, ist der ideale Regisseur, um dieses auszuschöpfen. Die «Bühne auf der Bühne» mag zwar als Bildchiffre inzwischen etwas abgenutzt sein, doch hier, wo die Selbstinszenierung eines Künstlers dargestellt werden soll, erweist sie sich als kongenial. Als Besonderheit hat Richard Hudson eine Doppelbühne entworfen: der linke Teil ein Theaterraum aus dem 19. Jahrhundert, der rechte das Kolosseum in Rom, wo Cellini seine Werkstatt hat; ein von der Bühnenwand umfasstes Podest bildet die eigentliche Spielfläche. So werden Handlungs- und Entstehungszeit der Oper zusammengeführt und zugleich die Viten von Cellini und Berlioz optisch in Parallele gesetzt. Auch Hudsons Kostüme zitieren beide Epochen.
Virtuos nutzt Pountney diese Architektur mit ihren mehrstöckigen Arkadenreihen. Die Pantomime, in welcher der banausische päpstliche Schatzmeister Balducci, Teresas Vater, verspottet wird, gerät zum rauschenden Kostüm- und Maskenfest. Witzig ist der Einfall, dabei neben dem Perseus ein weiteres Meisterwerk Cellinis, das berühmte Wiener Salzfass, als lebendes Bild auf die Bühne zu bringen. Ruhepunkte sind die Szenen vor dem Zwischenvorhang, der seinerseits Umbauten ohne Spielunterbruch ermöglicht. Der dramatische Höhepunkt der Oper, der Guss der Perseus-Statue, wird zum erwarteten Spektakel mit Rauch und Feuerschein. Doch beweist Pountney immer wieder auch sein stilistisches Feingefühl, seinen Humor und seinen Sinn für Ironie. Wie er beim Auftritt des Papstes jeder Peinlichkeit entgeht, indem er den Kirchenfürsten mit weltmännischen Allüren ausstattet und seinem Gefolge ein Nonnenballett beigesellt, ist brillant - und wäre nicht möglich ohne den grossartigen Papstdarsteller Nicolai Ghiaurov.
Überhaupt wartet die Aufführung in den kleineren Partien mit einer exzellenten Besetzung auf: sprühend vital Liliana Nikiteanu als Cellinis Gehilfe Ascanio, sängerisch markant und souverän Thomas Mohr als Cellinis karikierter Rivale Fieramosca, subtil Martin Zysset als Wirt, etwas farblos allerdings Alfred Muff als Balducci. Enttäuschend wirkt demgegenüber das Protagonistenpaar. Gregory Kunde entspricht zwar mit seinem mitreissenden Temperament und seiner Agilität durchaus der Figur Cellini, doch sein lyrischer Tenor ist mit der strapaziösen Partie überfordert und verliert zunehmend an Kraft und Glanz. Auch Chiara Taigi lässt als schwärmerisch verliebte Teresa darstellerisch keine Wünsche offen, aber ihr Sopran klingt oft schneidend hart.
Was der Brennofen in Cellinis Werkstatt, ist John Eliot Gardiner am Pult. Dass der schwierige «Guss» des «Cellini» im Opernhaus gelingt, ist wesentlich sein Verdienst. Zusammen mit Hugh Macdonald, dem Herausgeber der kritischen Berlioz-Edition, und Pountney hat er die «Zürcher Fassung» erstellt (NZZ 18. 10. 02), die sich musikalisch wie dramaturgisch als überzeugende Spielvorlage erweist. Und nun setzt er sich mit all seiner musikantischen Energie für die komplexe, bald zartgliedrige, bald bombastische Partitur ein. Sein Impetus verleiht den oft kleinteiligen Formgebilden Zusammenhalt - grossartig, wie das Orchester die oft rasanten Tempi durchhält - und kompensiert das Fehlen grosser Melodiebögen. Wie ein Ziseleur arbeitet Gardiner die intrikate Rhythmik heraus. Welch raffinierter Instrumentator und Kolorist Berlioz war, würde man allerdings noch besser hören, wenn Gardiner die Lautstärke - besonders der Blechbläser und des Chores - etwas reduzierte. - Ein erstaunliches Werk in einer staunenswerten Wiedergabe.
|

22. 10. 2002
Starkes Plädoyer für eine glanzvolle Musik
John Eliot Gardiner brachte eine neue Fassung von Berlioz'«Benvenuto Cellini» ins Zürcher Opernhaus: Ein üppiges Stück, üppig inszeniert von David Pountney.
Von Susanne Kübler
Der Papst tritt auf, streikende Giessereiarbeiter stürmen die Bühne, und der Titelheld ist ein Goldschmied, Bildhauer und Mörder: Schon das Personal von Hector Berlioz' Oper «Benvenuto Cellini», die sich an einer realen Figur der italienischen Renaissance orientiert, deutet auf ein Werk hin, das nicht gerade dem Mainstream des 19. Jahrhunderts entspricht. Einzig die frei erfundene Liebesgeschichte zwischen Cellini und Teresa, der Tochter des päpstlichen Schatzmeisters, ist eine Konzession an den gängigen Geschmack. Sonst gilt die Oper als frühes Beispiel eines Werks, das die Kunst und das Metier des Künstlers thematisiert: Der Papst verspricht Cellini Teresas Hand und die Absolution wegen eines Mordes, wenn er rechtzeitig eine Perseusstatue giesst; dies gelingt trotz Metallmangel, weil der Künstler alle seine früheren Meisterwerke einschmilzt. Eine Geschichte, die dem damaligen Publikum seltsam vorgekommen sein muss.
Ansteckende Begeisterung
Entsprechend schwer hatte es das Werk. Der erste Entwurf wurde abgelehnt, die Pariser Uraufführung einer überarbeiteten Fassung 1838 war ein Flop, einer von Liszt angeregten, gestrafften Weimarer Version ging es 1852 kaum besser. Es folgten weitere Umarbeitungen, aus zwei Akten wurden drei, aber Misserfolg blieb Misserfolg. Obwohl Berlioz an die Oper glaubte: «Ich habe soeben meine arme Partitur mit Sorgfalt und kaltblütiger Unpar-teilichkeit wieder gelesen», schrieb er später in seinen Memoiren, «und kann nicht umhin, eine Fülle von Gedanken, eine stürmische Verve, einen Glanz der musikalischen Färbung darin zu finden, die ich vielleicht nie mehr erreichen werde und die ein grösseres Lob verdient hätten».
Dieser Meinung ist auch John Eliot Gardiner, der nach Webers «Oberon» vor fünf Jahren zum zweiten Mal ins Zürcher Opernhaus kam - mit einer neuen, aus den Versionen von Paris und Weimar kombinierten Fassung des «Benvenuto Cellini» und einer ebenso offensichtlichen wie ansteckenden Begeisterung für diese Musik. Schon in der Ouvertüre liess der Diri-gent am Sonntag das Or-chester der Oper stürmen, singen und schmet-tern; er inszenierte die Brüche ebenso geschickt wie die schlauen Über-gänge, die Berlioz zwi-schen den Tonfällen eingebaut hat, und gab mit ausgefeilter Dynamik, differen-zierten Tempi und klanglicher Präzision einen Vorgeschmack auf das, was folgen sollte. Denn Berlioz hat sein ungewöhnli-ches Personal musikalisch höchst effektvoll porträtiert: Mit Arbeiterliedern, mit dem salbungsvollen Pathos der päpstlichen Entourage, die beim Schatzmeister offen ins Lächerliche kippt, mit der echten, intimen Tonsprache von Cellini und Teresa und oft auch mit der Kombination der Stile. Immer wieder singt einer im Hintergrund seine kontrastierenden Kommentare, zieht ein Mönchschor durch ein Duett, überlagern sich instrumentale und vokale Schichten in komplizierten und dennoch unmittelbar wirkungsvollen Kontrapunkten: Auf die «Fülle von Gedanken» konnte Berlioz tatsächlich stolz sein.
Tändelnde Schnellsingparcours
Entsprechend vielseitig agieren die Sängerinnen und Sänger, die allesamt Rollendebüts geben. Gregory Kunde ist ein sympathischer Cellini, der mit seiner Geliebten tändelnde Schnellsingparcours absolvieren und darin gleich wieder auf tenorale Lyrik umstellen kann. Auch Chiara Taigi, die als Teresa ihren ersten Zürcher Auftritt hat, passt ihren in der Höhe grosszügigen, in der Tiefe eher herben Sopran geschickt den wechselnden Situationen an. Dazu kommen eine grossartig temperamentvolle Liliana Nikiteanu als Cellinis Gehilfe, Thomas Mohr mit Neid im Timbre als dessen Widersacher Fieramosca, Alfred Muff als genüsslich karikierender Schatzmeister und Nicolai Ghiaurov, der als Papst der Karikatur seine ganze vokale Würde entgegensetzt. Und schliesslich ist da der von Ernst Raffelsberger und Frank Meiswinkel vorbereitete Chor des Opernhauses, der sein enormes Pensum mit viel Klang und Konzentration bravourös bewältigt.
Dass Regisseur David Pountney bei der Inszenierung eines so üppigen Werks nicht knausern würde, war anzunehmen: Materielle Zurückhaltung war noch nie die Sache des Engländers, der kaum zufällig die auf prächtige Ausstattungen speziali-sierten Bregenzer Festspiele übernehmen wird. Überladen hat er diesmal allerdings nur die zentrale Karnevalsszene: Da gibt es Pierrots, statuenartig lackierte Tänzer, venezianische Masken, hoch aufgetürmte Frisuren und noch höhere Plateausohlen, Marionetten, einen ebenso rätselhaften wie monströsen Riesenkinderkopf und insgesamt einen solchen Klamauk, dass die entscheidenden Momente der Handlung - Cellinis Mord an Fieramoscas Kumpel, Fieramoscas irrtümliche Verhaftung, Cellinis Flucht - beinahe untergehen. Umso mehr, als in dieser Aufführung auf die in letzter Zeit eingeführte Übertitelung leider wieder verzichtet wird und man vom «entzückenden Libretto» (Berlioz) gerade in Massenszenen nicht viel mitbekommt.
Eine Oper für die Oper
Sonst lässt Pountney der Geschichte mehr Raum - und passenden Raum. Seine bewährten Galerien um die Bühne liess er von Ausstatter Richard Hudson als halbfertiges Opernhaus mit teils reich dekorierten, teils kahlen Logen bauen: Es geht schliesslich um die Kunst in diesem Stück, und um einen Künstler, der genau so ums materielle Überleben, um Anerkennung und die Vollendung seiner Werke zu kämpfen hatte wie Berlioz selbst. Wobei der Ernst dieser Thematik den Regisseur weniger interessiert zu haben scheint als die komischen Elemente der Oper: Die Liebenden schmatzen eher, als dass sie küssen, und Fieramosca ist schon wegen seines knallig-puffärmligen Kostüms eine läppische Figur, was er nach Berlioz durchaus nicht immer sein müsste.
Manches in Pountneys Mix aus naturalistischen und schrillen Kostümen, aus Individuen und Opernfiguren, aus inszenierter Echtheit und dem Theater im Theater wirkt zunächst zufällig, trotz aller Sorgfalt und Fantasie im Detail. Aber mit der Zeit werden die Stile ebenso konsequent zusammengeführt wie in der Musik: Bis am Ende das Metall ausgeht, Cellinis Gehilfen die geflügelten Figuren von den Logen abmontieren und zum Schmelzofen bringen. Dass dieser dann in einem letzten Effort der Spezialeffekte abhebt und unter Feuerwerk die riesige Perseusstatue enthüllt, passt zur Musik, die den Schmelzprozess fast filmmusikalisch begleitet. Und zu einem Happyend, dass bei aller Unwahrscheinlichkeit so strahlend gefeiert wird, wie es sich für eine romantische Oper eben doch gehört.
|
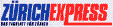
22. 10. 2002
Der Ernst des Künstlerlebens
Hector Berlioz' selten aufgeführte Oper «Benvenuto Cellini» ist eine lohnenswerte Entdeckung im Opernhaus
Berlioz' Oper ist ein aufregendes, vielfarbiges, auch etwas verrücktes Epos über das Künstlerleben des Renaissancebildhauers Benvenuto Cellini. Dieser ist im Verzug, eine vom Papst bestellte Statue abzuliefern, aber auch verliebt in Teresa, die schöne Tochter des päpstlichen Schatzmeisters Balducci. In beiden Angelegenheiten ist Cellini Konkurrent des Künstlers Fieramosca. Ende gut, alles gut: Nach vielen bühnenwirksamen Turbulenzen schafft Cellini den Guss der Statue doch noch - mit Hilfe Gottes, wie der Papst überzeugt ist, der die Liebe zwischen Cellini und Teresa schliesslich höchstpersönlich segnet. Zur Freude jedes Musiktheatermachers spielt alles um die Fasnachtszeit: Masken, Verkleidungen, Theater im Theater werden von Ausstatter Richard Hudson lustvoll zelebriert.
Ernsthafte Schönheit für Geist und Ohren
Das selten gespielte Werk (in Zürich nicht mehr seit 1913!) wurde im Opernhaus zum spielfreudigen Opernabend voller theatralischer Ironie, gemischt mit ernsthafter Schönheit für Geist und Ohren. Das geschieht aber nicht immer nahtlos, was die Oper etwas zu einem Zwitter macht. Es scheint, als hätte sich der Komponist nicht zu einem Genre entschliessen können. Und Regisseur David Pountney auch nicht. Im ersten Akt ist er im Element, inszeniert üppige Tableaus zwischen Renaissance und der Entstehungszeit der Oper, dem 19. Jahrhundert. Da beweist Pountney seine Genialität der Personenführung, die selbst in Massenszenen jedem Einzelnen Profil gibt. Fantastisch folgt jede Geste der bildhaften Musik. Denn auch Berlioz hat die schönsten Melodien, die köstlichsten Ensembles in den ersten Akt gepackt.
Nach der Pause der Bruch: Anders ist die Stimmung, kleiner der Personenaufwand, intimer die Musik, ernsthafter die Dialoge, weniger die Handlung. Ästhetisch und glaubhaft bleibts. Doch gegenüber den Szenen davor fällt das ein wenig ab, und auch der Regie fällt ohne Action nicht mehr so viel ein. Bis zum opulentge Schluss, wo es in der Giesserei höllisch dampft und glüht, der Ofen schliesslich in einem Feuerwerk explodiert und in Glanz und Rauch die vollendete Bronzestatue dasteht.
Das Feuer dieser spektakulären Aufführung wird im Orchestergraben gelegt. Dirigent John Eliot Gardiner und das Opernorchester breiten Berlioz' Dynamik aufs Schönste aus. Die musikalische Vielfarbigkeit springt über auf den Chor und die zahlreichen Solisten. Die mörderischen Höhenstrapazen der Titelpartie nimmt der junge Gregory Kunde auf sich, nicht mit tenoralem Kraftakt, sondern mit viel Ausstrahlung und französischem Flair. Liliana Nikiteanu holt sich Publikumsapplaus mit jungenhaftem Charme als Cellinis Freund Ascanio, Balducci erhält von Alfred Muff eine gehörige Portion affektierter Tollpatschigkeit, und Thomas Mohr glänzt zwischen Humoreske und Tragik als zu kurz gekommener Liebhaber Fieramosca. Altstar Nicolai Ghiaurov gibt in der kleinen Rolle als Papst Clément VII. ein trotz Greisenalter bewegendes Rollendebüt. Die Entdeckung: Chiara Taigi als Teresa - ihr warmer, gradliniger Sopran und ihr finessenreiches Spiel sind betörend.
|

22. 10. 2002
Die Vollendung des Perseus im Opernhaus
«Benvenuto Cellini» ist so grossartig wie schwierig, und Inszenierungen haben Seltenheitswert. Das Opernhaus Zürich hat unter der Leitung von John Eliot Gardiner, David Pountney und Richard Hudson das Werk neu gegossen: musikalisch und szenisch ein Cellinischer Kraftakt mit glänzendem Resultat.
HERBERT BÜTTIKER
Der riesige Ofen glüht und qualmt. Die Giesser haben einen Grosseinsatz. Plötzlich ist alles in Frage gestellt: Es fehlt an Metall. Cellini steigt hinauf und wirft alles in den heissen Moloch, was sich in seinem Atelier finden lässt, auch seine eigenen Werke. Dann gibt es ein Getöse, der Ofen birst, wird hochgezogen und nun steht er da auf der Opernhausbühne, in neuer Bronze glänzend, kolossal, nackt und behelmt, das Schwert in der Rechten, und ausgestreckt in der Linken das abgeschlagene Haupt der Medusa: Perseus, der Held der griechischen Sage, in der Gestalt wie ihn der Renaissancekünstler Benvenuto Cellini epochal geformt hat, das Bild eines Kämpfers und Siegers.
Der Guss dieser Statue, dessen Gelingen allerlei Widrigkeiten in Frage stellen, ist der Zielpunkt der Handlung der Oper, und wenn er erreicht wird, stimmen Cellini und seine Mannschaft noch einmal den «Chant des ciseleurs» an: eine Hymne an die Kunst und das Glück des schöpferischen Vollendens. Und um das Mass voll zu machen, verbindet sich mit der Feier der künstlerischen Genietat auch das Glück der Liebe, das hier Cellini und Teresa heisst: ein doppeltes Finale aus Komödie und Künstlerdrama, das in der Zürcher Aufführung als genialischer Wurf erscheint, eine unvergessliche Meisterleistung des Regisseurs David Pountney, seines Ausstatters Richard Hudson, des Lichtgestalters Jürgen Hoffmann. Und demiurgisch brodelt dazu die Musik im sicheren und feurigen Griff des Dirigenten John Eliot Gardiner – auch eine Opernaufführung scheint sich hier wie in einem grandiosen Schmelz- und Gussvorgang zu vollenden.
Das Problem der Fassungen
Für Berlioz wurde die Vision des genialen Gelingens eher zu einem Trauma. Das Projekt wurde von der Opéra Comique abgelehnt. Umgearbeitet kam das Werk nach einer für den Komponisten aufreibenden Vorbereitung an der Opéra heraus. Die Uraufführung im September 1838 war ein Misserfolg. Nach wenigen Aufführungen zog Berlioz das Werk zurück. Erst Franz Liszt wagte 1852 in Weimar eine Neueinstudierung und stellte in Zusammenarbeit mit dem Komponisten eine kürzere, neue Version zusammen, die dann die weitere, im Ganzen eher schmale Wirkungsgeschichte bestimmte – bis in die sechziger Jahre, als man in London (John Pritchard, dann Colin Davis) wieder auf das Material der Pariser Uraufführung zurückgriff. Da dieses zwischen dem Anfang der Probenarbeit und in der Form wie es nach den Aufführungen archiviert wurde viele Änderungen erfahren hat, steht das Problem der Fassung seither am Anfang jeder Neueinstudierung, und auch das Opernhaus präsentiert eine eigene Version. Sie ist plausibel und stringent im Handlungsverlauf des schwierigen zweiten Aktes, schön beispielsweise in der neuen Motivation der Soloszene Ascanios, der nun mit seiner von Optimismus sprühenden Arie Cellini aufzumuntern versucht. Liliane Nikiteanu macht die Szene, in der sängerische Bravour auch serviert werden darf, mit Schalk, Herz und agilem Gesang zu einer Glanznummer der Aufführung.
Das Gegenstück einer rein buffonesken Parade der Thomas Mohr kräftiges Relief verleiht, bietet Cellinis lächerlicher Rivale Fieramosca, einen stimmmächtigen Auftritt hat der Papst (Nicolai Ghiaurov), wenn auch nur als Protagonist des Sextetts, und auch Teresas Vater Balducci – eine Partie für Alfred Muff – hat polternde Auftritte genug, um sich stimmlich markig in Szene zu setzen. Insgesamt aber kommen die vokalen Trumpfkarten nicht allzu oft ins Spiel. Denn zum einen hat Berlioz grossenteils witzige, sprühende und auch melodiös innige Ensemblemusik geschrieben, in der das Orchester immer gewichtig mit von der Partie ist, zum anderen verzichtet die Zürcher Fassung auf einige effektvolle Soli, so die Romanze Cellinis im ersten Akt und vor allem Teresas brillante Cavatine. Die Romanze, mit der sie nun auftritt, ist musikalisch zwar reich, aber auch etwas lang und gewiss nicht darauf angelegt, das Herz des Publikums so im Sturm zu erobern, wie das zündende «Quand j’aurai votre âge». Aber die Eroberung gelingt Chiara Taigi auch so: mit jugendlicher Spielfreude, einer erfrischenden Mischung aus Abgebrühtheit und entwaffnender Herzlichkeit, dazu einer grossen Skala klangschöner Töne, mit denen sie satte Kantilenen formt und gelegentliche Härten überstrahlt.
Berlioz hat diese Partie wie diejenige Cellinis für die grossen Stars der Epoche geschrieben und mit virtuosen Ansprüchen nicht gespart. Im Falle Cellinis handelt es sich um die Gratwanderung zwischen lyrischen Höhenflügen und dramatischer Durchschlagskraft, für die der Tenor Gregory Kunde wohl nicht die idealen Voraussetzungen besitzt. In der elegischen Romanze beeindruckt er mit einem schwebenden Ton, der keine Klippen scheut, aber dem impulsiven und mit ironischer Überlegenheit agierenden Draufgänger, den er darstellerisch überzeugend verkörpert, sind immer wieder auch Grenzen stimmlicher Expansion gesetzt, und der Ruf nach mehr Metall für den Perseus gilt alles in allem auch für den Darsteller seines Schöpfers.
Lyrischer Zauber und Rhythmik
Im musikalischen Rahmen, den John Eliot Gardiner vorgibt, ist die eher leichtgewichtige Besetzung oft auch in ihrem vollen Recht. Sein Dirigat geht dem lyrischen Zauber, den Berlioz in romantischer Reinkultur entfaltet, mit einer besonderen Behutsamkeit und Zartheit nach, und es ist vielleicht gerade das Mass an Innnigkeit im komödiantischen Trubel, das die besondere Faszination des «Benvenuto Cellini» ausmacht. Was da an instrumentalen Schönheiten, melodischen Kostbarkeiten hervorleuchtet! Welche Farbigkeit auch, die Gardiner mit schlanker und geschärfter Klanglichkeit herausarbeitet, wobei auch der skurrile Humor zum Zuge kommt, wenn sich die Orphikleide, die kleinere, aber ungelenkere Vorgängerin der Tuba, sogar solistisch auf der Bühne produziert. Aber natürlich ist Berlioz ein Mann auch der starken Effekte, und wie Gardiner den musikalischen Apparat auf Hochtouren bringt, durch alle rhythmischen Vertracktheiten hindurchführt, ist manchmal atemraubend. Aufs Höchste gefordert ist da neben den Solisten und dem Orchester zumal der Chor, imposant der «Chant des ciseleurs» und die Musik der revoltierenden Giesser und grandios das musikalische Feuerwerk, das der Chor im Finale des ersten Aktes, im grossen Tableau des römischen Karnevals, bietet.
Slapstick, Parodie, grosse Oper
Der römische Karneval ist auch der Höhepunkt eines bunten und aufwendigen, aber wunderbar klar choreografierten Kostümspektakels, das diese Inszenierung neben vielem anderen auch ist. Das viele andere in diesem «totalen Theater»: die krude Schauspielerei der Commedia dell'Arte und des Slapstick, in der David Pountney den Liebeshandel als Theater auf dem Theater abwickelt, die Parodie der grossen Oper, wenn sich Cellini und Teresa im Duett «Allegro con fuoco» zur Flucht entschliessen, dann aber auch die Momente unverstellter romantischer Expressivität voller Terzensüsse in Ascanios und Teresas «Prière», der magistrale Auftritt des Papstes, die zirzensische Magie von surrealer Bildhaftigkeit, wenn Arlequin zur sehnsüchtigen Melodie seiner Ariette am Seil über dem Bühnenboden schwebt, der geradezu naturalistische Coup de Théâtre der Arbeiter- und Gussszenen – das alles und mehr hat Raum in dieser Inszenierung und folgt doch einem einfachen Prinzip: deutlich die Geschichte zu erzählen und eine sympahtiegetränkte Ironie im Ganzen walten zu lassen.
«Benvenuto Cellini» mit dem machtbewussten und melancholischen Künstlerhelden im Zentrum hat, wie alles bei Berlioz, mit der Selbstentäusserung einer romantisch leidenden Künstlerseele zu tun, aber es waltet darin auch der objektive Blick eines musikalischen Shakespeareaners. In diesem Geist scheint das Bühnenwerk, das keiner der gängigen Gattungen seiner Zeit angemessen war und diese auch mit den technischen Ansprüchen überforderte, mit dieser Inszenierung jetzt auf der Bühne seinen eigentlichen Platz erhalten zu haben, und man möchte von einer neuen Vollendung des Perseus sprechen. Und wenn Benvenuto Cellini in seiner «Vita» von der Unmöglichkeit berichtet, den Guss mit den vorhandenen Mitteln bis zum rechten Fuss hinunter ganz gelingen zu lassen, so mag man auch bei diesem Akt der Vollendung im Opernhaus nicht auf den rechten Fuss starren.
|
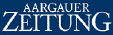 22. 10. 2002
22. 10. 2002
Alles ist Theater, nur der Papst ist echt
90 Jahre lang stand Hector Berlioz´ Oper «Benvenuto Cellini» nicht mehr auf dem Spielplan des Opernhauses Zürich: Schon allein dank des Dirigats von John Eliot Gardiner hat sich die Mühe, das sperrige Werk wieder auszugraben, gelohnt.
Christian Berzins
Für Zürcher Opern-Fastfood-Konsumenten stehen in der Saison 2002/2003 harte Zeiten bevor. Denn man wird das Gefühl nicht los, dass der Zürcher Opernintendant noch einmal im Bereich Raritätenpflege punkten will, bevor sich das Ende seiner Intendanz im Jahre 2006 nähert. Hat man über Jahre - mit ein paar netten Ausnahmen, die oft von besonderen «Stars» abhängig waren - das grosse, allseits bekannte Repertoire mit Schwerpunkt 19. Jahrhundert gepflegt und erneuert, steht diese Saison nun ungewohnte Kost bevor: Nach den harmlosen «Quattro rusteghi» von Ermanno Wolf-Ferrari folgt Schuberts «Fierrabras», bevor dann Mozarts «Idomeneo» oder Opern Haydns, Rameaus und Korngolds neu inszeniert werden. Und nun noch zuvor Hector Berlioz´ «Benvenuto Cellini»: Bei der Pariser Uraufführung 1838 fiel das Werk durch; nach einer Überarbeitung, die Franz Liszt angeregt hatte, feierte es 1852 immerhin Achtungserfolge. Für Zürich hat John Eliot Gardiner eine Fassung zusammengestellt, die auf mehrere Bearbeitungen zurückgreift.
Berlioz begeisterte die Idee, ein Künstlerdrama zu schaffen. Sein «Cellini» ist aber nicht nur ein Künstlerdrama, das die Erschaffung eines zentralen Werk des Bildhauers schildert (der Perseus-Statue, die heute in Florenz steht). Eingebettet in diese Schöpfung ist eine Liebesgeschichte, kommentiert und begleitet wird sie von drei sozialen Schichten: den Arbeitern, den Geistlichen sowie der bunten Menge am Karnevalstreiben. Die Schwierigkeit für den Regisseur besteht darin, die etwas starre Handlung voranzutreiben, die einzelnen Gruppen sowie die Individuen, vor allem Cellini, hervorzuheben.
Bei einem Regisseur wie David Pountney muss man um die Massenszenen keine Angst haben. Routiniert ordnet er, wo vermeintlich Chaos herrscht, geschickt gruppiert er, dass Klarheit entsteht. Dazu hilft vor allem auch das Bühnenbild von Richard Hudson: Es stellt ein Theater im Theater dar. Um Umbaupausen zu verhindern, tritt man immer wieder vor einen gemalten Vorhang, so wird die Richtigkeit des «Theaters im Theaters» bewahrt. Diese Theateridee ist ein alter Trick, aber für das Künstlerdrama ein legitimer und vor allem geschickter. Denn so kann im letzten Bild beim Giessen der Perseus-Statue tatsächlich eine Show veranstaltet werden, oder im Karnevalsakt können die Masken auf den Theaterrängen zirkulieren. Dank des packenden Bühnenbildes kommt man auch am Vorwurf des starren Ausstattungstheater vorbei.
Doch wie Pountney das Komödiantische seiner Figuren betont, ist bemühend. Im ersten Bild wollen die antiquierten Possen und billigen Zoten keine Ende nehmen; da wird vor allem vonseiten der Sopranistin Schabernack getrieben, der mit dem in der Handlung herrschenden Karneval gar nichts mehr gemeinsam haben will. Und auch später sind die Gesten so hilflos, dass man sich wahrlich in einem alten Theater fühlt. Damit ist endlich Schluss, als der Papst auftritt. Nicht irgendein Papst, sondern ein echter: der Sängerpapst Nicolai Ghiaurow.
Die Würde, die der 73 Jahre alte Bassist ist seinen Gesang legen kann, fasziniert. Ghiaurow arbeitet in wenigen Tönen eine Vielzahl von Details aus, sodass auch endlich zu hören ist, in welcher Sprache auf der Bühne gesungen wird. Seiner Höhe ist eine schimmernde Helligkeit inne, der viel Glanz eigen ist, und vor allem ist sie nach wie vor kräftig genug; die Tiefe orgelt nicht, sondern rollt sanft vor sich hin. Neben Ghiaurow fallen vor allem der kecke Mezzosopran von Liliana Nikiteanu (als Gehilfe Ascanio) und der bewegliche, kräftige wie ausdrucksfähige Bariton von Thomas Mohr (als Fieramosca) auf. Wäre doch in Chiara Taigis Stimme halb so viel Bewegung wie in ihrem Füssen und ihren Hüften! Doch Taigi (als Teresa, die Geliebte Cellinis) singt, ohne Gebrauch von dynamischen Differenzierungen zu machen. Ihr Piano ist ohne Halt und farblos. Die Stimme ist neben diesen technischen Mängeln anfänglich auch bereits im Mezzoforte-Bereich hart und scharf. Wenn sie mal an die Ausdrucksgrenze geht, hört man, warum sie es meist nicht tut. Gregory Kunde (in der Titelrolle) singt zwar nie «schön», ja seine Stimme hat selbst im mittleren Register kaum Charme, aber immerhin singt Kunde meist den Tönen nach. Aber sein Tenor gewinnt nie an Klang, immer ist da ein rauher Schleier über den Tönen. Und auch Alfred Muff, als fast schon ironisch überzeichneter Bassbuffo Balducci, wirkt durchwegs blass. Doch die Pflanzen, die auf der Bühne nicht so ganz blühen wollten, haben kräftigste Wurzeln im Graben: Das Orchester unter der Leitung von John Eliot Gardiner glänzt. Wer diese Art Berlioz-Interpretation nicht mag, sollte den genialischen Komponisten ganz meiden - ihn, der mit eigenen Regeln die starren Formen der französischen Musikwelt durchbrechen wollte. Doch was für lustvolle Regeln - und wie sie lustvoll umzusetzen sind!
Gardiner holt aus dem Zürcher Orchester die wundersamsten Farben; nicht ein parfümierter französischer Ton ist da zu hören, sondern Klänge mit dramatischem Furor. Gewiss, das Blech darf plärren, doch bei Gardiner ist es nicht zum Plärren da (wie manchmal bei Harnoncourt), sondern zum Klangmalen. Und zu einer enormen Gesanglichkeit kommt bei Gardiner die Ausarbeitung des Rhetorischen hinzu: das Orchester spricht hier, wird zum eigentlichen Erzähler. - Auch Opern-Fastfood-Konsumenten dürften an solcherart Musikzauber Spass haben.
|
 22. 10. 2002
22. 10. 2002
«Künstleroper» pompös und doch agil
Die Pariser Grande Opéra des 19. Jahrhunderts hat gigantische Ausmasse. Entsprechend gross ist der Ausstattungsaufwand für den riesigen Chor, Ballett, Statisten und die zahlreichen Solisten. Dies hinderte das Zürcher Opernhaus nicht daran, das selten mehr gespielte Stück «Benvenuto Cellini» von Hector Berlioz in einer neuen Fassung zu produzieren. John Eliot Gardiner und Regisseur David Pountney sorgten in dieser gar eindimensionalen «Künstleroper» für eine beeindruckende Lebendigkeit und Transparenz des Geschehens.
Hector Berlioz ist weniger der Dramatiker als der Mann der grossen, farbenreichen Tableaus. Er verlangt auch hier ein üppiges, reich instrumentiertes Orchester, das er kontrapunktisch feingliedrig verwebt und rhythmisch virtuos vorantreibt. Höhepunkte ergeben sich dabei vor allem in den Massenszenen mit schlagkräftigen Chören. John Eliot Gardiner gelang es, in dieser komplexen und harmonisch eigenwilligen Partitur den Klang transparent und agil zu halten. Er entschied sich dabei für «historische» Blechblasinstrumente wie Naturhörner und Posaunen, was deren sonst pathetischen Strahlglanz etwas milderte. Dazu kamen harte Schläger beim Schlagzeug, was der rhythmischen Kraft dieser Musik eine klangliche Überschärfe verlieh.
Eine neue Fassung
Gardiner hat für Zürich eine neue Fassung des «Benvenuto Cellini» erarbeitet. In Zusammenarbeit mit dem kritischen Herausgeber von Berlioz' Werken, Hugh Macdonald, und mit Regisseur David Pountney hat er aus der nie gespielten Urfassung, der zweiten Pariser Fassung und der Fassung von Franz Liszt, der das Werk in Weimar herausbrachte, eine auf die ursprünglichen Intentionen des Komponisten ausgerichtete neue Version zusammengestellt. Eine enorme Vorarbeit für ein Werk, das weder inhaltlich noch musikalisch viel Substanz aufweist. Zudem erwiesen sich an der Premiere in Zürich sowohl die intimeren Arien, Duette und Terzette, als auch die grossen Tableaus allesamt überlang zerdehnt.
Die Geschichte dreht sich um den Bildhauer Benvenuto Cellini, der in die Tochter des päpstlichen Schatzmeisters verliebt ist. Zudem hat dieser den Auftrag erhalten, für den Papst eine Statue des Perseus zu kreieren, und ist damit der Konkurrent des päpstlichen Bildhauers Fieramosca. Der Vater von Teresa hat auch diesen für sie vorgesehen. Cellini verspricht Teresa, sie während des Karnevals in Rom zu entführen und will sich ihr als Mönch zu erkennen geben. Doch sein Nebenbuhler hat den Plan belauscht und erscheint ebenfalls als Mönch. Die Verwirrung ist perfekt, Cellini bringt einen der Mönche um, er kann jedoch fliehen. Es ist schliesslich der Papst, der Cellini die Chance gibt, sein Kunstwerk bis zum Abend zu vollenden. Hält er die fast unmögliche Frist ein, soll ihm seine Mordtat vergeben und Teresa seine Frau werden. Natürlich gelingt es, auch wenn Cellini alle seine Meisterwerke in den Brennofen werfen muss, um genügend Metall für den Guss zu erhalten.
Theater im Theater
Regisseur David Pountney erwies sich auch in dieser heiklen, zwischen Humor und Tragödie schwankenden Geschichte einmal mehr als Meister in der Führung grosser Massen. Seine Kernidee ist der Trick mit dem Theater im Theater, wobei die theatralische Selbstinszenierung des Künstlers, wie sie auch Berlioz zu eigen war, humorvoll zum Tragen kommt. Die kleine Bühne auf der Bühne ist einerseits Wohnraum von Teresa, wird dann aber im Handumdrehen zur Theaterbühne im Karneval. Das erlaubt Pountney, die Einzelfiguren deutlich aus den Massen herauszuheben. Mit der halbfertigen mehretagigen Theaterlogen-Mauer im Hintergrund kommt zudem eine wei-tere Höhendimension der Spielebenen hinzu, die die Massenauftritte geschickt gliedert.
Handwerkender Männerchor
Einer der grossartigsten Momente ist die Giessereiwerkstatt von Cellini mit dem handwerkenden Männerchor: Wunderbar in die Musik hineinchoreographiert wird hier der Prozess des Erhitzens und des Abkühlens im Wasser: Feuer und Wasserdampf prägen das Bild. Im Schlussbild dann, in dem es um den Guss der Perseus-Statue geht, steht der übergrosse Giessofen in der Mitte des Bühnenraums. Das lodernde Feuer und der Dampf treten geheimnisvoll aus allen Ritzen des Ofens, aus dem schliesslich die heldisch-pathetische Statue ersteht. Auch hier wird der Giesser-Chor wirkungsvoll choreographiert geführt und singt dabei trotzdem sehr schlagkräftig, wenn auch manchmal etwas gar laut.
Solche Massenszenen dominieren die Oper: Volk, Karneval und Geistliche sorgen für gehörigen Tumult. Dass bei den rhythmisch und kontrapunktisch heikel auf das Orchester abgestimmten Chorpartien an der Premiere noch nicht alles präzise koordiniert wirkte, ist nachvollziehbar. Um so willkommener waren die kleineren Ensembles der Solistinnen und Solisten, die auch einige musikalische Juwelen brachten. Der musikalische Höhepunkt war dabei das Terzett im ersten Bild von Teresa, Cellini und dem sie belauschenden Fieramosca, ein auch dramaturgisch wirkungsvoller Moment, der sich aber leider wie so vieles in die Länge verlor.
Eigenwillige Harmonien
Für die Sängerinnen und Sänger stellen die solistischen Partien eine grosse Herausforderung dar. Harmonisch oft eigenwillig abgestützt, sind sie schwierig zu intonieren und pendeln zwischen agiler Leichtigkeit und dramatisiertem Pathos. Durch die subtil auf die Musik abgestimmte Personenführung von David Pountney fanden sie aber auch szenisch einigen Halt. Eine hervorragende Bühnenpräsenz brachte Chiara Taigi als Teresa mit. Sie reagierte in ihrer langfädigen Auftrittsarie bis in die Zehenspitze auf musikalische Raffinessen, spielte sehr lebendig und bekundete einzig mit der Intonation einige Probleme. Dies machte sie aber mit einer warmen Strahlkraft ihrer Stimme und einem verspielten Temperament wett. Etwas weniger prägnant wirkte neben ihr Gregory Kunde als Cellini. Seine weiche und agile Tenorstimme bekundete vor allem im Dramatischen Mühe, sich durchzusetzen. Doch auch er vermochte schauspielerisch wertvolle Akzente zu setzen und einige der raren innigen Momente zu vermitteln.
Prägnanz für Karikatur
Gut zu dieser weichen Künstlerstimme passte der giftig dazwischenfunkende Fieramosca von Thomas Mohr, der dieser pompösen Karikatur von sich selbst Prägnanz und Strahlkraft verlieh. Alfred Muff musste mit der etwas undankbaren Rolle des ständig schimpfenden Vaters von Teresa vorlieb nehmen, in der er auch etwas blass blieb. Liliana Nikiteanu hingegen sorgte als Cellinis Bursche Ascanio im Schlussbild im Duett mit dem Meister für einen weiteren musikalisch-szenischen Höhepunkt des Abends. So stereotyp all diese Figuren sind und bleiben, ihre üppig pompösen Renaissance-Kostüme in der luxuriösen Ausstattung von Richard Hudson prägten das Gesamtbild markant. Auch hier viel Aufwand für ein mittelprächtiges Werk.
Sibylle Ehrismann
|

22. 10. 2002
Opulent inszeniert
David Pountney liebt üppige Bilder auf der Bühne. In Zürich inszeniert er Berlioz' «Benvenuto Cellini» voll sprühender Lebensfreude und mit einem Schuss Ironie.
Eine vor «joie de vivre» förmlich überbordende Oper mit sowohl gesanglich wie schauspielerisch überzeugenden Darstellerinnen und Darstellern und einer üppigen, aber klugen Inszenierung feierte am Sonntagabend im Opernhaus Zürich Premiere. Die turbulente Opéra comique «Benvenuto Cellini» von Hector Berlioz, die in dieser Saison zum ersten Mal seit 90 Jahren wieder in Zürich aufgeführt wird, präsentiert eine Version, die John Eliot Gardiner und der designierte Intendant der Bregenzer Festspiele, David Pountney, gemeinsam mit dem kritischen Herausgeber der Werke Berlioz', Hugh Macdonald, neu erarbeitet haben, eine Fassung, die ursprüngliche Intentionen des Komponisten mit späteren Varianten verbindet.
Die Oper, die für Berlioz eines der grössten Fiaskos war und seit 1838 noch immer selten auf den Spielplan gesetzt wird, haben Gardiner und Pountney mit viel Engagement und Witz erfolgreich entstaubt. Der italienische Bildhauer Benvenuto Cellini (1500-1571), dessen Leben als Grundlage für das Opernlibretto diente, ist hier die vor Vitalität berstende und verliebte, aber vor Jähzorn und Depression durchaus nicht gefeite Künstlerfigur, die für den Papst eine Perseus-Statue fertigen soll. Die Karnevalsszenen sind bunte Feuerwerke, das Schauspiel frei von Pathos; David Pountney spielt virtuos mit den Möglichkeiten der Bühnentechnik und reflektiert die verwickelte Handlung mit einem wohltuenden Schuss Ironie. Unter den Händen Gardiners wird die komplexe, kontrapunktische Partitur plastisch und reich an Orchesterfarben, äusserst einfallsreich sind auch das Bühnenbild und die Kostüme von Richard Hudson. Unter den Darstellenden brillieren neben Gregory Kunde als Cellini und Chiara Taigi als seine Geliebte Teresa insbesondere Thomas Mohr in der Rolle des Nebenbuhlers Fieramosca und Liliana Nikiteanu als Ascanio. (bsp)
|

